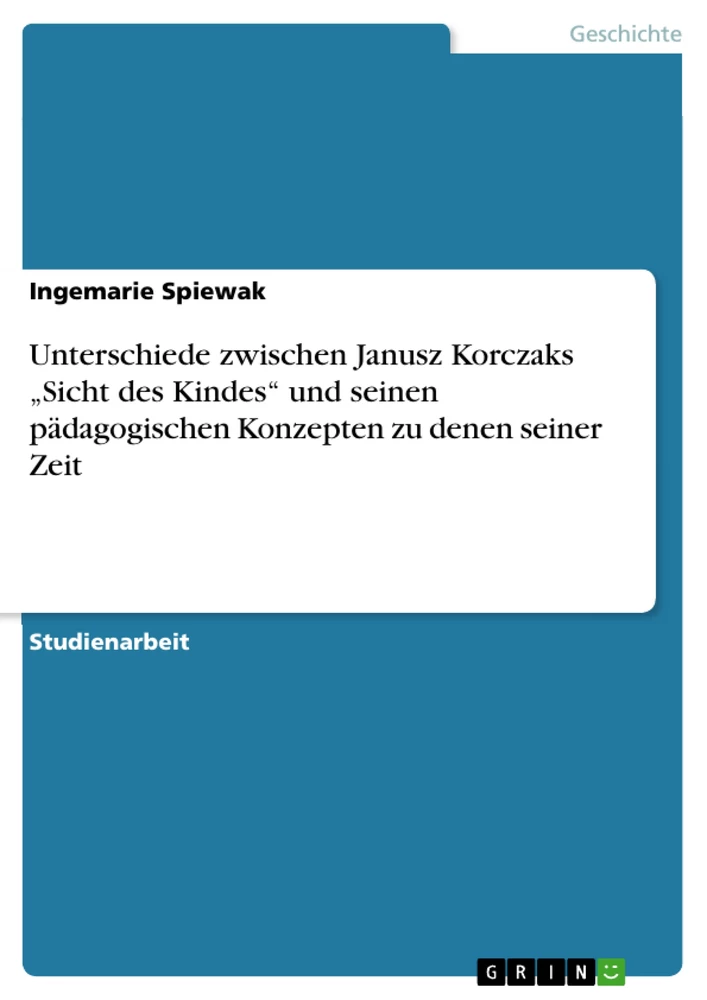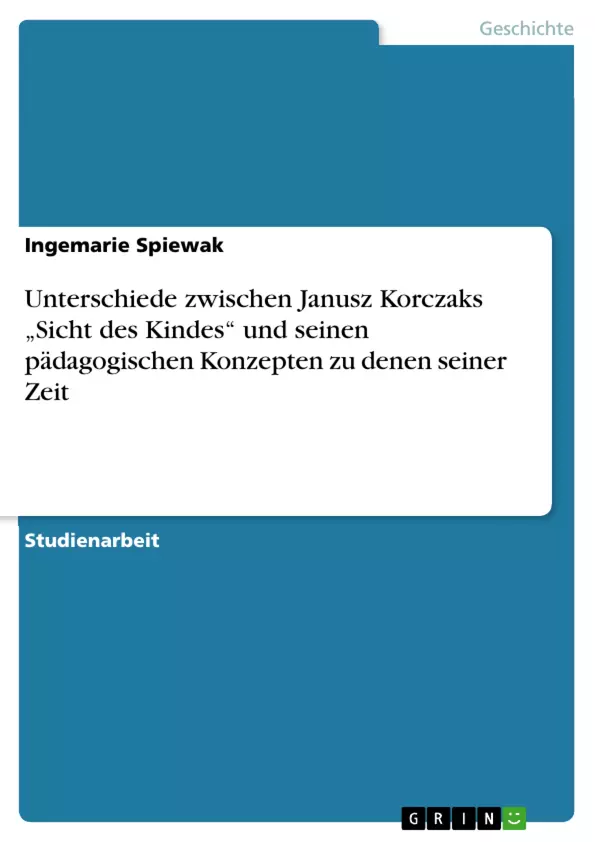„Die Geschichte soll nicht das Gedächtnis beschweren, sondern den Verstand erleuchten“ (Gotthold E. Lessing)
Dieses Zitat wähle ich als Anfang meiner Hausarbeit, da es begreiflich macht, dass eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte unumgänglich ist, um die heutigen Theorie und Praxen der Sozialen Arbeit zu verstehen. Denn durch sie begreifen wir, dass wir Teil einer Entwicklung sind, die wir in der Zukunft aktiv mitgestalten werden.
Bei der Auseinandersetzung mit den Wurzeln unserer Arbeit treffen wir immer wieder auf Persönlichkeiten, die die Geschichte der Sozialen Arbeit geprägt haben und ihre Entwicklung noch bis heute mit innovativen Ideen formen.
Janusz Korczak ist einer dieser Menschen, die beharrlich versuchten etwas zu bewegen. Dabei stand für ihn die „Sache des Kindes“ im Mittelpunkt.
„Ich habe es gelobt und dabei will ich bleiben: der Sache des Kindes bin ich verpflichtet.“ (Korzcak zit. n. Newerly 1972 XVII)
Es stellt sich nun die Frage, wie sich Janusz Korczaks „Sicht des Kindes“ und seine pädagogischen Konzepte von der seiner Zeit unterscheiden.
Nachdem der Blick dieser Hausarbeit zunächst auf die Person Korczaks gerichtet wird, werden die Erziehungskonzepte seiner Zeit aufgezeigt und anschließend Korczaks „pädagogisches Konzept“ gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wer ist Janusz Korczak? Seine Biografie
- Ausgangslage der Erziehungspädagogik
- Korczaks Erziehungsmethode
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die „Sicht des Kindes“ und die pädagogischen Konzepte von Janusz Korczak im Kontext seiner Zeit zu analysieren und die Unterschiede zu den gängigen Erziehungsideen seiner Zeit aufzuzeigen.
- Die Biografie von Janusz Korczak und seine Motivation für die Arbeit mit Kindern
- Die Erziehungsideen und -praktiken der Zeit, in der Korczak lebte
- Die Besonderheiten von Korczaks pädagogischem Ansatz
- Die Rolle des Kindes in Korczaks Pädagogik
- Die Bedeutung von Korczaks Werk für die heutige Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit Janusz Korczak für die heutige Soziale Arbeit.
- Wer ist Janusz Korczak? Seine Biografie: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben von Janusz Korczak und zeichnet seinen Werdegang bis zu seiner tragischen Ermordung im Warschauer Ghetto nach. Dabei wird besonderer Wert auf seine Motivation für die Arbeit mit Kindern gelegt.
- Ausgangslage der Erziehungspädagogik: Dieses Kapitel skizziert die Erziehungsideen und -praktiken der Zeit, in der Korczak lebte. Es wird auf die Entwicklung der Pädagogik ab dem 17. Jahrhundert und die Bedeutung der Aufklärung eingegangen.
Schlüsselwörter
Janusz Korczak, Kinderrechte, Pädagogik, Erziehung, Waisenhaus, Dom Sierot, „Sache des Kindes“, Aufklärung, Sozialisation, Kinderperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Janusz Korczak?
Korczak war ein polnischer Arzt, Kinderbuchautor und Pädagoge, der sein Leben den Rechten der Kinder widmete und mit ihnen im Warschauer Ghetto starb.
Was ist das Besondere an Korczaks "Sicht des Kindes"?
Er sah Kinder als vollwertige Menschen an, die ein Recht auf Achtung, eigene Geheimnisse und sogar das Recht auf den Tod haben.
Wie unterschied sich Korczaks Pädagogik von der seiner Zeit?
Während die damalige Pädagogik oft autoritär war, setzte Korczak auf Partizipation, Selbstverwaltung der Kinder und eine Erziehung auf Augenhöhe.
Was war das Waisenhaus "Dom Sierot"?
Ein von Korczak geleitetes Waisenhaus in Warschau, in dem er seine Konzepte der Kinderselbstverwaltung und eines Kindergerichts praktisch umsetzte.
Welche Rolle spielt die Aufklärung in Korczaks Werk?
Korczak knüpfte an humanistische Ideale an, radikalisierte sie aber, indem er die Autonomie des Kindes konsequent ins Zentrum stellte.
Warum ist Korczak für die heutige Soziale Arbeit relevant?
Seine Pionierarbeit für Kinderrechte bildet die Grundlage für moderne Konzepte der Partizipation und des Kinderschutzes.
- Quote paper
- Ingemarie Spiewak (Author), 2008, Unterschiede zwischen Janusz Korczaks „Sicht des Kindes“ und seinen pädagogischen Konzepten zu denen seiner Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92513