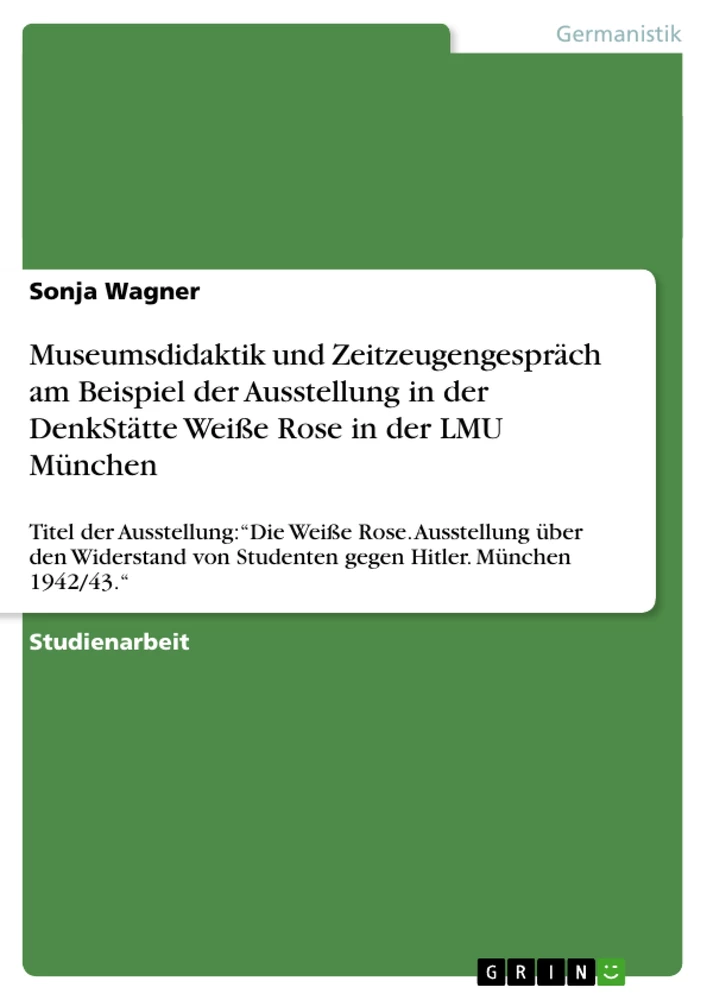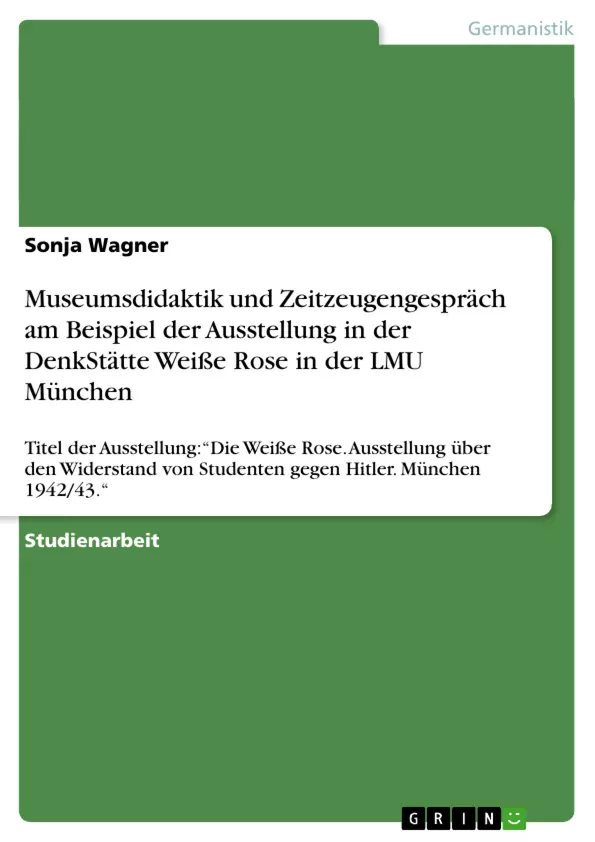In dieser Seminararbeit sollen zunächst allgemeine Dinge erläutert werden, nämlich was ein Museum und eine Gedenkstätte überhaupt sind und welche Ansprüche sie erheben. Danach gehe ich auf die didaktisch-methodische Vorbereitung auf einen effektiven Besuch in einer Ausstellung zum Thema Nationalsozialismus ein. Welches Vorwissen müssen die Schüler mitbringen? Welche Punkte muss man bei der Planung eines Ausstellungsbesuches besonders beachten? Warum ist ein Zeitzeugengespräch sinnvoll? Im Rahmen des Hauptseminars “Sprache und Literatur im Dritten Reich als Problem des Deutschunterrichts“ unternahm ich einen Besuch in die DenkStätte und werde dessen Ablauf schildern. Der letzte Punkt meiner Arbeit sind die Beschreibung und die didaktische Beurteilung der Denkstätte. Besucht man mit einer Klasse ein Museum, so ist kann dies als eine Art des außerschulischen Lernens angesehen werden. Jede Form des Unterrichts, die außerhalb des Schulgebäudes stattfindet, erfordert einen größeren organisatorischen Aufwand. Doch man zieht auch viel Profit aus solchen Exkursionen: Andere räumliche Gegebenheiten und fremde Personen machen die Schüler neugierig. Diese Neugier nimmt der Lehrer als Basis, um das Interesse der Schüler für die zu behandelnde Thematik zu wecken und einen möglichst großen Lerneffekt zu erzielen.
Als Beispiel für einen Museumsbesuch habe ich eine Führung durch die DenkStätte mit anschließendem Zeitzeugengespräch gewählt. Die DenkStätte wurde in der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Gedenken an den Widerstand der Weißen Rose eingerichtet.
Ein Aufenthalt mit der Klasse in der DenkStätte und besonders ein Zeitzeugengespräch sind eine echte Herausforderung. Der Nationalsozialismus und der Widerstand sind sensible Themen, mit denen der adäquate Umgang schwierig ist. Nur mit didaktischen Vorüberlegungen ist es möglich, diese Herausforderung entsprechend zu meistern.
In dieser Seminararbeit sollen zunächst allgemeine Dinge erläutert werden, nämlich was ein Museum und eine Gedenkstätte überhaupt sind und welche Ansprüche sie erheben. Danach gehe ich auf die didaktisch-methodische Vorbereitung auf einen effektiven Besuch in einer Ausstellung zum Thema Nationalsozialismus ein. Welches Vorwissen müssen die Schüler mitbringen? Welche Punkte muss man bei der Planung eines Ausstellungsbesuches besonders beachten? Warum ist ein Zeitzeugengespräch sinnvoll?
Inhaltsverzeichnis
- Der Denkstätten-Besuch als didaktische Herausforderung
- Das Museum und die Gedenkstätte als außerschulischer Lernort
- Das Museum aus didaktischer Sichtweise
- Die Gedenkstätte
- Welches Vorwissen benötigen die Schüler für den Besuch in der DenkStätte?
- Wissen über den Nationalsozialismus und heutige Tendenzen
- Wissen über Widerstandsbewegungen wie die Weiße Rose
- Die Vorbereitung eines Arbeitsbesuches im Museum
- Rahmenplanung
- Inhaltliche Planung
- Probleme des Lehrers bei der Vorbereitung des Besuchs in einer Gedenkstätte
- Warum ist ein Zeitzeugengespräch sinnvoll?
- Der Ablauf im Museum mit Zeitzeugengespräch
- Beschreibung der räumlichen Gegebenheiten
- Interview mit Michael Kaufmann, dem Leiter der DenkStätte
- Verbesserungsvorschläge für die Denkstätte
- Außerschulisches Lernen ist einen Aufwand wert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die didaktischen Herausforderungen und Möglichkeiten eines Museumsbesuchs, speziell einer Gedenkstätte, im Schulunterricht. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung und Durchführung eines Besuchs in der Denkstätte Weiße Rose in München, inklusive eines Zeitzeugengesprächs. Die Arbeit analysiert die Rolle des Museums und der Gedenkstätte als außerschulische Lernorte und beleuchtet die Bedeutung der Vorplanung und des Vorwissens der Schüler.
- Didaktische Herausforderungen des Denkstättenbesuchs
- Museum und Gedenkstätte als außerschulische Lernorte
- Vorbereitung und Planung eines Museumsbesuchs zum Thema Nationalsozialismus
- Bedeutung von Zeitzeugengesprächen
- Didaktische Beurteilung der Denkstätte Weiße Rose
Zusammenfassung der Kapitel
Der Denkstätten-Besuch als didaktische Herausforderung: Der Besuch einer Gedenkstätte im Kontext des Schulunterrichts wird als Form des außerschulischen Lernens betrachtet, welches einen höheren organisatorischen Aufwand erfordert. Die Arbeit betont jedoch den großen Lerneffekt durch neue räumliche Gegebenheiten und den Kontakt mit fremden Personen, welche die Neugier der Schüler wecken und das Interesse am Thema steigern. Am Beispiel der Denkstätte Weiße Rose werden die besonderen Herausforderungen angesprochen, die sich aus der Sensibilität der Thematik Nationalsozialismus und Widerstand ergeben. Die Arbeit kündigt an, sich mit der Vorbereitung, Durchführung und didaktischen Bewertung eines solchen Besuchs auseinanderzusetzen.
Das Museum und die Gedenkstätte als außerschulischer Lernort: Dieses Kapitel differenziert zwischen Museum und Gedenkstätte. Es beschreibt die Entwicklung des Museums von privaten Sammlungen zu öffentlichen Bildungseinrichtungen und die Rolle der Museumspädagogik zur Vermittlung komplexer Zusammenhänge an ein breites Publikum. Die Museumspädagogik wird als Mittler zwischen Museologie und Erziehungswissenschaft definiert, mit dem Ziel, demokratisch und rechtstaatlich denkenden Persönlichkeiten zu fördern. Die Herausforderungen der Kommunikation im Museum, wie das "verbale Kommunikationsverbot" und die Einwegkommunikation bei Führungen, werden angesprochen. Die Gedenkstätte wird als Sonderform des Museums vorgestellt, deren Ziel es ist, das Unbegreifliche begreifbar zu machen und die Erinnerung wachzuhalten.
Welches Vorwissen benötigen die Schüler für den Besuch in der DenkStätte?: Dieser Abschnitt betont die Wichtigkeit des Vorwissens der Schüler über den Nationalsozialismus und heutige Tendenzen sowie über Widerstandsbewegungen wie die Weiße Rose. Er unterstreicht, dass eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema nur mit einer gründlichen Vorbereitung möglich ist. Ein solides Verständnis des historischen Kontextes ist für ein sinnvolles und verantwortungsvolles Lernen in der Gedenkstätte unabdingbar.
Die Vorbereitung eines Arbeitsbesuches im Museum: Dieses Kapitel behandelt die didaktisch-methodische Vorbereitung eines Museumsbesuchs, einschließlich der Rahmenplanung (z.B. Organisation, Zeitplan) und der inhaltlichen Planung (z.B. didaktische Ziele, Methoden). Es thematisiert zudem die spezifischen Probleme, die sich für Lehrer bei der Vorbereitung eines Besuchs in einer Gedenkstätte ergeben, da die Sensibilität des Themas eine besondere Sorgfalt erfordert.
Warum ist ein Zeitzeugengespräch sinnvoll?: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung von Zeitzeugengesprächen im Kontext eines Gedenkstättenbesuchs. Es wird argumentiert, dass direkte Begegnungen mit Zeitzeugen eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Geschichte greifbarer und emotionaler zu erleben, und ein tieferes Verständnis der Ereignisse und ihrer Auswirkungen ermöglichen. Die direkte Begegnung verleiht den historischen Ereignissen eine neue Dimension.
Der Ablauf im Museum mit Zeitzeugengespräch: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf des Museumsbesuchs und des Zeitzeugengesprächs in der Denkstätte Weiße Rose. Es umfasst die räumlichen Gegebenheiten der Denkstätte, ein Interview mit dem Leiter, Michael Kaufmann, und konkrete Verbesserungsvorschläge für die didaktische Gestaltung der Denkstätte. Der Abschnitt fokussiert auf den praktischen Aspekt des Besuchs und die unmittelbare Erfahrung.
Schlüsselwörter
Museumsdidaktik, Gedenkstätte, Weiße Rose, Nationalsozialismus, Widerstand, Zeitzeugengespräch, außerschulisches Lernen, Didaktik, Vorbereitung, Planung, Schüler, Lehrer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Didaktische Herausforderungen und Möglichkeiten eines Museumsbesuchs (Gedenkstätte Weiße Rose)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die didaktischen Herausforderungen und Möglichkeiten eines Museumsbesuchs, insbesondere einer Gedenkstätte, im Schulunterricht. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung und Durchführung eines Besuchs in der Gedenkstätte Weiße Rose in München, inklusive eines Zeitzeugengesprächs. Analysiert werden die Rolle des Museums und der Gedenkstätte als außerschulische Lernorte sowie die Bedeutung der Vorplanung und des Vorwissens der Schüler.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die didaktischen Herausforderungen des Denkstättenbesuchs, Museum und Gedenkstätte als außerschulische Lernorte, die Vorbereitung und Planung eines Museumsbesuchs zum Thema Nationalsozialismus, die Bedeutung von Zeitzeugengesprächen und eine didaktische Beurteilung der Denkstätte Weiße Rose.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit folgenden Aspekten befassen: Der Denkstätten-Besuch als didaktische Herausforderung; Das Museum und die Gedenkstätte als außerschulischer Lernort; Welches Vorwissen benötigen die Schüler für den Besuch in der DenkStätte?; Die Vorbereitung eines Arbeitsbesuches im Museum; Warum ist ein Zeitzeugengespräch sinnvoll?; Der Ablauf im Museum mit Zeitzeugengespräch; Außerschulisches Lernen ist einen Aufwand wert. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Rolle spielt das Vorwissen der Schüler?
Die Seminararbeit betont die entscheidende Bedeutung des Vorwissens der Schüler über den Nationalsozialismus, heutige Tendenzen und Widerstandsbewegungen wie die Weiße Rose. Ein solides Verständnis des historischen Kontextes ist für ein sinnvolles und verantwortungsvolles Lernen in der Gedenkstätte unerlässlich.
Warum ist ein Zeitzeugengespräch wichtig?
Zeitzeugengespräche werden als einzigartige Möglichkeit hervorgehoben, die Geschichte greifbarer und emotionaler zu erleben und ein tieferes Verständnis der Ereignisse und ihrer Auswirkungen zu ermöglichen. Die direkte Begegnung verleiht den historischen Ereignissen eine neue Dimension.
Wie wird die Denkstätte Weiße Rose didaktisch bewertet?
Die Seminararbeit beinhaltet eine didaktische Beurteilung der Denkstätte Weiße Rose, einschließlich einer Beschreibung der räumlichen Gegebenheiten, eines Interviews mit dem Leiter Michael Kaufmann und konkreter Verbesserungsvorschläge für die didaktische Gestaltung.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Vorbereitung eines Denkstättenbesuchs?
Die Arbeit thematisiert die organisatorischen und inhaltlichen Herausforderungen der Vorbereitung eines Denkstättenbesuchs, insbesondere die Sensibilität des Themas Nationalsozialismus und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung, um ein angemessenes und verantwortungsvolles Lernumfeld zu schaffen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Museumsdidaktik, Gedenkstätte, Weiße Rose, Nationalsozialismus, Widerstand, Zeitzeugengespräch, außerschulisches Lernen, Didaktik, Vorbereitung, Planung, Schüler, Lehrer.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrer, Museumspädagogen, Studierende der Pädagogik und alle, die sich mit der Didaktik des Geschichtsunterrichts und der Nutzung außerschulischer Lernorte befassen.
- Quote paper
- M.B.A. + Eng. Sonja Wagner (Author), 2002, Museumsdidaktik und Zeitzeugengespräch am Beispiel der Ausstellung in der DenkStätte Weiße Rose in der LMU München, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92550