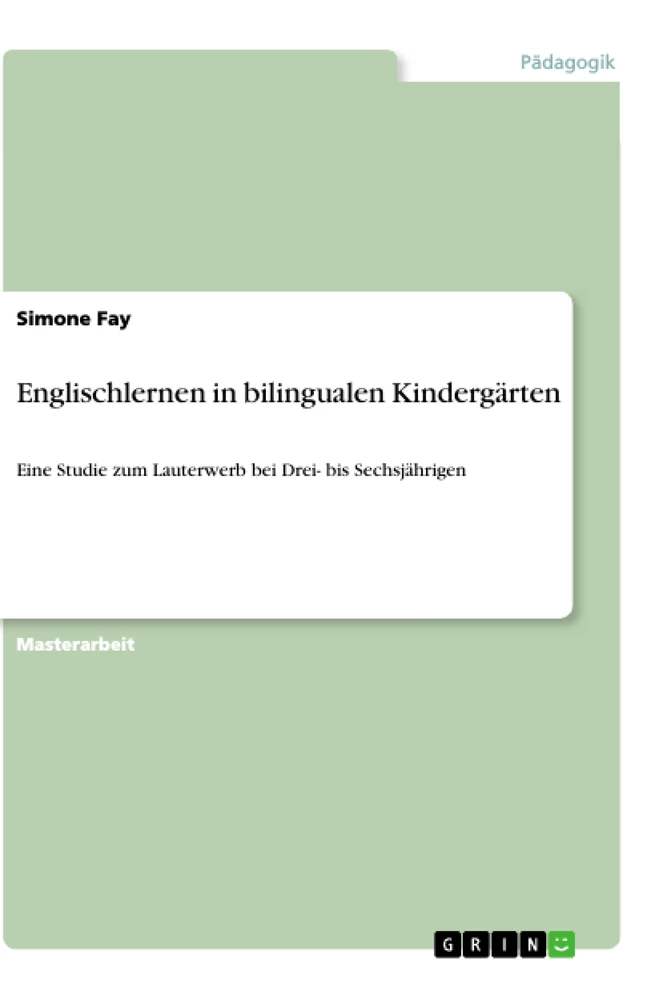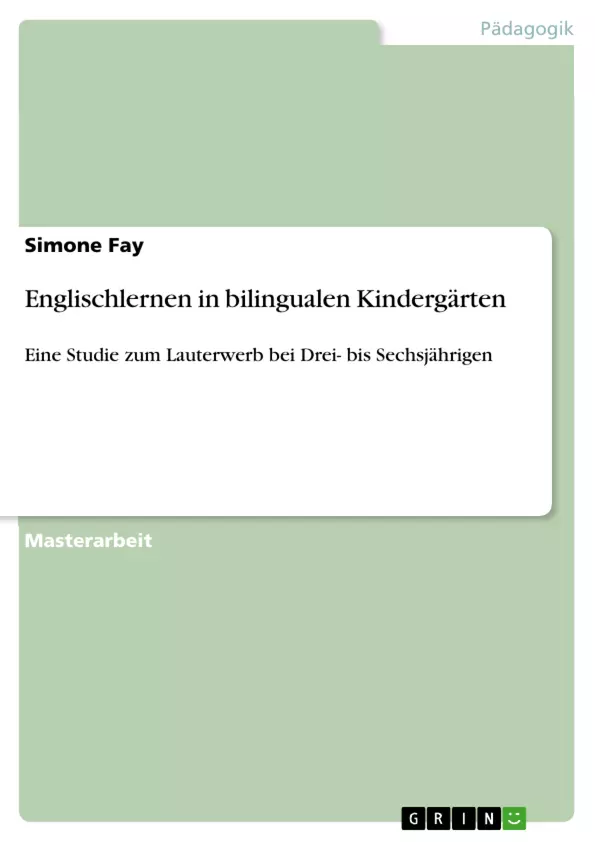Die Arbeit fokussiert den frühen Fremdsprachenerwerb und erforscht lerner-spezifische Variationen im Prozess des zielsprachlichen Erwerbs.
Der Autor versucht hierfür die Forschungsfrage zu beantworten: "Unterscheiden sich die fremdsprachlichen Produktionen deutscher Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die Englisch in einem natürlichen Kontext lernen, von denen mutter- sprachlicher Äußerungen, und wenn ja, in welcher Weise findet Variation statt?"
Zunächst werden hierzu allgemeine spracherwerbliche Theorien zum Erst- sowie Zweitspracherwerb beleuchtet. Dabei gilt ein Schwerpunkt den im Phonetik-Phonologie-Erwerb relevanten phonologischen Prozessen. Entsprechend wird eine erste theoretische Antwort auf die Forschungsfrage postuliert. Im empirischen Teil wird die Forschungsfrage mittel kontrastiver Analyse der Sprachsysteme sowie der erhobenen Daten beantwortet und mit den Theorien zusammengeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprache - Eine komplexe menschliche Fähigkeit & wie man sie lernt
- 2.1 Spracherwerb als Verarbeitung sprachlichen Inputs & die Kreativität des Lerners
- 2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Spracherwerb
- 2.3 Anatomische Grundlagen menschlicher Sprachlern)-fähigkeit
- 2.3.1 Anatomische Grundlagen und Funktionsweisen des Gehirns im Hinblick auf Sprache
- 2.3.2 Anatomische Grundlagen der Sprachperzeption
- 2.3.3 Anatomische Grundlagen der Sprachproduktion
- 3. Der Erstspracherwerb
- 3.1 Spracherwerb - Beginn, Voraussetzungen & Aufgaben
- 3.2 Phonetik-Phonologie-Erwerb
- 3.2.2 (Frühe) Lautproduktion
- 3.2.3 Variation als wichtiges Charakteristikum früher phonologischer Entwicklung
- 4. Der Zweitspracherwerb
- 4.1 Früher natürlicher Zweitspracherwerb und eine Möglichkeit der Implementierung – Bilinguale Kindergärten
- 4.2 Zweitspracherwerb und wie er sich vom Erstspracherwerb unterscheidet
- 4.3 Phonetik-Phonologie-Erwerb in der Zweitsprache
- 4.3.1 Sprachperzeption im Zweitspracherwerb
- 4.3.2 Sprachproduktion im Zweitspracherwerb
- 4.4 Transfer - die Interaktion zweier phonetischer Systeme
- 5. Variationen in der Zielsprache
- 5.1 Nicht zielgerechte Sprachproduktion im Zweitspracherwerb sowie ihre Ursachen
- 5.2 Kontrastive Analyse: Deutsch - Englisch
- 5.3 Analyse der kontrastierenden Laute sowie sich daraus ergebende mögliche Variationen der Zielsprache
- 5.3.1 Der labial-velare Approximant [w]
- 5.3.2 Das Phonem /r/ und seine Allophone
- 5.3.3 Die (inter)dentalen Frikative [] und []
- 5.3.4 Der Vokal [*]
- 5.4 Zusammenfassung und theoriegestützte Antwort auf die Forschungsfrage
- 6. Empirischer Teil
- 6.1 Forschungsdesign
- 6.1.1 Erhebungsdesign
- 6.1.2 Probanden
- 6.1.3 Durchführung
- 6.1.4 Gütekriterien
- 6.2 Ergebnisse
- 6.2.1 Überblick der gesamten Daten
- 6.2.2 Ergebnisse der einzelnen Ziel-Laute und weitere Variationen
- 6.3 Interpretation der Ergebnisse
- 6.3.1 Kontrastive/Fehler-Analyse nach Wode 1988
- 6.3.2 Analyse der erhobenen Daten
- 7. Abschlussdiskussion, Reflexion, Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den Laut-Erwerb von Drei- bis Sechsjährigen in bilingualen Kindergärten. Ziel ist es, die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs im Vergleich zum Erstspracherwerb zu beleuchten und Variationen in der Zielsprache (Englisch) zu analysieren. Der Fokus liegt auf phonetisch-phonologischen Aspekten.
- Vergleich Erst- und Zweitspracherwerb
- Phonetisch-phonologische Entwicklung im bilingualen Kontext
- Analyse von Variationen in der englischen Zweitsprache
- Einfluss des muttersprachlichen Systems (Deutsch) auf den Zweitspracherwerb
- Theoretische Fundierung und empirische Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Englischlernens in bilingualen Kindergärten ein und begründet die Relevanz der Forschungsfrage nach dem Laut-Erwerb bei Drei- bis Sechsjährigen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfrage.
2. Sprache - Eine komplexe menschliche Fähigkeit & wie man sie lernt: Dieses Kapitel beleuchtet die Komplexität des Spracherwerbs und stellt verschiedene theoretische Ansätze vor, die den Prozess erklären. Es werden auch die anatomischen Grundlagen der menschlichen Sprachfähigkeit detailliert behandelt, sowohl im Hinblick auf die Perzeption als auch die Produktion von Sprache.
3. Der Erstspracherwerb: Dieses Kapitel fokussiert auf den Prozess des Erstspracherwerbs, beginnend mit den Voraussetzungen und Aufgaben. Es analysiert die phonetisch-phonologische Entwicklung mit einem Schwerpunkt auf der frühen Lautproduktion und der Rolle von Variation in dieser Entwicklungsphase. Der Kapitelverlauf zeigt auf, wie aus einfachen Lauten immer komplexere Sprachstrukturen gebildet werden.
4. Der Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel widmet sich dem Zweitspracherwerb und vergleicht ihn mit dem Erstspracherwerb. Der Fokus liegt auf dem frühen, natürlichen Zweitspracherwerb in bilingualen Kindergärten. Es werden die Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb im Bereich der Phonetik und Phonologie erörtert, inklusive der Rolle der Sprachperzeption und -produktion. Der Einfluss des Transfers zwischen den beiden Sprachsystemen wird analysiert.
5. Variationen in der Zielsprache: In diesem Kapitel werden nicht-zielgerechte Sprachproduktionen im Zweitspracherwerb und deren Ursachen untersucht. Eine kontrastive Analyse von Deutsch und Englisch bildet die Grundlage zur Identifizierung potenzieller Variationen. Konkrete Beispiele für kontrastierende Laute (z.B. [w], /r/, interdentale Frikative, Vokale) werden detailliert analysiert.
6. Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign, die Methodik (Erhebungsdesign, Probanden, Durchführung und Gütekriterien) und die Ergebnisse der empirischen Studie. Die erhobenen Daten werden analysiert und im Kontext der vorhergehenden theoretischen Überlegungen interpretiert, unter Verwendung der kontrastiven Fehleranalyse nach Wode (1988).
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Erstspracherwerb, Bilingualismus, Kindergärten, Phonetik, Phonologie, Lautproduktion, Sprachperzeption, Kontrastive Analyse, Deutsch, Englisch, Variationen, Fehleranalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Laut-Erwerb bei Drei- bis Sechsjährigen in bilingualen Kindergärten
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Laut-Erwerb von Drei- bis Sechsjährigen in bilingualen Kindergärten, speziell den Erwerb der englischen Sprache als Zweitsprache. Im Fokus stehen phonetisch-phonologische Aspekte und der Vergleich zum Erstspracherwerb (Deutsch).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs im Vergleich zum Erstspracherwerb und analysiert Variationen in der Zielsprache (Englisch). Es wird untersucht, wie das muttersprachliche System (Deutsch) den Zweitspracherwerb beeinflusst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich von Erst- und Zweitspracherwerb, die phonetisch-phonologische Entwicklung im bilingualen Kontext, die Analyse von Variationen in der englischen Zweitsprache, den Einfluss des Deutschen auf den englischen Zweitspracherwerb und die theoretische Fundierung sowie die empirische Untersuchung dieser Aspekte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Sprache als komplexe Fähigkeit und Spracherwerb, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Variationen in der Zielsprache, Empirischer Teil und Schlussdiskussion. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt des Laut-Erwerbs im bilingualen Kontext.
Wie wird der Erstspracherwerb behandelt?
Das Kapitel zum Erstspracherwerb konzentriert sich auf den Prozess des Spracherwerbs, beginnend mit den Voraussetzungen und Aufgaben. Es analysiert die phonetisch-phonologische Entwicklung mit Schwerpunkt auf früher Lautproduktion und der Rolle von Variation.
Wie wird der Zweitspracherwerb behandelt?
Das Kapitel zum Zweitspracherwerb vergleicht ihn mit dem Erstspracherwerb, fokussiert auf den frühen, natürlichen Zweitspracherwerb in bilingualen Kindergärten. Es werden Unterschiede in der Phonetik und Phonologie, Sprachperzeption und -produktion sowie der Einfluss des Transfers zwischen den Sprachsystemen analysiert.
Wie werden Variationen in der Zielsprache analysiert?
Das Kapitel zu Variationen in der Zielsprache untersucht nicht-zielgerechte Sprachproduktionen und deren Ursachen. Eine kontrastive Analyse von Deutsch und Englisch dient der Identifizierung potenzieller Variationen. Konkrete Beispiele für kontrastierende Laute (z.B. [w], /r/, interdentale Frikative, Vokale) werden detailliert analysiert.
Wie gestaltet sich der empirische Teil der Arbeit?
Der empirische Teil beschreibt das Forschungsdesign, die Methodik (Erhebungsdesign, Probanden, Durchführung und Gütekriterien) und die Ergebnisse der empirischen Studie. Die erhobenen Daten werden analysiert und im Kontext der theoretischen Überlegungen interpretiert, unter Verwendung der kontrastiven Fehleranalyse nach Wode (1988).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Zweitspracherwerb, Erstspracherwerb, Bilingualismus, Kindergärten, Phonetik, Phonologie, Lautproduktion, Sprachperzeption, Kontrastive Analyse, Deutsch, Englisch, Variationen, Fehleranalyse.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die Arbeit untersucht die Besonderheiten des Laut-Erwerbs bei Drei- bis Sechsjährigen in bilingualen Kindergärten und analysiert Variationen in der englischen Zweitsprache im Vergleich zum Erstspracherwerb.
- Arbeit zitieren
- Simone Fay (Autor:in), 2018, Englischlernen in bilingualen Kindergärten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925578