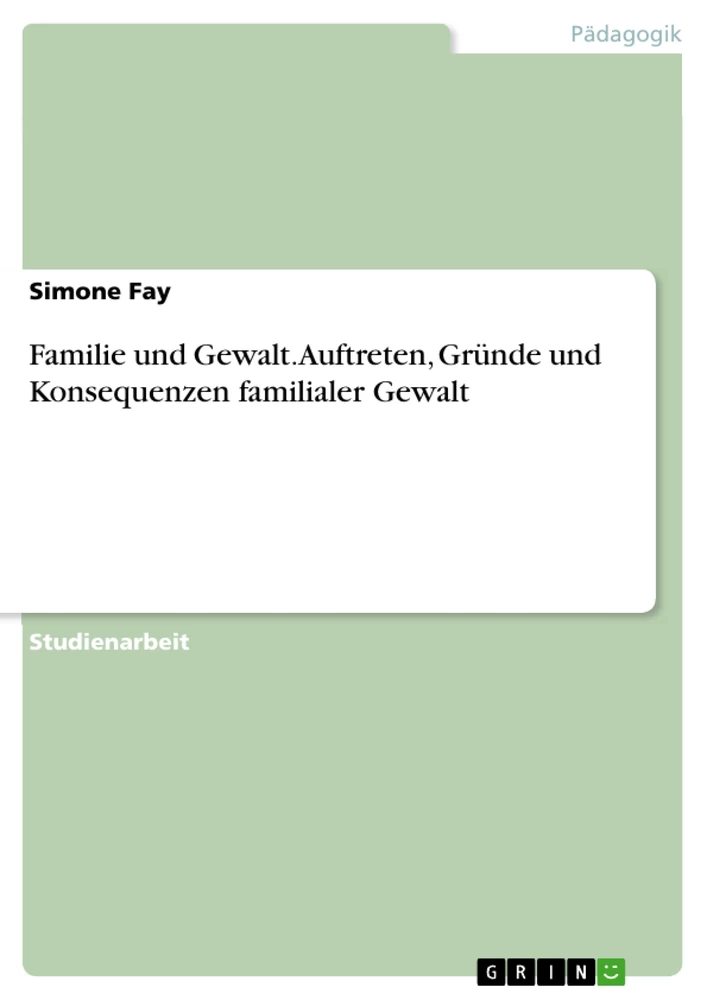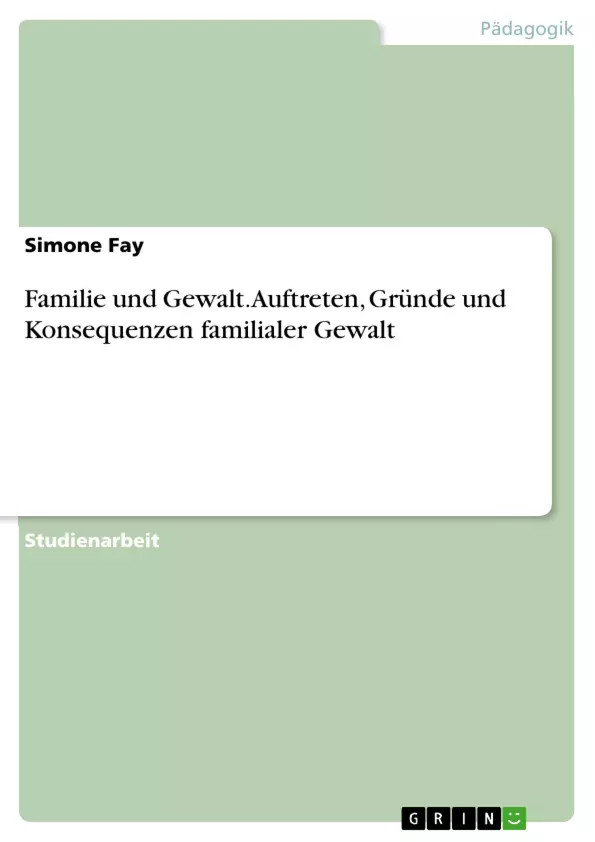Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik "Gewalt in der Familie". Zunächst soll Gewalt allgemein definiert und anschließend themenspezifisch differenziert werden. Ferner wird der Wandel der Gesellschaft bezüglich des Empfindens und der Legitimation von Gewalt dargelegt.
Im weiteren Verlauf werden die vorliegenden Datensätze, die dieser Ausarbeitung zugrunde liegen, analysiert. Dabei werden sowohl qualitative als auch quantitative Merkmale von Gewaltauftreten in Familien herausgestellt und zwischen Alter, Geschlecht und sozialem Milieu der Gewaltopfer unterschieden.
Hierauf werden mögliche ursächliche Momente sowie Konsequenzen für elterliche beziehungsweise familiale Gewalt beleuchtet. Abschließend folgt ein Fazit und die Modulanbindungen zur Diagnostik und Förderung im Schulkontext sowie dem integrierten Semesterpraktikum.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt - Eine Definition
- Allgemeines zur familialen Gewaltart
- Sensibilisierungsprozess der Gewaltwahrnehmung
- Auftreten elterlicher Gewalt in Familien
- Datensatz von 1999 - Fuchs et al. 2001
- Datensätze von 1998, 2005 und 2008 - Baier et al. 2009
- Gründe für Gewalt in der Familie
- Konsequenzen elterlicher Gewalt und/oder familiärer Umstände
- Fazit
- Modulanbindungen
- Pädagogische Beratung und Diagnostik
- Integriertes Semesterpraktikum (ISP)
- Literatur-/Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema "Gewalt in der Familie". Sie beleuchtet die Definition von Gewalt im Allgemeinen und im familialen Kontext, analysiert den Wandel der Gesellschaft hinsichtlich der Wahrnehmung und Legitimation von Gewalt und untersucht verschiedene Datensätze zu elterlicher Gewalt. Dabei werden die Ursachen und Folgen von Gewalt in Familien sowie die Konsequenzen für Kinder und Jugendliche beleuchtet. Abschließend werden Modulanbindungen zur Diagnostik und Förderung im Schulkontext und dem Integrierten Semesterpraktikum (ISP) vorgestellt.
- Definition und Abgrenzung von Gewalt im Allgemeinen und im familialen Kontext
- Sozialer Wandel in der Wahrnehmung und Legitimation von Gewalt
- Analyse von Datensätzen zum Auftreten elterlicher Gewalt
- Ursachen und Folgen von Gewalt in Familien
- Modulanbindungen zur Diagnostik und Förderung im Schulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik "Gewalt in der Familie" ein und erläutert die Relevanz des Themas für die Pädagogik. Sie stellt den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Im zweiten Kapitel wird der Begriff "Gewalt" allgemein definiert und anschließend auf die Besonderheiten familialer Gewalt eingegangen. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Sensibilisierungsprozess der Gewaltwahrnehmung in der Gesellschaft. Im vierten Kapitel werden Datensätze zum Auftreten elterlicher Gewalt in Familien analysiert, wobei die Unterschiede nach Alter, Geschlecht und sozialem Milieu der Gewaltopfer betrachtet werden. Das fünfte Kapitel beleuchtet mögliche Gründe für Gewalt in der Familie, während das sechste Kapitel die Konsequenzen elterlicher Gewalt und/oder familiärer Umstände auf Kinder und Jugendliche untersucht. Das siebte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und geht auf die Modulanbindungen zur Diagnostik und Förderung im Schulkontext sowie dem Integrierten Semesterpraktikum (ISP) ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themenbereiche der familialen Gewalt, ihre Definition und Abgrenzung, die Entwicklung der Wahrnehmung von Gewalt in der Gesellschaft, die Ursachen und Folgen elterlicher Gewalt, die Analyse von Datensätzen und die Modulanbindungen zur pädagogischen Beratung, Diagnostik und Förderung im Schulkontext. Weitere relevante Schlüsselwörter sind: Erziehungsmittel, Kinder und Jugendliche, soziale Interaktion, Sozialisation, Sensibilisierung, Empathie, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Gewalt im familialen Kontext definiert?
Gewalt in der Familie umfasst nicht nur körperliche Misshandlung, sondern auch psychische Gewalt, Vernachlässigung und die Anwendung von Gewalt als illegitimes Erziehungsmittel.
Welche Faktoren beeinflussen das Auftreten von elterlicher Gewalt?
Untersucht werden Einflüsse wie das soziale Milieu, das Alter und Geschlecht der Opfer sowie die eigene Sozialisationsgeschichte der Eltern.
Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gewalt gewandelt?
Es gibt einen fortschreitenden Sensibilisierungsprozess, durch den Verhaltensweisen, die früher als "normale Erziehung" galten, heute als Gewalt wahrgenommen und delegitimiert werden.
Was sind die Konsequenzen von Gewalt für Kinder?
Gewalt kann zu schweren Entwicklungsstörungen, psychischen Problemen und einer Beeinträchtigung der sozialen Interaktionsfähigkeit führen.
Welche Rolle spielt die Schule bei diesem Thema?
Die Schule ist ein wichtiger Ort für Diagnostik und Förderung, wo durch pädagogische Beratung und Prävention frühzeitig interveniert werden kann.
- Quote paper
- Simone Fay (Author), 2016, Familie und Gewalt. Auftreten, Gründe und Konsequenzen familialer Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925586