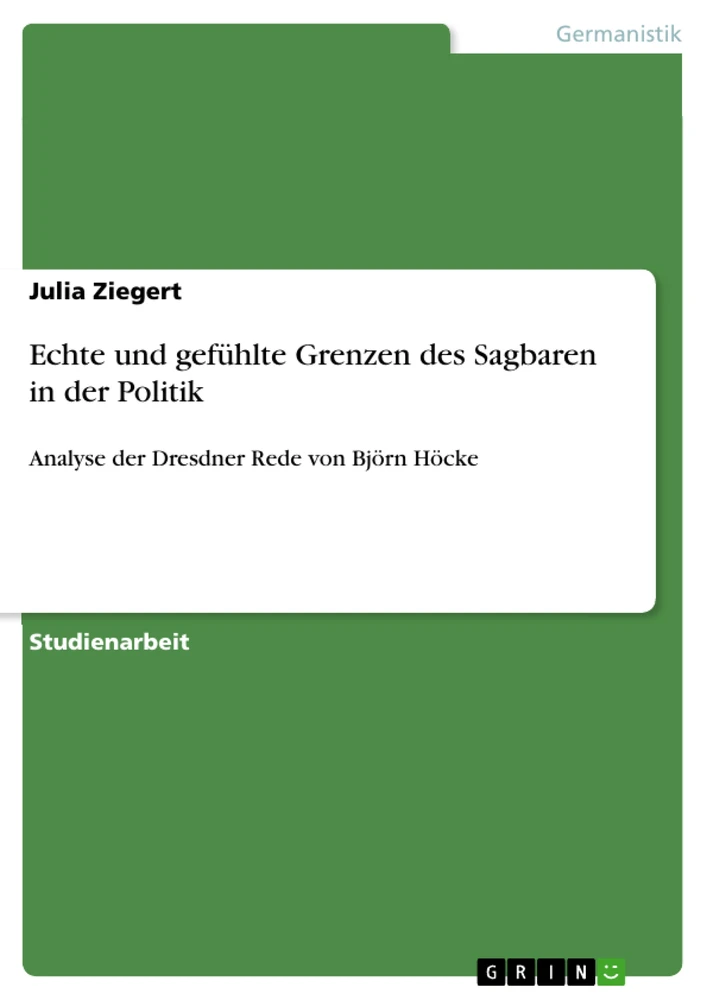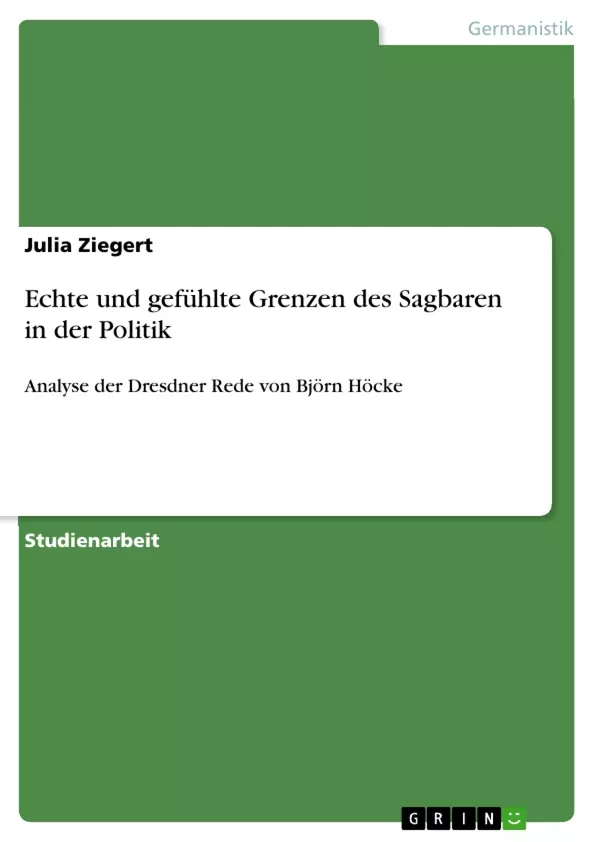Die seit mehreren Jahren, geführte Diskussion über die gefühlten und tatsächlichen Grenzen des Sagbaren verdeutlicht die herausragende Stellung von Sprache in der Gesellschaft. Dabei ist nicht nur ausschlaggebend, was gesagt wird, sondern auch wie. Denn dieses herausragende Kommunikationsmittel ist selten objektiv in der Information und ebenso selten ideologie-indifferent. Dabei ist der Fokus sowohl auf die Text-, als auch auf die Wortebene zu richten.
Die Arbeit gibt zunächst einen theoretischen Überblick über die Begrifflichkeiten der Öffentlichkeit und der Meinungsfreiheit und wird die politische Rede als Textform näher beleuchten. Besonderes Augenmerk wird im Anschluss auf die Analyse der Dresdner Rede des umstrittenen AfD-Politikers Björn Höcke aus dem Jahr 2017 und der dort verwendeten sprachlichen Strategien gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil
- Was man unter Öffentlichkeit versteht
- Was man unter Meinungsfreiheit versteht
- Zensur versus Restriktion
- Die politische Rede als Textform
- Hassrede
- Die Dresdner Rede von Björn Höcke
- Einordnung der AfD
- Anlass, Redner, Adressaten und Situation der Rede
- Inhaltlicher Aufbau der Rede
- Populistische Rhetorik und Grenzen des Sagbaren am Beispiel der Dresdner Rede
- Die Argumentationsmuster in Höckes Rede
- Diffamierung politischer Gegner / eigene Erhöhung
- Schlagwörter und Kampfvokabeln
- Höckes Bewertung von historischen Ereignissen
- Schlussbetrachtung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Grenzen des Sagbaren in politischen Reden am Beispiel der Dresdner Rede von Björn Höcke aus dem Jahr 2017. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen der politischen Kommunikation, der Meinungsfreiheit und der Zensur als auch die spezifischen sprachlichen Strategien in Höckes Rede analysiert.
- Die Definition von Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit im Kontext politischer Kommunikation
- Die Rolle der politischen Rede als Textform und ihre Funktion im öffentlichen Diskurs
- Die Analyse von populistischen Rhetorik-Strategien und deren Einfluss auf die Grenzen des Sagbaren
- Die Identifizierung von Argumentationsmustern, Schlagwörtern und Kampfvokabeln in der Dresdner Rede
- Die Bewertung von historischen Ereignissen in Höckes Rede und deren Auswirkungen auf die aktuelle politische Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und gibt einen Überblick über die aktuelle Debatte um die Grenzen des Sagbaren in der politischen Kommunikation. Es wird auf verschiedene Beispiele aus jüngerer Zeit eingegangen, die die Relevanz des Themas verdeutlichen.
- Der Theorieteil beleuchtet die Begrifflichkeiten von Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit und stellt die politische Rede als Textform in den Kontext der politischen Kommunikation. Dabei wird auch die Frage nach Zensur und Restriktion im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit untersucht.
- Das Kapitel „Die Dresdner Rede von Björn Höcke“ analysiert die Rede im Kontext der Einordnung der AfD als Partei und untersucht die Situation, den Anlass, den Redner und die Adressaten der Rede.
- Das Kapitel „Populistische Rhetorik und Grenzen des Sagbaren am Beispiel der Dresdner Rede“ befasst sich mit den sprachlichen Strategien, die Höcke in seiner Rede einsetzt. Es werden Argumentationsmuster, Diffamierungen, Schlagwörter und Kampfvokabeln sowie die Bewertung von historischen Ereignissen analysiert.
Schlüsselwörter
Politische Kommunikation, Meinungsfreiheit, Zensur, Restriktion, politische Rede, Populismus, Rhetorik, Argumentationsmuster, Schlagwörter, Kampfvokabeln, Geschichte, AfD, Björn Höcke, Dresdner Rede.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter den "Grenzen des Sagbaren"?
Dies beschreibt die gesellschaftlichen und rechtlichen Normen, die festlegen, welche Äußerungen im öffentlichen Diskurs als akzeptabel gelten und welche als Tabubruch wahrgenommen werden.
Welche sprachlichen Strategien nutzt Björn Höcke in seiner Dresdner Rede?
Höcke nutzt Strategien der Provokation, die Umdeutung historischer Begriffe (z. B. "Erinnerungskultur"), Diffamierung politischer Gegner und populistische Rhetorik zur Mobilisierung seiner Anhänger.
Was ist der Unterschied zwischen Zensur und Restriktion?
Zensur ist die staatliche Vorabkontrolle von Inhalten, während Restriktionen (wie Gesetze gegen Volksverhetzung) nachträgliche Grenzen der Meinungsfreiheit zum Schutz anderer Rechtsgüter darstellen.
Wie wird "Hassrede" (Hate Speech) in der Arbeit definiert?
Hassrede umfasst Ausdrucksweisen, die Hass gegen Gruppen aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Religion oder politischer Gesinnung verbreiten, anstacheln oder rechtfertigen.
Welche Rolle spielt die politische Rede als Textform?
Die politische Rede dient nicht nur der Information, sondern ist ein persuasives Instrument zur Durchsetzung von Ideologien und zur emotionalen Bindung des Publikums.
- Arbeit zitieren
- Julia Ziegert (Autor:in), 2020, Echte und gefühlte Grenzen des Sagbaren in der Politik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925709