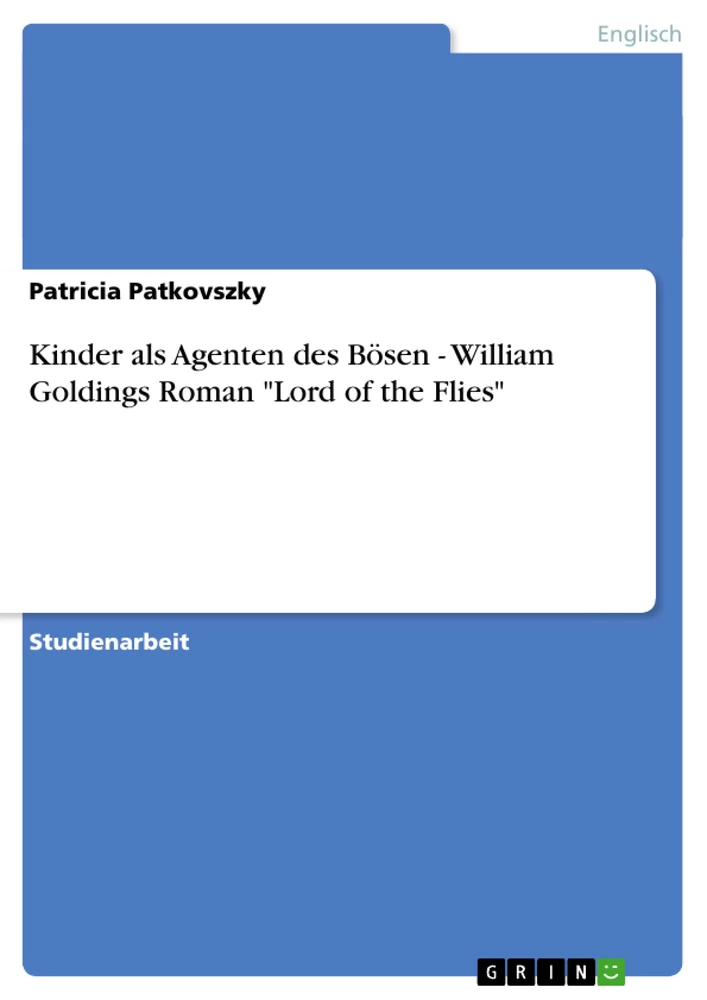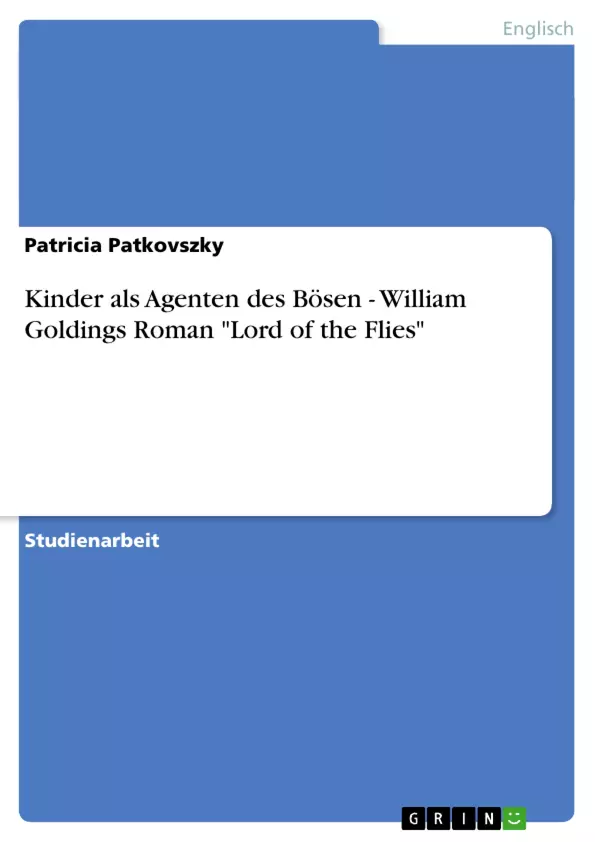Der Roman Lord of the Flies (1954) ist wohl das bekannteste und erfolgreichste Buch
William Goldings. Das bis heute andauernde Interesse an dieser Robinsonade lässt sich sicherlich nicht nur darauf zurückführen, dass das Werk aus literaturkritischerc Sicht von Interesse ist, sondern auch darauf, dass sich in ihm soziologische, psychologische und theologische Aspekte zu einem Ganzen verdichten. Wie in vielen seiner
späteren Romane benutzt Golding auch hier Sprache und Bilder um das Erschreckende, Mysteriöse, Nicht-Rationale in der menschlichen Natur aufzuzeichnen. Dabei fasziniert ihn besonders die Vorstellung des Bösen als inhärenten Bestandteils des menschlichen Charakters.
Wie bei vielen anderen Menschen, ist die Überzeugung, dass Vernunft, Bildung und Zivilisation sichere Barrieren gegen das Böse sind, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei Golding zerstört. An die Möglichkeit, dass ein Gesellschaftssystem den Menschen moralisch perfektionieren kann, glaubt er nicht mehr. Viel eher kommt er zu der Überzeugung, dass das Böse nicht durch äußere Faktoren wie
Umwelt, Erziehung oder Gesellschaft hervorgerufen wird, sondern "the only enemy of man is inside himself".
Diese Idee vom Bösen als Wesenszug des Menschen, als treibende Kraft für unser Tun und Handeln, als Auslöser für Rassismus, Gewalt, und Krieg zwischen den Nationen, Geschlechtern und gegen Andersdenkende wird zu einem andauernden Konfliktthema in der Nachkriegsliteratur Englands.
Vor diesem Hintergrund von Krieg und atomarer Bedrohung entsteht 1954 der Roman "Lord of the Flies".
Es ist die Geschichte einer Gruppe von englischen Jungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel stranden, dort versuchen eine
Gemeinschaft aufzubauen, die aber letztendlich in wildem Chaos endet. Herausgelöst aus dem Alltag, isoliert von Zeit und Raum, ohne Kontrolle durch ihre Eltern oder Lehrer, offenbart sich hier das innerste Wesen dieser Kinder mit all ihrer zerstörerischen
Kraft und all ihren Tendenzen zu Grausamkeiten und Gewalt. Der Roman zeigt jedoch nicht nur, was aus Kindern, die sich der Zivilisation entledigt haben, werden kann, es ist vor allem eine Allegorie auf den Kampf des Menschen gegen sein eigenes
inneres Böses.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff des Bösen
- Das Böse in William Goldings Roman Lord of the Flies
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert William Goldings Roman „Lord of the Flies" und befasst sich mit der Darstellung des Bösen im Werk. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit die Kinder im Roman als Agenten des Bösen betrachtet werden können, welche Rolle die menschliche Natur und die Zivilisation in der Entwicklung von Gewalt und Grausamkeit spielen und wie Golding die Vorstellung von der Erbsünde im Kontext seiner Geschichte präsentiert.
- Darstellung des Bösen in „Lord of the Flies"
- Bedeutung der menschlichen Natur und der Zivilisation
- Goldings Vorstellung von der Erbsünde
- Psychologische, soziologische und theologische Aspekte des Romans
- Interpretation von Gewalt und Grausamkeit in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den Roman „Lord of the Flies“ und dessen Bedeutung im Kontext der englischen Nachkriegsliteratur vor. Es werden wichtige Einflussfaktoren wie Kriegserfahrungen und die zunehmende Skepsis gegenüber den Idealen der Aufklärung erläutert. Darüber hinaus wird Goldings Sichtweise auf das Böse als innewohnenden Bestandteil der menschlichen Natur beleuchtet.
- Zum Begriff des Bösen: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Böse“ im Kontext der Literatur und Philosophie. Es werden unterschiedliche Definitionen und Theorien des Bösen diskutiert und der Fokus auf Goldings Interpretation des Bösen als treibende Kraft in der menschlichen Natur gelegt.
- Das Böse in William Goldings Roman Lord of the Flies: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Bösen im Roman anhand der verschiedenen Charaktere. Es wird analysiert, wie die Kinder in der Isolation der Insel ihre Zivilisation und Moral verlieren und sich in Richtung Grausamkeit und Gewalt entwickeln.
Schlüsselwörter
„Lord of the Flies", William Golding, Böse, menschliche Natur, Zivilisation, Erbsünde, Gewalt, Grausamkeit, Krieg, Nachkriegsliteratur, Robinsonade, primitive Gesellschaft, psychologische Theorie, soziale Allegorie, politische Allegorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema in William Goldings „Lord of the Flies“?
Das zentrale Thema ist das inhärente Böse in der menschlichen Natur und das Scheitern von Zivilisation und Vernunft in einer isolierten Umgebung.
Warum wählte Golding Kinder als Protagonisten?
Um zu zeigen, dass Grausamkeit nicht erst durch Erziehung oder Umwelt entsteht, sondern laut Golding ein Wesenszug des Menschen ist, der sich offenbart, wenn äußere Kontrollen wegfallen.
Welchen Einfluss hatte der Zweite Weltkrieg auf den Roman?
Goldings Kriegserfahrungen zerstörten seinen Glauben an den moralischen Fortschritt durch Bildung. Er kam zu der Überzeugung: „The only enemy of man is inside himself“.
Ist der Roman eine Allegorie?
Ja, er kann als politische, soziologische und theologische Allegorie gelesen werden – insbesondere auf den Kampf des Menschen gegen sein eigenes inneres Böses (Erbsünde).
Was symbolisiert das Ende der Gemeinschaft auf der Insel?
Das Abgleiten in wildes Chaos und Gewalt symbolisiert den Sieg primitiver Triebe über die dünne Decke der Zivilisation.
- Arbeit zitieren
- Patricia Patkovszky (Autor:in), 2007, Kinder als Agenten des Bösen - William Goldings Roman "Lord of the Flies", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92710