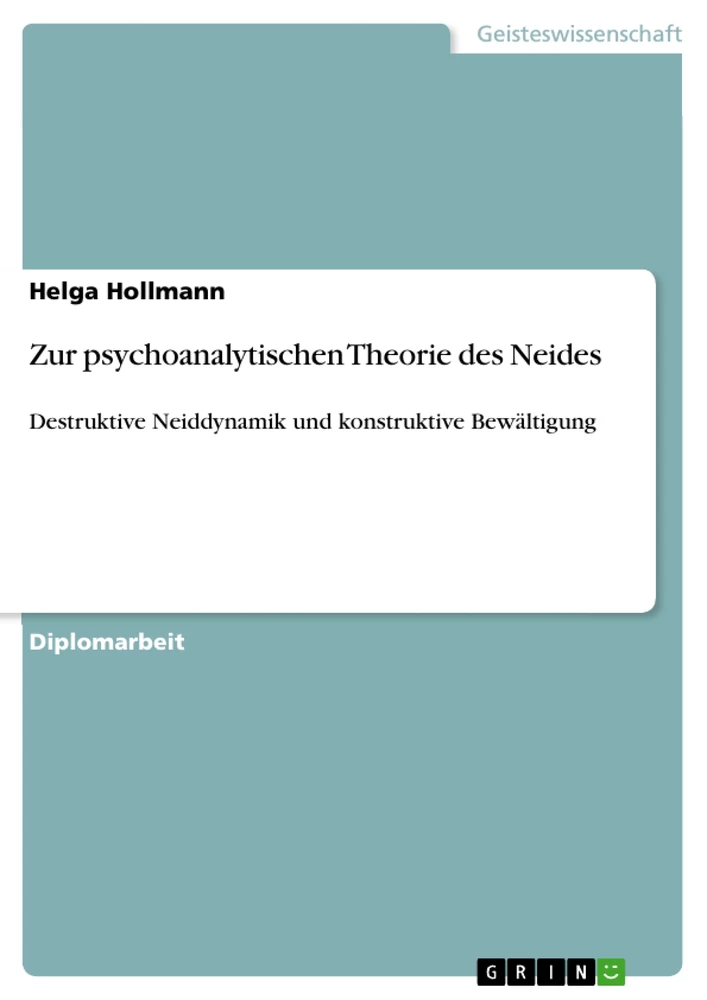Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Neiddynamik, die zunächst aus historischer Sicht (Philosophie, Religion, Kunst) in horizontaler und vertikaler Weise betrachtet wird. Es folgen die psychoanalytischen Theorien zum Neid von Sigmund Freud und Melanie Klein sowie eine Betrachtung der inhärenten destruktiven Abwehrformationen. Neben psychonanalytischen Grundannahmen werden die Bestimmungsmerkmale des Neides definiert und beschrieben (Subjekt, Objekt, Gegenstand und Ziel des Neides; Triebe; Emotionen und Affekte; Topik; Struktur und Entwicklung). Darauf aufbauend erfolgt eine detaillierte Darstellung der destruktiven selbst- und fremdschädigenden Auswirkungen der Neidabwehr sowie der Möglichkeiten einer konstruktiven Neidbewältigung. Die theoretische Abhandlung zum Neid entwickelt sich in die Richtung einer anwendungsbezogenen therapeutischen und pädagogischen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Phänomenologie des Neides
- 3. Definition des Begriffes „Neid“ – Überschneidungen, Abgrenzung, Polarisation –
- 4. Zur psychoanalytischen Theorie des Neides von Sigmund Freud und Melanie Klein
- 4.1. Die Bedeutung des Neides in der klassischen psychoanalytischen Tradition von Sigmund Freud
- 4.2. Die Bedeutung des Neides in der Theorie von Melanie Klein
- 4.3. Kritische Betrachtung der den Theorien inhärenten Destruktivität unter Berücksichtigung spezifischer Abwehrformationen
- 5. Psychoanalytische Grundannahmen und Bestimmungsmerkmale des Neides
- 5.1. Subjekt, Objekt, Gegenstand und Ziel des Neides
- 5.2. Der Neid im Kontext der Triebe
- 5.3. Der Neid im Kontext der Emotionen und Affekte
- 5.4. Zum topischen Aspekt des Neides
- 5.5. Zum strukturellen Aspekt des Neides
- 5.6. Zur Genetik und Wirksamkeit des Neides in verschiedenen Entwicklungsphasen
- 6. Zur destruktiven Psychodynamik des Neides
- 6.1. Destruktive Dynamik der Neidabwehr
- 6.2. Die Abwehr des Neides in der kleinianischen Tradition
- 6.3. Selbstschädigende Neiddynamik depressiver Persönlichkeiten
- 6.4. Fremdschädigende Neiddynamik
- 6.5. Fallbeispiel zum feindseligen Neid
- 6.6. Psychodynamische Merkmale und interpersonelle Beziehungsmuster
- 6.7. Destruktive Neiddynamik innerhalb einer psychoanalytischen Behandlung
- 7. Zur konstruktiven Neidbewältigung
- 7.1. Zur optimalen Affektregulierung im Kontext der horizontalen und vertikalen Neidebenen
- 7.2. Neidbewältigung innerhalb einer psychoanalytischen Behandlung oder als therapeutisches Ziel
- 7.3. Reife Abwehr des Neides
- 7.4. Der Neid als nützlicher Entwicklungsfaktor
- 7.5. Zur unbewussten oder bewussten Situationsdeutung des Neides
- 7.6. Konstruktive Neidbewältigung im Rahmen individueller Entwicklungsmöglichkeiten und ausgewählter externer Modalitäten
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die psychoanalytische Theorie des Neides, mit dem Ziel, die destruktive Neiddynamik zu verstehen und Wege zu einer konstruktiven Bewältigung aufzuzeigen. Die Arbeit nutzt die Psychoanalyse als theoretisches Instrumentarium, um unbewusste Prozesse im Kontext des Neides zu beleuchten.
- Destruktive Dynamik des Neides und dessen Abwehrmechanismen
- Psychoanalytische Theorien des Neides bei Freud und Klein
- Konstruktive Bewältigung von Neidgefühlen
- Neid als Entwicklungsfaktor
- Interpersonelle Aspekte des Neides
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit entstand aus der Faszination für das Neidphänomen, ausgelöst durch einen Radiovortrag. Die Autorin hinterfragt ihren eigenen Umgang mit Neid und stellt die Frage nach der Kompetenz, dieses komplexe Thema zu bearbeiten. Sie beschreibt eine anfängliche ambivalente Haltung, geprägt von Interesse und Abwehr, die auch in der psychoanalytischen Therapie zum Tragen kommt. Besonderes Augenmerk liegt auf der destruktiven Kraft des Neides und dem Potential für eine konstruktive Bewältigung. Die Psychoanalyse wird als geeignetes Instrumentarium zur Erforschung der unbewussten Dynamik des Neides vorgestellt, wobei der Fokus auf subjektiven Strukturen des Individuums liegt.
2. Zur Phänomenologie des Neides: Dieses Kapitel liefert eine phänomenologische Betrachtung des Neides, basierend auf der Komplexität und dem historischen Kontext des Themas. Es werden die Werke von Schoeck (1966) und de la Mora (1987) kritisch betrachtet, da deren soziologisch und politisch geprägte Ansätze den psychologischen Aspekt des Neides nicht ausreichend beleuchten. Trotz der Kritik wird der historische Reichtum von Schoecks Werk hervorgehoben.
3. Definition des Begriffes „Neid“: Das Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs "Neid", wobei Überschneidungen mit ähnlichen Konzepten, Abgrenzungen und Polarisierungen innerhalb des Kontexts beleuchtet werden. Es bildet die Grundlage für die anschließende Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Theorien.
4. Zur psychoanalytischen Theorie des Neides von Sigmund Freud und Melanie Klein: Dieses Kapitel präsentiert eine knappe Darstellung der psychoanalytischen Theorien von Freud und Klein zum Thema Neid. Es bildet die theoretische Grundlage für die anschließende Analyse der destruktiven und konstruktiven Aspekte des Neides. Die jeweiligen Konzepte werden verglichen und kritisch evaluiert.
5. Psychoanalytische Grundannahmen und Bestimmungsmerkmale des Neides: Das Kapitel erläutert psychoanalytische Grundannahmen, die für das Verständnis von Neid relevant sind. Es beleuchtet Aspekte wie Subjekt, Objekt, Gegenstand und Ziel des Neides, den Zusammenhang mit Trieben und Emotionen, sowie topische und strukturelle Aspekte. Die Entwicklung und Wirksamkeit des Neides in verschiedenen Entwicklungsphasen werden ebenfalls thematisiert.
6. Zur destruktiven Psychodynamik des Neides: Dieser zentrale Abschnitt analysiert die destruktive Dynamik des Neides und dessen Abwehrmechanismen, sowohl innerhalb der kleinianischen Tradition als auch im Kontext depressiver Persönlichkeiten. Er untersucht die Auswirkungen auf den Neider selbst (Selbstschädigung) und auf andere (Fremdschädigung), untermauert durch ein Fallbeispiel. Interpersonelle Beziehungsmuster und die Dynamik in einer psychoanalytischen Behandlung werden ebenfalls beleuchtet.
7. Zur konstruktiven Neidbewältigung: Im Gegenzug zum vorherigen Kapitel konzentriert sich dieses auf die konstruktiven Möglichkeiten des Umgangs mit Neid. Es werden Strategien zur optimalen Affektregulierung, die Rolle des Neides in einer psychoanalytischen Therapie und die Entwicklung reifer Abwehrmechanismen untersucht. Der Neid wird hier als potenzieller Entwicklungsfaktor betrachtet, und die bewusste und unbewusste Situationsdeutung des Neides wird thematisiert.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Psychoanalytische Betrachtung des Neides
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die psychoanalytische Theorie des Neides. Ihr Ziel ist es, die destruktive Dynamik des Neides zu verstehen und Wege zu einer konstruktiven Bewältigung aufzuzeigen. Dabei wird die Psychoanalyse als theoretisches Instrumentarium genutzt, um unbewusste Prozesse im Kontext des Neides zu beleuchten.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stützt sich maßgeblich auf die psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freud und Melanie Klein zum Thema Neid. Diese Theorien werden verglichen, kritisch evaluiert und als Grundlage für die Analyse der destruktiven und konstruktiven Aspekte des Neides verwendet.
Wie wird der Neid in der Arbeit definiert?
Die Arbeit liefert eine präzise Definition des Begriffs "Neid", wobei Überschneidungen mit ähnlichen Konzepten, Abgrenzungen und Polarisierungen innerhalb des Kontexts beleuchtet werden. Diese Definition bildet die Grundlage für die Auseinandersetzung mit den psychoanalytischen Theorien.
Welche Aspekte der destruktiven Neiddynamik werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die destruktive Dynamik des Neides und dessen Abwehrmechanismen, sowohl in der kleinianischen Tradition als auch im Kontext depressiver Persönlichkeiten. Sie untersucht selbstschädigende und fremd schädigende Auswirkungen, untermauert durch ein Fallbeispiel. Interpersonelle Beziehungsmuster und die Dynamik in einer psychoanalytischen Behandlung werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die konstruktive Neidbewältigung betrachtet?
Die Arbeit untersucht Strategien zur optimalen Affektregulierung, die Rolle des Neides in einer psychoanalytischen Therapie und die Entwicklung reifer Abwehrmechanismen. Der Neid wird als potenzieller Entwicklungsfaktor betrachtet, und die bewusste und unbewusste Situationsdeutung des Neides wird thematisiert.
Welche weiteren Themen werden in der Arbeit behandelt?
Neben den zentralen Aspekten der destruktiven und konstruktiven Neiddynamik befasst sich die Arbeit auch mit der Phänomenologie des Neides, psychoanalytischen Grundannahmen und Bestimmungsmerkmalen des Neides (Subjekt, Objekt, Gegenstand, Ziel, Triebe, Emotionen, topische und strukturelle Aspekte, Entwicklungsphasen), und bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt die Psychoanalyse als theoretisches Instrumentarium, um unbewusste Prozesse im Kontext des Neides zu beleuchten. Der Fokus liegt auf subjektiven Strukturen des Individuums.
Welche Werke werden kritisch betrachtet?
Die Arbeit betrachtet kritisch die Werke von Schoeck (1966) und de la Mora (1987). Ihre soziologisch und politisch geprägten Ansätze werden als unzureichend für die Beleuchtung des psychologischen Aspekts des Neides angesehen.
- Quote paper
- Helga Hollmann (Author), 2006, Zur psychoanalytischen Theorie des Neides, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92728