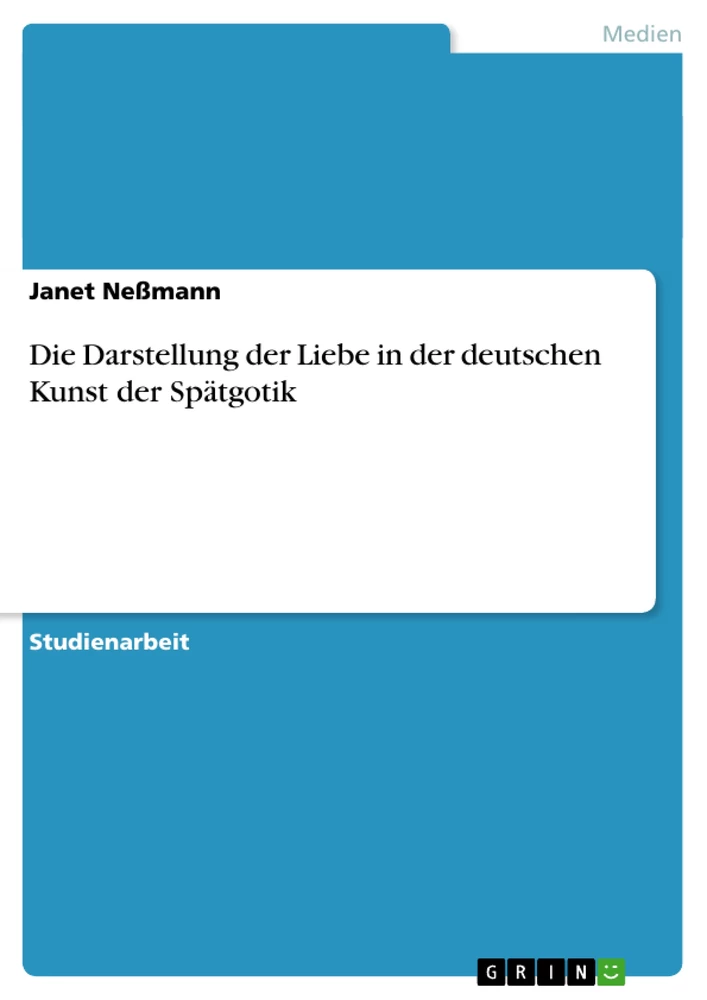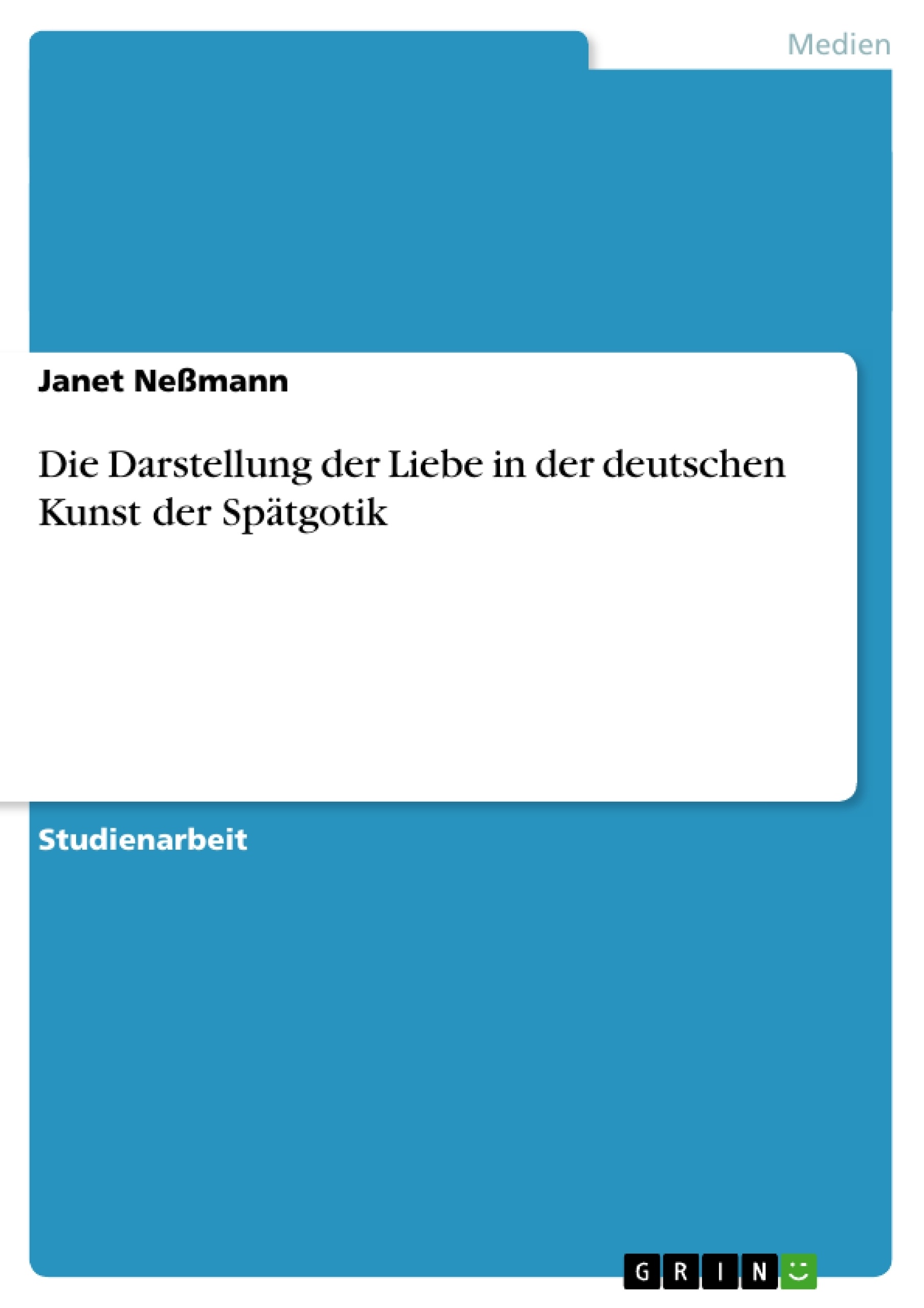Bei meinen Recherchen zu dem mit Die Darstellung der Liebe in der
deutschen Kunst der Spätgotik betitelten Thema meiner Hausarbeit,
musste ich feststellen, dass die Anzahl dazu existierender Tafelbilder sehr
gering ist. Sie sind einzureihen in das Fünftel, das sich nicht mit dem
Thema der Heilsgeschichte oder der Bibel beschäftigte. (1)
Dem ist noch hinzuzufügen, dass der Bestand an gotischer Tafelmalerei
„nach den Schätzungen der Experten zwischen 3 % und 10 % des
ursprünglichen Bestandes“ (2) ausmacht.
Ausschlaggebend hierfür war die hohe Brandlastigkeit der mittelalterlichen
Städte aufgrund des dominierenden Baumaterials Holz. Ihr Übriges
erledigte die Reformationszeit: Sakrale Tafelbilder, die dem Feuer bis
dahin entkommen waren, fielen nun den Bilderstürmen zum Opfer. (3)
Umso glücklicher für die Kunstgeschichte ist der Erhalt dieser knappen
zwanzig Prozent. So kann dennoch ein Einblick in die Malerei der
gotischen Zeit gewährt werden.
Der Ursprung, die Begrifflichkeit und die unterschiedlichen Themen der
Gotik sollen auch den Anfang meiner Arbeit markieren. Wichtig wird
zudem sein, wesentliche Voraussetzungen für die Liebesthematik
aufzuzeigen, wobei die Minnedichtung, das Minnekästchen und die
Tapisserie für mich von Bedeutung sein werden.
Schließlich soll die Tafelmalerei in den Vordergrund rücken, wobei der
Inhalt meines Referats – Der Liebeszauber – dabei den Ausgangspunkt
bilden wird. Der Grund hierfür ist, dass ich diesen Volksbrauch als
Grundlage der Entwicklung einer Liebe heranziehen möchte. Es sollen
insgesamt drei verschiedene Etappen im Leben eines Paares aufgezeigt
werden. Der weitere Verlauf einer Beziehung nach dem Zueinanderfinden
soll anhand des Gothaer Liebespaares und des Brautpaars im Garten
belegt werden.
Dass sich die Paare am Tag ihrer Hochzeit bereits mit ihrem Tod
auseinander setzten, soll zu guter letzt behandelt werden. Die Rückseite
des Tafelbildes Brautpaar im Garten, das sogenannte Totenpaar, soll die
bildliche Grundlage dafür darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gotische Kunst – Ursprung, Themen und Innovationen
- 3. Minnekästchen und Bildteppiche - zwei Ursprünge der Darstellungen der Liebe in der Kunst des Mittelalters
- 3.1 Das Minnekästchen
- 3.2 Der Bildteppich
- 4. Die Darstellung verschiedener Phasen der Liebe in der Tafelmalerei
- 4.1 Das Entflammen der Liebe
- 4.2 Das tiefe Gefühl der Liebe im Augenblick des Zusammenseins
- 4.3 Die Unendlichkeit der Liebe bis in den Tod
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellung der Liebe in der deutschen Kunst der Spätgotik. Aufgrund der geringen Anzahl erhaltener Tafelbilder fokussiert die Arbeit auf die vorhandenen Beispiele und deren Kontext. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Darstellung von Liebe in der Kunst, ausgehend von ihren Ursprüngen in der Minnedichtung und anderen Medien.
- Entwicklung der Darstellung von Liebe in der spätgotischen Kunst
- Einfluss der Minnedichtung und anderer Medien auf die Bildsprache
- Analyse ausgewählter Tafelbilder und deren ikonografische Bedeutung
- Veränderung der künstlerischen Betrachtungsweise vom sakralen zum profanen
- Die Rolle des Tafelbildes als Medium für private Andacht und Liebesdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der geringen Anzahl erhaltener Tafelbilder mit dem Thema Liebe in der deutschen Spätgotik dar. Sie begründet diese Knappheit mit den historischen Gegebenheiten wie Bränden und Bilderstürmen der Reformation. Trotzdem betont die Einleitung die Bedeutung der wenigen erhaltenen Werke für einen Einblick in die spätgotische Malerei und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von den Ursprüngen der Gotik über die Minnedichtung und die Entstehung des Tafelbildes bis hin zur Analyse von ausgewählten Beispielen der Liebesdarstellung führt.
2. Die gotische Kunst – Ursprung, Themen und Innovationen: Dieses Kapitel behandelt die Ursprünge und Entwicklung der Gotik in Europa, beginnend in Frankreich und ihrer späteren Ausbreitung in Deutschland. Es beleuchtet die Ablehnung der Gotik in der Renaissance und deren spätere Rehabilitierung in der Romantik. Der Fokus liegt auf der deutschen Spätgotik (ca. 1360-1525) und ihrer primär kirchlichen Ausrichtung. Das Kapitel beschreibt die allmähliche Hinwendung zu profanen Sujets, insbesondere dem Thema Liebe, im späten 15. Jahrhundert, als die Kunst neben religiösen Aspekten auch die "Erfreung des Auges und die Umschmeichelung der Sinne" zum Ziel hatte. Beispiele wie der "Liebeszauber" und das "Gothaer Liebespaar" veranschaulichen diesen Wandel.
3. Minnekästchen und Bildteppiche - zwei Ursprünge der Darstellungen der Liebe in der Kunst des Mittelalters: Dieses Kapitel untersucht Minnekästchen und Bildteppiche als frühe Manifestationen der Liebesdarstellung in der mittelalterlichen Kunst. Es analysiert die ikonografischen Elemente und die Rolle dieser Artefakte im Kontext der Minnelyrik und des gesellschaftlichen Lebens. Die Kapitelteile beschreiben die spezifischen Merkmale und die Bedeutung der Minnekästchen und der Bildteppiche als Vorläufer der späteren Liebesdarstellungen in der Tafelmalerei, die im darauffolgenden Kapitel detaillierter behandelt werden.
4. Die Darstellung verschiedener Phasen der Liebe in der Tafelmalerei: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung verschiedener Phasen der Liebe in der spätgotischen Tafelmalerei. Es untersucht ausgewählte Beispiele, die verschiedene Stadien der Liebesbeziehung illustrieren: vom ersten "Entflammen" über das intensive "Zusammensein" bis hin zur "Unendlichkeit der Liebe bis in den Tod". Die Analyse dieser Bilder geht auf ihre ikonografischen Besonderheiten und ihre Symbolik ein, um die spezifische Darstellung der Liebe in der spätgotischen Kunst zu beleuchten und deren Entwicklung innerhalb der jeweiligen Etappe zu zeigen. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der Tafelmalerei für die private Andacht und die Darstellung der menschlichen Emotionen im Kontext des sich verändernden Weltbildes.
Schlüsselwörter
Spätgotik, deutsche Kunst, Liebesdarstellung, Tafelmalerei, Minnedichtung, Minnekästchen, Bildteppich, Ikonografie, Liebeszauber, Gothaer Liebespaar, religiöse Kunst, profane Kunst, Wandel der Kunstauffassung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Darstellung der Liebe in der deutschen Spätgotik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Darstellung der Liebe in der deutschen Kunst der Spätgotik. Aufgrund der geringen Anzahl erhaltener Tafelbilder konzentriert sie sich auf vorhandene Beispiele und ihren Kontext. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Liebesdarstellung in der Kunst, ausgehend von ihren Ursprüngen in der Minnedichtung und anderen Medien.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die Entwicklung der Darstellung von Liebe in der spätgotischen Kunst, den Einfluss der Minnedichtung und anderer Medien auf die Bildsprache, die Analyse ausgewählter Tafelbilder und deren ikonografische Bedeutung, die Veränderung der künstlerischen Betrachtungsweise vom Sakralen zum Profanen und die Rolle des Tafelbildes als Medium für private Andacht und Liebesdarstellung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel über die gotische Kunst (Ursprünge, Themen und Innovationen), ein Kapitel über Minnekästchen und Bildteppiche als frühe Manifestationen der Liebesdarstellung, ein Kapitel über die Darstellung verschiedener Phasen der Liebe in der Tafelmalerei und ein Resümee.
Was wird im Kapitel über die gotische Kunst behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Ursprünge und Entwicklung der Gotik in Europa, ihre Ausbreitung in Deutschland, die Ablehnung in der Renaissance und spätere Rehabilitierung in der Romantik. Der Fokus liegt auf der deutschen Spätgotik (ca. 1360-1525) und ihrer allmählichen Hinwendung zu profanen Sujets, insbesondere dem Thema Liebe, im späten 15. Jahrhundert.
Was wird in den Kapiteln über Minnekästchen und Bildteppiche behandelt?
Diese Kapitel untersuchen Minnekästchen und Bildteppiche als frühe Manifestationen der Liebesdarstellung. Es werden die ikonografischen Elemente und die Rolle dieser Artefakte im Kontext der Minnelyrik und des gesellschaftlichen Lebens analysiert. Sie werden als Vorläufer der späteren Liebesdarstellungen in der Tafelmalerei betrachtet.
Wie werden verschiedene Phasen der Liebe in der Tafelmalerei dargestellt?
Das Kapitel analysiert ausgewählte Tafelbilder, die verschiedene Stadien der Liebesbeziehung illustrieren: vom ersten Entflammen über das intensive Zusammensein bis hin zur Unendlichkeit der Liebe bis in den Tod. Die Analyse geht auf ikonografische Besonderheiten und Symbolik ein.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Spätgotik, deutsche Kunst, Liebesdarstellung, Tafelmalerei, Minnedichtung, Minnekästchen, Bildteppich, Ikonografie, Liebeszauber, Gothaer Liebespaar, religiöse Kunst, profane Kunst, Wandel der Kunstauffassung.
Warum ist die Anzahl erhaltener Tafelbilder zum Thema Liebe begrenzt?
Die Einleitung erklärt die geringe Anzahl erhaltener Tafelbilder mit dem Thema Liebe durch historische Gegebenheiten wie Brände und Bilderstürme der Reformation.
Welche Bedeutung haben die wenigen erhaltenen Werke?
Trotz der geringen Anzahl erhaltener Werke betont die Arbeit deren Bedeutung für einen Einblick in die spätgotische Malerei und die Darstellung der Liebe in dieser Epoche.
- Citar trabajo
- Janet Neßmann (Autor), 2005, Die Darstellung der Liebe in der deutschen Kunst der Spätgotik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92782