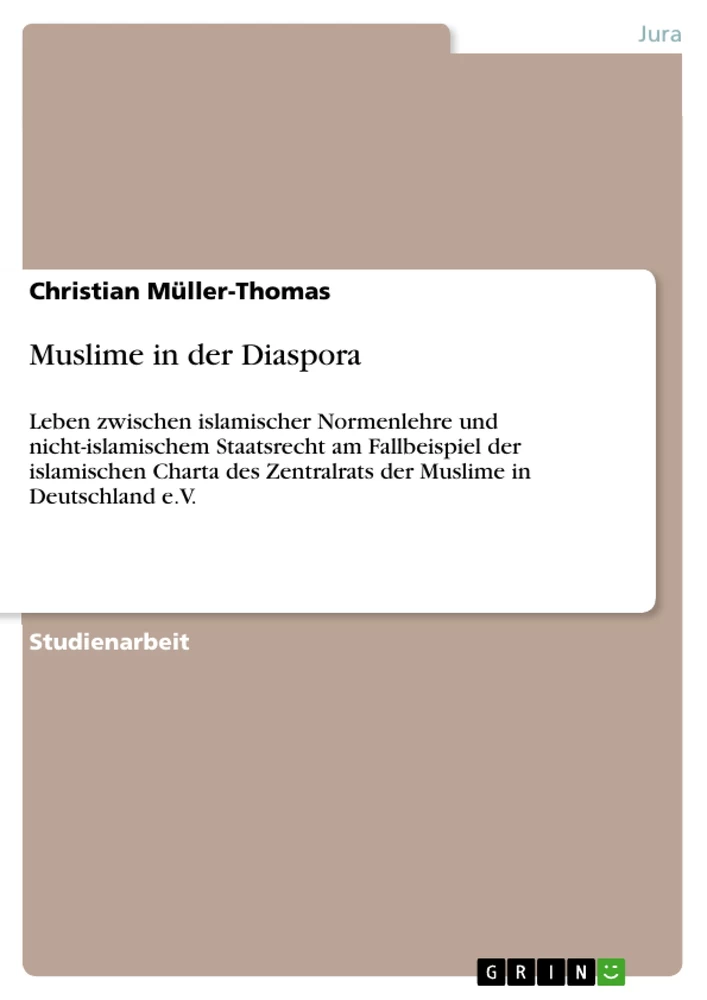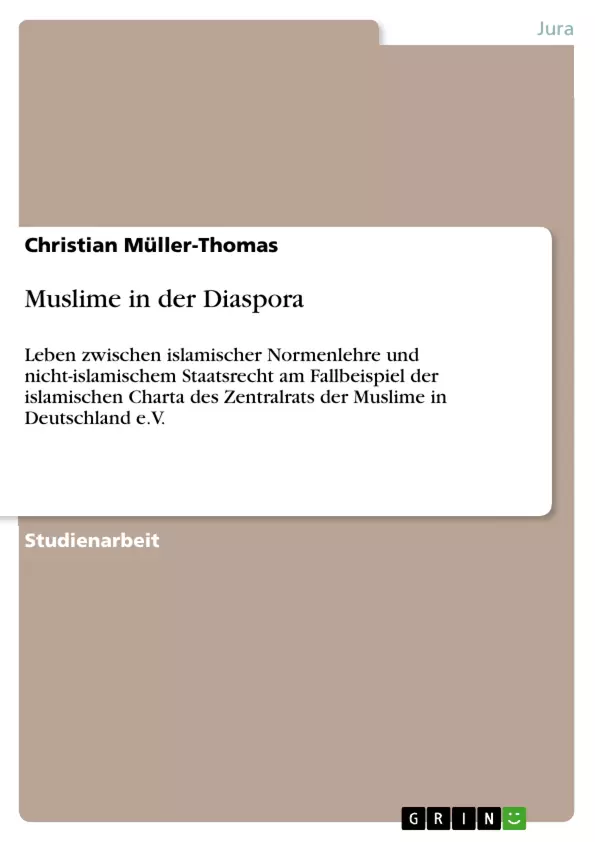Besteht die Notwendigkeit einer innerislamischen Neuorientierung oder wird die ŠarīÞa den rechtsstaatlichen Vorgaben gerecht ohne dass unsere muslimischen Mitbürger Gefahr laufen ihre eigene Identität aufgeben zu müssen? Welche Möglichkeiten stehen überhaupt den in Deutschland organisierten Verbänden zur Verfügung, um eine adäquate Umsetzung ihrer Ziele verfolgen zu können? Auf dem Fundament einer grundlegenden Betrachtung von Entwicklung, Struktur und Wesen der Šarī`a muss eine Analyse vorgenommen werden, die sich näher mit der islamischen Normenlehre im Verhältnis auf ihre Gültigkeit für Muslime in einem nicht-islamischen Land beschäftigt. Denn der Islam ist in seiner Rechtstradition hauptsächlich als ein Modell des Zusammenlebens von Muslimen und Nicht-Muslimen konzipiert. Dieses geht traditionell davon aus, dass die Muslime die herrschende Mehrheit darstellen, die politische Macht im Staat besitzen, die Gesetzgebung gestalten und die Rechtsprechung nach islamischen Recht und Gesetz besorgen.
Da die religiöse Komponente in der Integrationsproblematik eine unentbehrliche Grundlage für notwendige politische Überlegungen über die Mittel und Wege zur Ermöglichung eines gedeihlichen Zusammenlebens zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und muslimischer Minderheit stellt, beschäftigt sich diese Abhandlung mit der Frage nach der islamisch religiösen Legitimität eines dauerhaften muslimischen Aufenthalts in einem nicht-islamischen Staat. Da Muslime in der Diaspora den historischen Ursprung ihrer Handlungsanweisungen bezüglich des Umgangs mit nicht-islamischen Mehrheitsgesellschaften in der Auswanderung (Hiğra) des Propheten Muhammads von Mekka nach Medina im Jahre 622 n. Chr. finden, bedarf es zunächst der Klärung des historischen Hintergrunds. Dies ermöglicht eine bessere Deutung der bestehenden Rechtsgrundlage. Im Zuge der Untersuchung werden dafür einschlägige Koran- und Hadīthpassagen gesichtet. Anknüpfend an klassische Gutachten zu diesem Prüfungsgegenstand steht die islamische Charta im Blickfeld moderner Positionierungen islamischer Gelehrter Europas und traditioneller islamischer Gelehrter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Muslimische Migration in Deutschland
- Politische Integration
- Sozioökonomische Integration
- Kulturelle Integration
- Religiöse Integration
- Religion im deutschen Recht
- Deutsches Religionsverfassungsrecht
- Religiöse Gemeinschaften nach deutschem Recht
- Muslimische Gemeinschaften als Religionsgemeinschaften nach deutschem Recht?
- Muslimische Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Voraussetzungen für die Verleihung der Körperschaftsrechte an Religionsgemeinschaften
- Verleihung der Körperschaftsrechte an muslimische Gemeinschaften
- Islamische Normenlehre außerhalb der islamischen Welt
- uÒūl al-fiqh – wie sagt die ŠarīÞa aus?
- Íiğra – ein historischer Hintergrund
- Der Koran
- Die Sunna
- IğmāÝ
- Qiyās
- Identitätsstiftende Merkmale der islamischen Charta des ZDM
- uÒūl al-fiqh – wie sagt die ŠarīÞa aus?
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Integration von Muslimen in Deutschland und beleuchtet den Spannungsbereich zwischen islamischer Normenlehre und dem deutschen Staatsrecht. Dabei analysiert die Arbeit die Islamische Charta des Zentralrats der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD) als Beispiel für die Positionierung muslimischer Dachverbände innerhalb des deutschen Rechtssystems.
- Die Auswirkungen der muslimischen Migration auf die deutsche Gesellschaft
- Die rechtliche Integration von Muslimen im deutschen Kontext
- Die Rolle des deutschen Rechts im Umgang mit islamischen Normen
- Die islamische Charta des ZMD als Ausdruck der Selbstfindung muslimischer Gemeinschaften
- Der Dialog zwischen islamischer Tradition und säkularer Rechtsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der muslimischen Integration in Deutschland ein und beschreibt die Herausforderungen, die sich sowohl für die Muslime als auch für die Mehrheitsgesellschaft ergeben. Das zweite Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Integration, von der politischen bis zur religiösen Integration. Das dritte Kapitel untersucht das deutsche Recht und seine Implikationen für religiöse Gemeinschaften, insbesondere für muslimische Gemeinschaften. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der islamischen Normenlehre und ihren Herausforderungen in einem nicht-islamischen Kontext. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung der Islamischen Charta des ZMD und analysiert ihren Inhalt und ihre Bedeutung für die muslimische Gemeinschaft in Deutschland.
Schlüsselwörter
Islamische Normenlehre, muslimische Integration, deutsche Rechtsordnung, Islamische Charta des ZMD, interkultureller Dialog, Religionsfreiheit, Minderheitenrechte, ŠarīÞa, uÒūl al-fiqh, Íiğra, Koran, Sunna, IğmāÝ, Qiyās, Identitätsstiftung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Islamischen Charta des ZMD?
Die Charta des Zentralrats der Muslime in Deutschland regelt das Verhältnis zum deutschen Rechtsstaat und betont die Vereinbarkeit islamischer Grundsätze mit der demokratischen Grundordnung.
Was bedeutet „Hiğra“ im Kontext der Diaspora?
Die Hiğra bezieht sich auf die Auswanderung des Propheten Muhammad. Sie dient heute als historischer Bezugspunkt für die religiöse Legitimität des Lebens von Muslimen in nicht-islamischen Ländern.
Können muslimische Gemeinschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts sein?
Nach deutschem Religionsverfassungsrecht ist dies theoretisch möglich, erfordert jedoch bestimmte Voraussetzungen wie Mitgliederstabilität und Rechtstreue, was für viele Verbände eine Hürde darstellt.
Wie verhält sich die Scharia zum deutschen Grundgesetz?
Die Arbeit untersucht, ob eine innerislamische Neuorientierung nötig ist, um den rechtsstaatlichen Vorgaben in Deutschland gerecht zu werden, ohne die religiöse Identität aufzugeben.
Welche Rolle spielen Koran und Sunna bei der Integration?
Diese Quellen bilden die Basis der islamischen Normenlehre (uÒūl al-fiqh) und werden herangezogen, um Handlungsanweisungen für das Leben in einer nicht-islamischen Mehrheitsgesellschaft abzuleiten.
- Quote paper
- Christian Müller-Thomas (Author), 2008, Muslime in der Diaspora, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92840