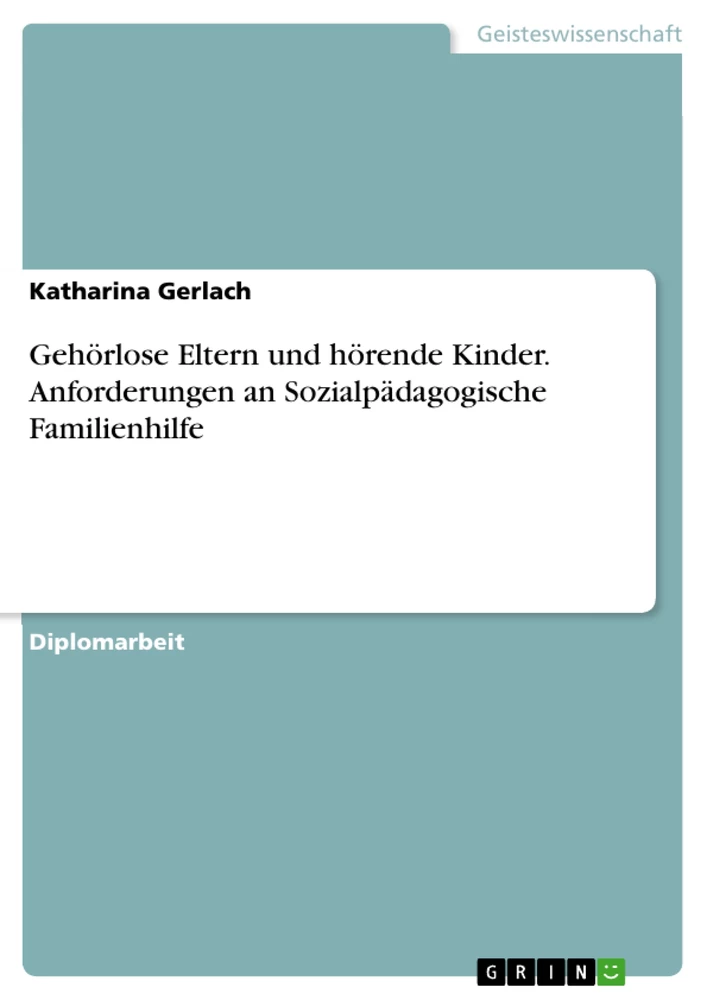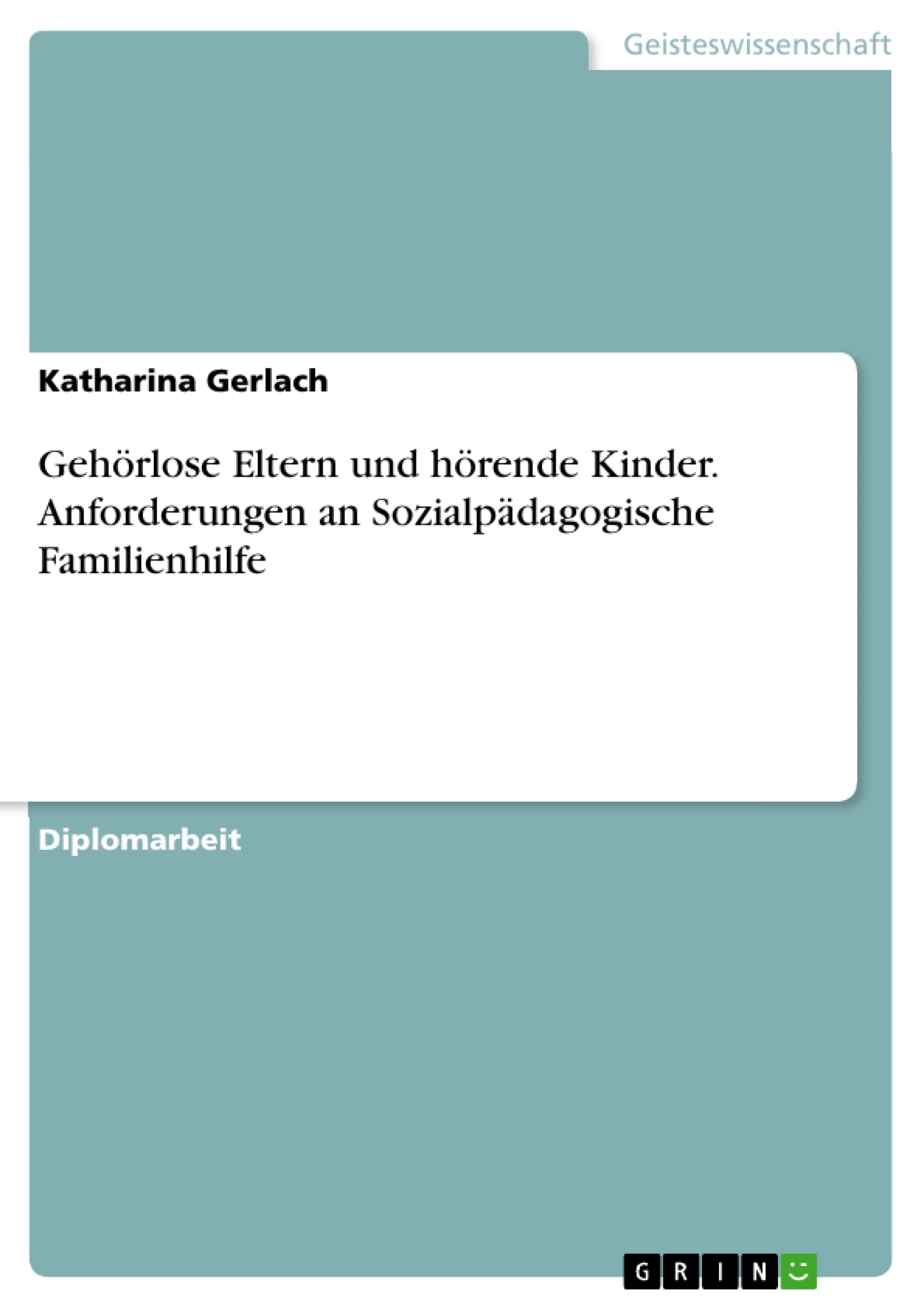In Deutschland leben ca. 80.000 gehörlose und zwischen 80.000 und 100.000 so hochgradig schwerhörige Menschen, dass diese sich nicht über Lautsprache verständigen können. Da unsere Gesellschaft auf hörende Menschen ausgerichtet ist und das Leben in ihr auf der Lautsprache basiert, stoßen gehörlose Menschen immer wieder auf Kommunikationsbarrieren, weswegen auch von einer Kommunikationsbehinderung ausgegangen werden kann. Wenn sie aber mit anderen Betroffenen zusammen sind, existieren diese Probleme in der Regel nicht. Aufgrund dessen spricht man in diesem Bereich von zwei Welten, in denen sich gehörlose Personen bewegen (müssen). Auf der einen Seite die ‚Welt der Gehörlosen’, in der sie sich ohne Probleme aufhalten, leben und kommunizieren können, und auf der anderen Seite die ‚Welt der Hörenden’, in der die Lautsprache vorherrscht, wodurch wenig verstanden wird und viele Grenzen erlebt werden.
Man kann diese Sichtweise natürlich auch auf gehörlose Eltern sowie deren hörende Kinder übertragen. Die Eltern ziehen in der Regel die gehörlose Welt vor, während für die Kinder eher ein „Pendeln zwischen [den] zwei Welten“ üblich ist. Sie haben aufgrund der familiären Situation und ihrer Hörfähigkeit zu beiden Welten Zugang. Hierdurch können für die Kinder Ambivalenzen entstehen, wenn ihnen eindeutige Zugehörigkeiten fehlen.
Anhand dieser Situation können vielseitige Probleme auftreten, die sich auf die Entwicklung und Identität beider Generationen beziehen. Hinzu kommt, dass gehörlose Menschen häufig eine wesentlich niedrigere Bildung sowie Laut- und Schriftsprachkompetenz als hörende Menschen haben. Dies resultiert in der Regel aus der Sozialisation von gehörlosen Kindern (den jetzigen Eltern) und deren hauptsächlich hörenden Eltern. Ferner ist der Umgang der hörenden Gesellschaft mit gehörlosen Menschen unsicher, da das Thema Gehörlosigkeit und damit zusammenhängende Merkmale unbekannt sind. Außerdem wird die Situation von hörenden Kindern gehörloser Eltern nicht richtig eingeschätzt, weil in dem Fall das Kind keine Behinderung hat und deshalb von weniger Problemen ausgegangen wird. Die aus diesen Faktoren resultierenden Schwierigkeiten können ein hohes Ausmaß annehmen. Wenn sie gehäuft und in Kumulation mit anderen auftreten, können Situationen entstehen, die sozialpädagogische Familienhilfe erforderlich machen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Danksagung
- 1 Einleitung
- 2 Gehörlosigkeit
- 2.1 Medizinische Grundlagen der Gehörlosigkeit
- 2.2 Unterschiedliche Perspektiven zur Gehörlosigkeit
- 2.2.1 Betroffenenperspektive und soziale Gehörlosigkeit
- 2.2.2 Pädagogische Sichtweisen
- 2.2.3 Gesellschaftliches Bild der Gehörlosigkeit
- 2.3 Gehörlosigkeit als Behinderung
- 2.3.1 Stigma
- 2.3.2 Sekundäreffekte
- 2.4 Gehörlosigkeit und Identität
- 2.4.1 Familiäre und institutionelle Sozialisation gehörloser Eltern
- 2.4.2 Folgen für die Identitätsbildung
- 2.4.3 Folgen für das eigene Erziehungsverhalten
- 2.4.4 Selbstbild gehörloser Eltern
- 2.5 Inhaltliche Konsequenzen für die Soziale Arbeit
- 3 Sozialpädagogische Familienhilfe allgemein
- 3.1 Rechtsanspruch und gesetzliche Grundlage
- 3.2 Indikationen für Familienhilfe
- 3.3 Zielgruppe
- 3.4 Inhalte und Aufgaben
- 3.5 Anforderungen an professionelle Fachkräfte
- 3.6 Kritische Aspekte
- 4 Sozialpädagogische Familienhilfe mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern
- 4.1 Indikationen, Zielgruppe und generelle Inhalte
- 4.2 Familiäre Situation
- 4.2.1 Situation der hörenden Kinder innerhalb der Familie
- 4.2.2 Situation der hörenden Kinder außerhalb der Familie
- 4.2.3 Mögliche Sprachsituationen in der Familie
- 4.2.4 Rolle der Großeltern
- 4.3 Inhalte der Arbeit mit der Gesamtfamilie
- 4.3.1 Einbeziehung der Großeltern
- 4.3.2 Kommunikationsstrukturen innerhalb der Familie
- 4.3.3 Aufbau eines sozialen Netzes
- 4.4 Unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte mit Eltern und Kindern
- 4.4.1 Inhalte der Arbeit mit den Eltern
- 4.4.1.1 Umgang mit der eigenen Gehörlosigkeit
- 4.4.1.2 Stärkung der Erziehungskompetenz
- 4.4.1.3 Familienspezifische Rollenverteilung
- 4.4.1.4 Dolmetschen
- 4.4.1.5 Informationsvermittlung
- 4.4.1.6 Vermittlung zwischen gehörloser und hörender Welt
- 4.4.1.7 Aktivierung eigener Antriebe und Ressourcen
- 4.4.2 Inhalte der Arbeit mit den Kindern
- 4.4.2.1 Familienspezifische Rollenverteilung und Grenzen
- 4.4.2.2 Gehörlosigkeit der Eltern
- 4.4.2.3 Eigene spezielle Situation
- 4.4.2.4 Identität
- 4.4.2.5 Umgang und Kommunikation mit der hörenden Welt
- 4.4.2.6 Freizeitgestaltung
- 4.4.1 Inhalte der Arbeit mit den Eltern
- 4.5 Anforderungen an professionelle Fachkräfte
- 4.6 Kritische Beurteilung und Ergänzungen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Anforderungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) in Familien mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern. Sie analysiert die spezifischen Bedürfnisse und Schwierigkeiten, die in dieser Konstellation auftreten, und erörtert die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen von Fachkräften, um eine erfolgreiche Familienhilfe zu gewährleisten.
- Kommunikationsbarrieren und sprachliche Herausforderungen in Familien mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern
- Identitätsbildung und soziale Integration von hörenden Kindern gehörloser Eltern
- Spezifische Anforderungen an die SPFH in Bezug auf die Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Interkulturelle Aspekte und die Vermittlung zwischen gehörloser und hörender Welt
- Bedeutung des sozialen Netzes und der Einbeziehung der Großeltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der SPFH mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern einführt und die Relevanz des Themas beleuchtet. Anschließend werden im zweiten Kapitel die medizinischen und sozialen Aspekte der Gehörlosigkeit sowie deren Auswirkungen auf die Identität und das Selbstbild von gehörlosen Menschen diskutiert.
Kapitel 3 behandelt die allgemeine Sozialpädagogische Familienhilfe, ihre rechtlichen Grundlagen, Indikationen, Zielgruppe, Aufgaben und Herausforderungen.
Das vierte Kapitel widmet sich der spezifischen Situation von Familien mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern. Es beleuchtet die familiäre Situation, die möglichen Sprachsituationen, die Bedeutung der Großeltern und die spezifischen Inhalte der Familienhilfe in Bezug auf Eltern und Kinder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Gehörlosigkeit, Sozialpädagogische Familienhilfe, interkulturelle Kommunikation, Erziehungskompetenz, Identitätsbildung, Inklusion und Exklusion, Familie, Interaktion, soziale Netzwerke und Ressourcen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Herausforderungen für hörende Kinder gehörloser Eltern?
Diese Kinder pendeln oft zwischen der „gehörlosen Welt“ der Eltern und der „hörenden Welt“ der Gesellschaft, was zu Ambivalenzen in der Identitätsbildung führen kann.
Welche Aufgaben hat die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) in diesen Familien?
Die SPFH unterstützt bei Kommunikationsstrukturen, stärkt die Erziehungskompetenz der Eltern und hilft beim Aufbau eines sozialen Netzwerks.
Warum kommt es oft zu Rollenverschiebungen in solchen Familien?
Hörende Kinder übernehmen oft Dolmetscheraufgaben für ihre Eltern, was die familiäre Hierarchie beeinflussen kann; die SPFH arbeitet an der Klärung dieser Rollen.
Welche Rolle spielen die Großeltern in diesem Kontext?
Die Einbeziehung der oft hörenden Großeltern ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit mit der Gesamtfamilie, um Ressourcen zu aktivieren und Konflikte zu lösen.
Wie viele gehörlose Menschen leben in Deutschland?
In Deutschland leben ca. 80.000 gehörlose sowie weitere 80.000 bis 100.000 hochgradig schwerhörige Menschen.
- Quote paper
- Diplom Sozialpädagogin Katharina Gerlach (Author), 2006, Gehörlose Eltern und hörende Kinder. Anforderungen an Sozialpädagogische Familienhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92842