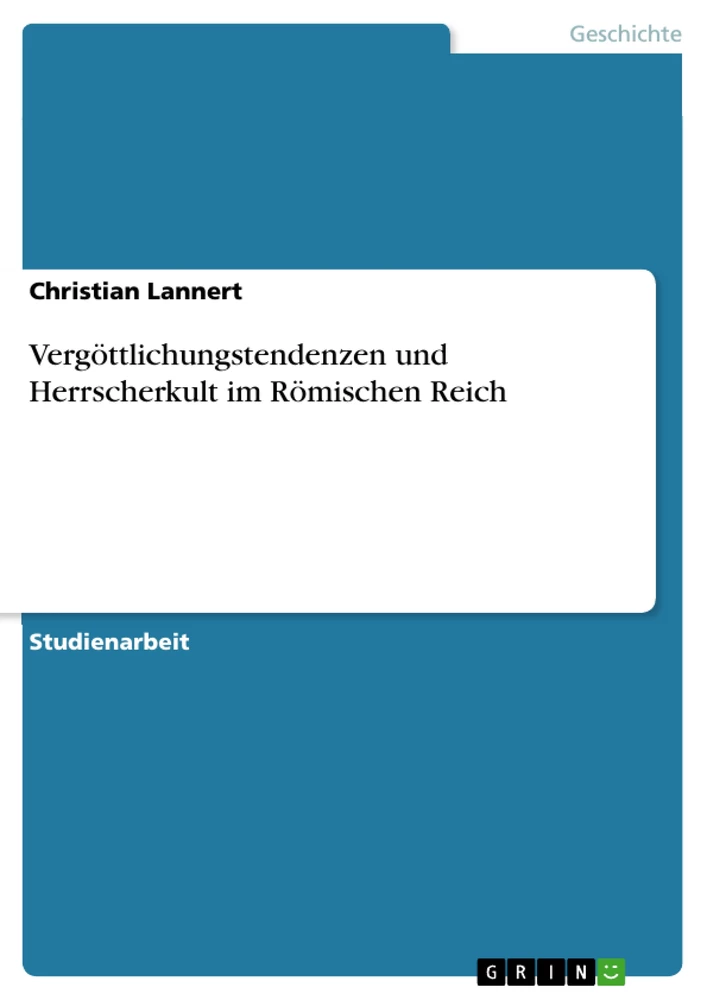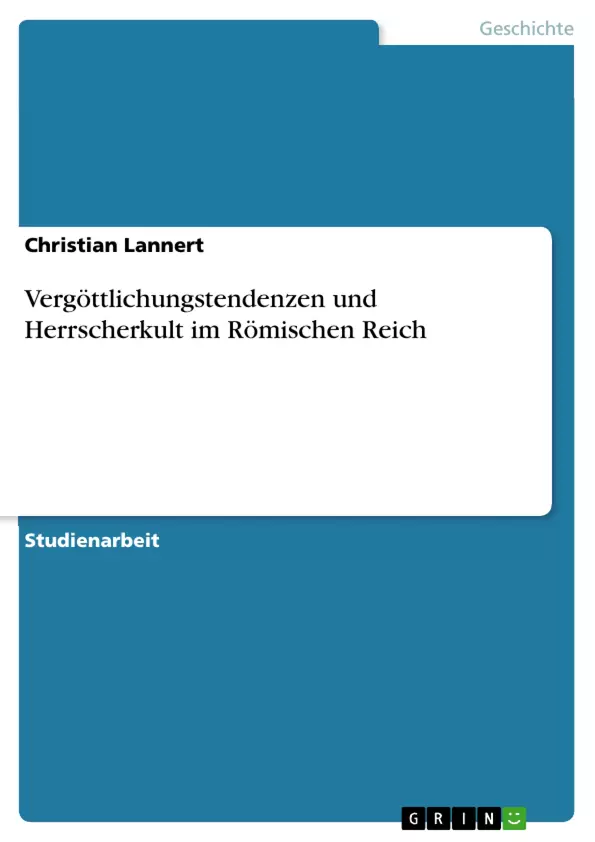[...] Die Arbeit beschränkt sich deshalb auf eine knappe Tour d’ Horizon, wobei den für die Geschichte des Kultes wichtigen Akteuren Cäsar und Augustus mehr Raum zugestanden ist. Dennoch soll der kulturhistorische Boden, aus welchem die Bereitschaft zur religiösen Verehrung Sterblicher und besonders des Herrschers erblühte und die sich daraus ergebenden religions- und staatsrechtlichen Implikationen erläutert werden. Der behandelte Zeitraum erstreckt sich von den Dea roma Kulten der Republik, über die göttlichen Ehren des Divus julius Caesar und denen des Divus filius Octavian, bis zur voll entwickelten Alleinherrschaft ihrer Nachfolger deren kultischer Selbstinszenierung praktisch keine Schranken mehr gesetzt waren. Selbst der Siegeszug des Christentums unterband den Herrscherkult keineswegs. Die erwähnten Komplexe sollen nach einer einführenden Darstellung der wesentlichen Grundzüge des griechischen und römischen Wohltäter- und Herrscherkultes chronologisch behandelt werden. Am Anfang stehen demnach Cäsar und Augustus, deren Taten und die dafür verliehenen religiös-kultischen Ehren den Boden für den Kaiserkult der späteren Jahrhunderte bereiteten. Die Vergottung Lebender war den Römern ursprünglich nicht eigen. Diese Einstellung zu ändern bedurfte es vieler vorsichtiger Schritte, die besonders Augustus geschickt zu gehen wusste, indem er den jeweiligen Kult der Mentalität seiner Träger anpasste. Die Arbeit schließt nach einer Skizze der nachaugusteischen Entwicklung bis hin zur Christianisierung des Reiches mit einigen Bemerkungen zum emotionalen Gehalt dieser Kulte, da diese Problematik einen nicht unwesentlichen Teil der Kontroversen in der Forschungsliteratur verursacht. Trotz der gebotenen Kürze soll somit ein zwar grob umrissener, aber getreuer und auf ausgewählte Quellen gestützter Überblick dieses wichtigen und im eigentlichen Sinne staatstragenden Aspektes der römischen Gesellschafts- und Religionsgeschichte, gegeben werden. Aus dem reichen literarischen Niederschlag, den die Thematik gefunden hat, seien hier nur exemplarisch das von Wlosok herausgegebene Sammelwerk zum römischen Kaiserkult und Fishwicks „The Imperial Cult in the Latin West“ genannt. Zur eingehenderen Vertiefung sei noch die von Herz verfasste ausführliche Bibliographie zu diesem Forschungsgebiet für die Jahre1955-1975 angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Wurzeln und Hauptlinien des antiken Herrscherkultes
- II. 1 Grundzüge des griechischen Wohltäter- und Herrscherkultes
- II. 2 Die Römische Tradition und der Dea Roma Kult
- III. „Divus Julius“ Caesar
- IV. „Divus Filius“ Augustus
- IV. 1 „Divina Mens et numen“ Der Augustuskult in Rom und Italien.
- IV. 2. Die Provinzialen und der Augustuskult
- IV. 3. Der Tod des Augustus.
- V. Die Nachaugusteische Zeit
- VI. Bemerkungen zum religiösen Gehalt des Kaiserkultes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des römischen Kaiserkultes. Sie beleuchtet die Wurzeln des Herrscherkultes im antiken Griechenland, die spezifischen römischen Traditionen und die Vergottung von Cäsar und Augustus. Die Arbeit geht auf die kultische Selbstinszenierung der Herrscher und deren Ausprägung in verschiedenen Regionen des römischen Reiches ein.
- Vergleichende Analyse des griechischen und römischen Herrscherkultes
- Die Rolle der römischen Tradition im Wandel zur Vergottung
- Die Vergottung von Cäsar und Augustus als Wegbereiter des Kaiserkultes
- Die Ausbreitung und Adaption des Kaiserkultes in den Provinzen
- Die religions- und staatsrechtlichen Implikationen des Kaiserkultes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor, die sich mit den Motiven und Formen der Vergottung von Herrschern im römischen Reich befassen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf Cäsar und Augustus und soll einen kulturhistorischen Kontext für die Entstehung des Kaiserkultes liefern.
- Die Wurzeln und Hauptlinien des antiken Herrscherkultes: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Merkmale des griechischen Wohltäter- und Herrscherkultes, die sich von der römischen Tradition unterscheiden. Es wird gezeigt, dass die Verehrung von Herrschern in Griechenland auf einer fließenden Grenze zwischen Mensch und Gott beruhte, während die Vergottung Lebendiger im römischen Kulturkreis zunächst fremd war.
- „Divus Julius“ Caesar: Das Kapitel behandelt die Vergottung von Cäsar und die damit verbundenen religiösen und politischen Prozesse.
- „Divus Filius“ Augustus: Dieses Kapitel analysiert die Vergottung von Augustus und seinen Einfluss auf die Entwicklung des römischen Kaiserkultes. Es werden die kultischen Praktiken in Rom und den Provinzen sowie die Rolle des Augustus-Kultes in der politischen Stabilisierung des Reiches beleuchtet.
- Die Nachaugusteische Zeit: Dieses Kapitel skizziert die Fortsetzung des Kaiserkultes in der Zeit nach Augustus und die Anpassung an neue politische und soziale Bedingungen.
Schlüsselwörter
Römischer Kaiserkult, Herrscherkult, Vergottung, Cäsar, Augustus, Dea Roma, Wohltäterkult, antike Religion, römische Geschichte, Staatsreligion, politische Propaganda, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand der Kaiserkult im Römischen Reich?
Der Kaiserkult entwickelte sich aus griechischen Vorbildern des Herrscherkultes und wurde durch die Vergottung von Julius Caesar (Divus Julius) und später Augustus systematisch etabliert.
Was ist der Unterschied zwischen griechischem und römischem Herrscherkult?
In Griechenland war die Verehrung Sterblicher als Götter verbreiteter, während die Römer ursprünglich eine strikte Trennung pflegten und die Vergottung erst politisch adaptierten.
Welche Rolle spielte Augustus bei der Vergöttlichung?
Augustus nutzte den Kult geschickt zur politischen Stabilisierung, indem er sich als „Sohn des Göttlichen“ (Divus filius) inszenierte und den Kult an die Mentalität der Provinzen anpasste.
Was bedeutet der Begriff „Dea Roma“?
Dea Roma ist die Personifikation der Stadt Rom als Göttin, die bereits in der Republik kultisch verehrt wurde und den Boden für den späteren Personenkult bereitete.
Endete der Herrscherkult mit dem Christentum?
Nein, der Herrscherkult bestand in abgewandelter Form weiter und die religiöse Verehrung des Kaisers wurde teilweise in das christliche Staatsverständnis integriert.
- Arbeit zitieren
- Christian Lannert (Autor:in), 2005, Vergöttlichungstendenzen und Herrscherkult im Römischen Reich , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92868