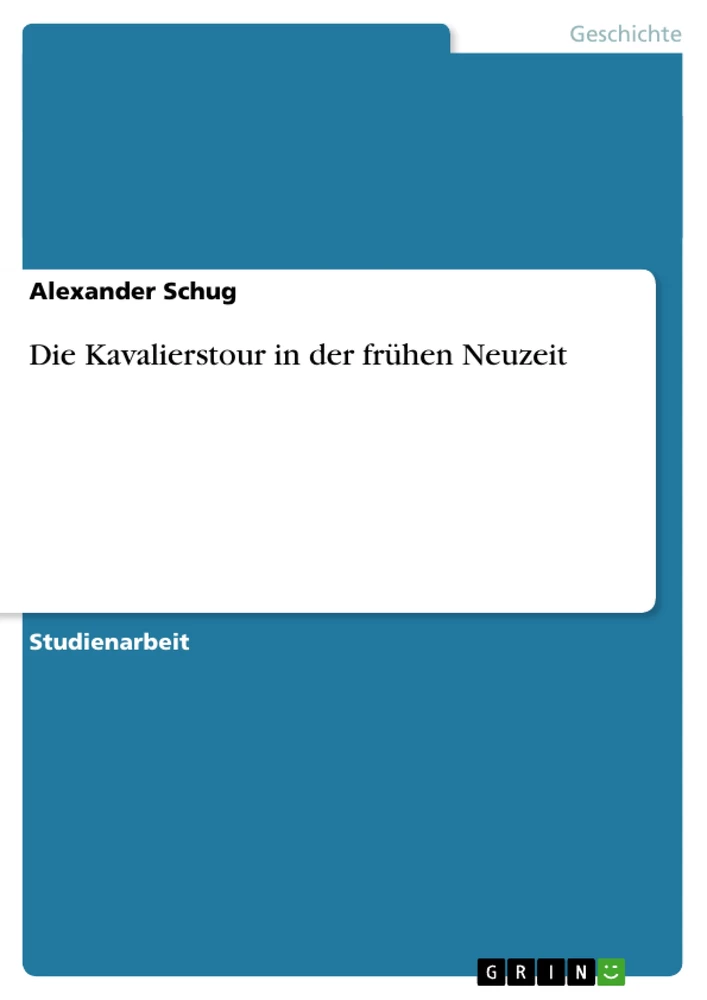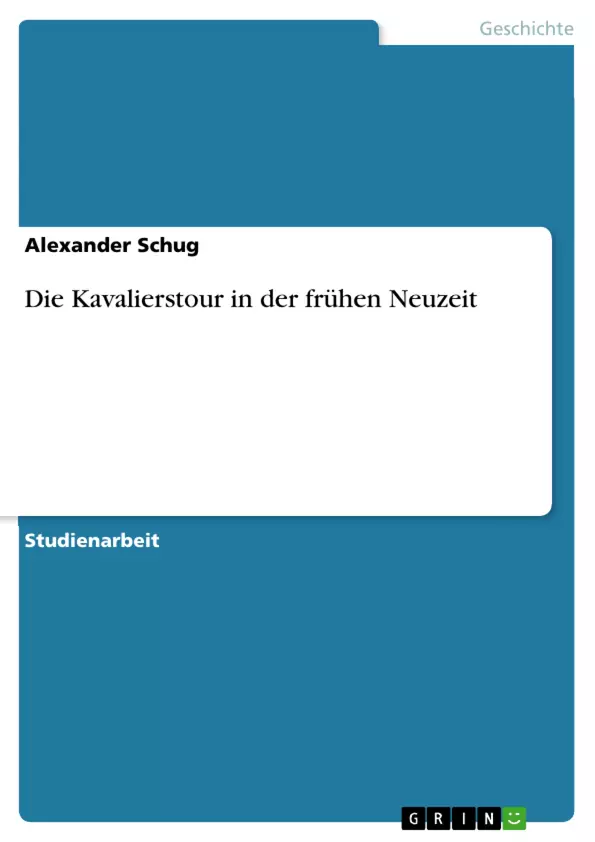Die frühe Neuzeit ist nicht nur die Zeit der großen Entdeckungsreisen, sondern auch der humanistischen Bildungsreform. Wurde im Mittelalter noch die Stabilität gegenüber der Mobilität aufgewertet, drehte sich dieses Verhältnis in der Frühneuzeit um. Damit sah man auch die zuvor als sündhaft betrachtete theoretische Neugier (curiositas) in einem anderen Licht. Die kirchlichen Warnungen im Mittelalter, daß curiositas zu destruktiven Erfahrungen führen, und - noch viel schlimmer - häretisches Gedankengut heraufbeschwören würde, verblaßten mit der Zeit.1 Neues zu erfahren, sich zu bilden gehörten in der frühen Neuzeit zunehmend zum Habitus bestimmter gesellschaftlicher Schichten, insbesondere auch des Adels. Der damit legitimierte Empirismus ermöglichte das Zeitalter der Entdeckungen und neue Formen des sich Bildens. Ein Hauptaspekt dieser neuen Formen des sich Bildens war die Abwertung des Hörensagens und des Gedächtnisses - zwei Elemente die bislang Wissen mitkonstituiert hatten. Der - wie erwähnt - im Humanismus legitimierte Empirismus bedeutete eben die Abwertung des Hörensagens und Gedächtnisses, weil man Selbstbeobachtetes höher stellte als von anderen Übernommenes. Das "unzuverlässige" Gedächtnis als Speichereinheit wurde immer mehr vernachlässigt; Gesehenes oder Wissen allgemein wurde zunehmend dem Papier anvertraut.
Eng verbunden mit der Neuauffassung von Bildung und Wissen war das Reisen. Es reichte nicht mehr, sich nur erzählen zu lassen was auf der Welt passiert. Man mußte selber reisen, sehen, erfahren. Die Reise rückte in diesem Sinne in der frühen Neuzeit in den Kontext der Bildung und Erziehung - ein bis dahin außerhalb der Gelehrtenreise zu den europäischen Universitäten oder der Entdeckungsreisen nicht explizit formulierter Reisezweck - und wurde von den Humanisten der frühen Neuzeit besonders gepriesen. Vertreter des Humanismus wie Erasmus von Rotterdam hatten bisher übliche Reiseformen wie die Pilgerfahrt als nutzlos, kostspielig und für die Sitten verderblich geschmäht und gemeint, ihr Hauptertrag bestünde in der Möglichkeit, mit Abenteuern anzugeben. "Um wieviel frömmer sei es demgegenüber, an sich selbst zu arbeiten!", so Erasmus von Rotterdam 1542.2 Dieser Ausspruch war programmatisch für das Bildungsideal der Humanisten. Nur durch das Reisen könne man sich wahrhaft bilden gemäß der Devise "mobiliora sunt nobiliora"3.
Inhaltsverzeichnis
- Die Kavalierstour - Höhepunkt adliger Bildung in der Frühen Neuzeit
- Reisevorbereitungen
- Ars Apodemica - Über die richtige Weise zu reisen: Reisetheoretische Literatur
- Bildungsreisende und ihre Erlebnisse - Zwischen Studium, Kulturerlebnis und Abenteuer
- Nach der Rückkehr
- Fazit: Europa als Handlungshorizont
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Kavalierstour, einer speziellen Form der Bildungsreise, die im 16. Jahrhundert im europäischen Adel Einzug hielt und bis ins 19. Jahrhundert prägend war. Sie analysiert die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Reiseform hervorbrachten, und beleuchtet die pädagogischen Ziele, die damit verfolgt wurden. Im Zentrum steht die Entwicklung der Kavalierstour als ein wesentlicher Bestandteil der adligen Standesbildung und ihre Einordnung in den Kontext der humanistischen Bildungsreform der frühen Neuzeit.
- Die Kavalierstour als Höhepunkt adliger Bildung in der Frühen Neuzeit
- Die Bedeutung des Reisens als Bildungselement in der frühen Neuzeit
- Die Entwicklung der Kavalierstour als Standesbildung und ihre Bedeutung für die Charakterbildung des Adels
- Die Rolle der Universität und Akademie in der Kavalierstour
- Die Entwicklung der Grand Tour im 18. Jahrhundert und die zunehmenden sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen, die das Reisen prägten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Kavalierstour, die mit der humanistischen Bildungsreform der frühen Neuzeit und der Neubewertung von Mobilität und Wissensgewinnung zusammenhängen.
- Im zweiten Kapitel werden die Reisevorbereitungen, die eine wichtige Rolle bei der Absicherung der jungen Adligen spielten, ausführlich besprochen. Besondere Bedeutung erhielt die Wahl eines geeigneten Hofmeisters oder Tutors, der für die moralische und geistige Entwicklung des Schülers verantwortlich war.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Reisetheoretischen Literatur, die sich mit der „richtigen Weise zu reisen“ befasste und dem jungen Adel als Leitfaden diente. Dabei wurden verschiedene Aspekte wie die Wahl des Reiseziels, die Reiseplanung und die richtige Umgangsform mit fremden Kulturen thematisiert.
- Das vierte Kapitel gibt einen Einblick in die Erlebnisse der Bildungsreisenden und zeigt, wie sie sich mit dem Studium an ausländischen Universitäten, dem Erleben fremder Kulturen und Abenteuern konfrontierten.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Kavalierstour, Grand Tour, Bildungsreise, Adel, Standesbildung, Humanismus, frühe Neuzeit, Reisevorbereitungen, Ars Apodemica, Bildungsreisende, Europa, Charakterbildung, Reisekultur, Staatsnähe, Tourismus.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel einer Kavalierstour für junge Adlige?
Die Kavalierstour war der Höhepunkt der adligen Standesbildung. Sie diente dem Erwerb von Fremdsprachen, dem Kennenlernen fremder Kulturen und der Charakterbildung für künftige Staatsaufgaben.
Wie veränderte der Humanismus das Verständnis vom Reisen?
Im Humanismus wurde der Empirismus aufgewertet: Selbstbeobachtetes zählte mehr als Hörensagen. Reisen wurde als notwendiges Mittel zur Bildung und Erziehung legitimiert.
Was versteht man unter der "Ars Apodemica"?
Die Ars Apodemica war die reisetheoretische Literatur der frühen Neuzeit. Sie bot Leitfäden über die richtige Weise zu reisen, die Reiseplanung und den Umgang mit fremden Kulturen.
Welche Rolle spielte der Hofmeister auf der Reise?
Der Hofmeister (Tutor) war für die moralische und geistige Entwicklung des jungen Adligen verantwortlich, überwachte die Studien und schützte ihn vor "sündhaften" Einflüssen.
Warum wurde die Pilgerfahrt von Humanisten wie Erasmus kritisiert?
Erasmus von Rotterdam sah Pilgerfahrten als nutzlos und kostspielig an. Er meinte, es sei frömmer, durch Bildungsreisen an sich selbst zu arbeiten und sich wahrhaft zu bilden.
Was bedeutet die Devise "mobiliora sunt nobiliora"?
Diese Devise besagt, dass das Bewegliche (Reisende) edler sei. Mobilität wurde in der frühen Neuzeit zu einem zentralen Habitus des Adels und zum Zeichen von Bildung.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schug (Autor:in), 2000, Die Kavalierstour in der frühen Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9289