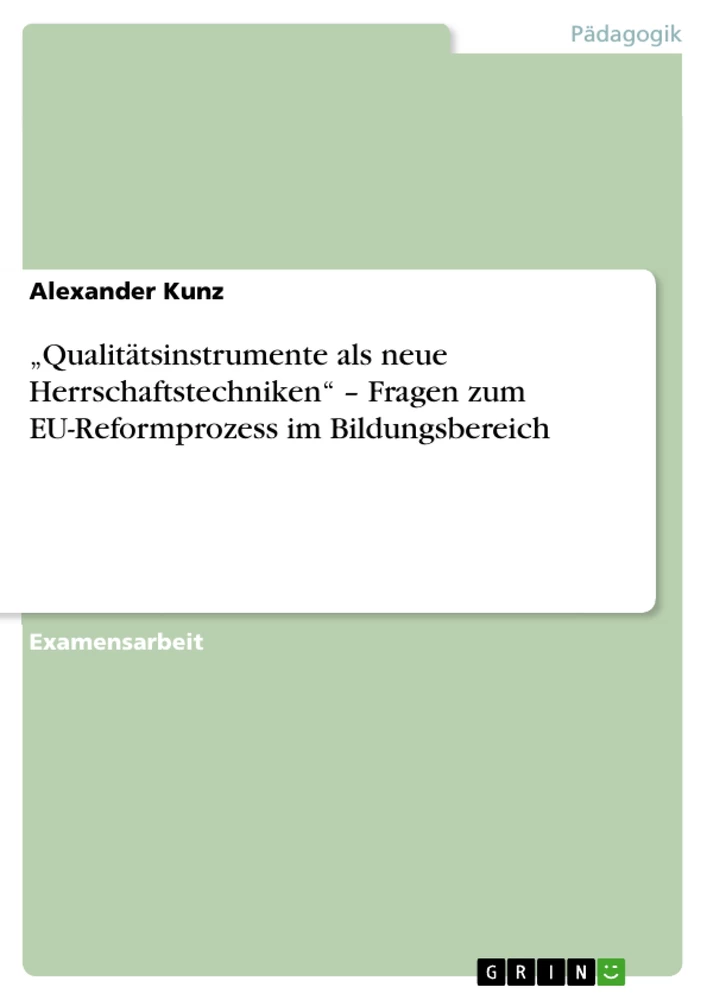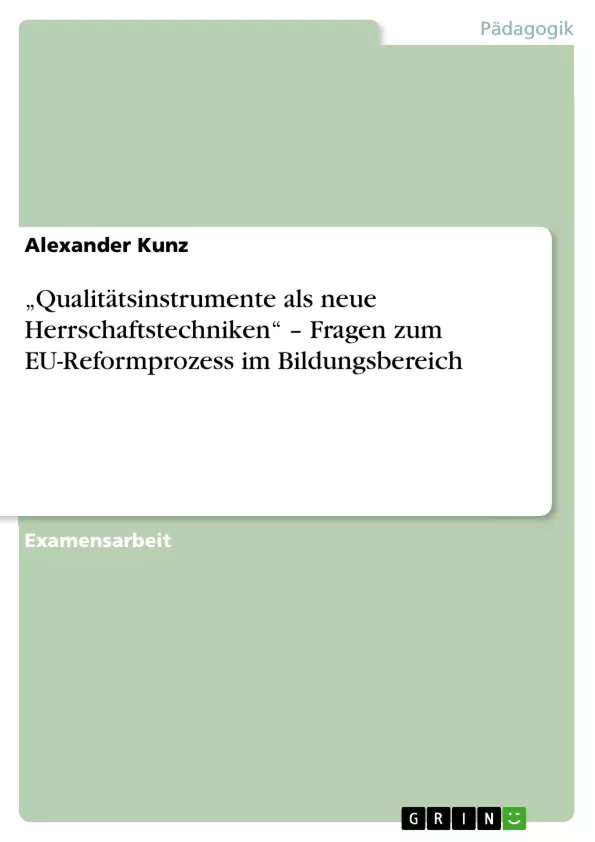„Man sollte nicht vergessen, dass Europa nicht nur das Europa des Euro, der
Banken und der Wirtschaft ist: es muss auch ein Europa des Wissens sein“
(Sorbonne-Erklärung: 25Mai 1998)
Dieser Auszug aus der Pariser Sorbonne-Erklärung soll dieser Arbeit vorangestellt
sein, da er m. A. nach auf eindrückliche Weise die Entwicklungen der europäischen
Bildungspolitik seit knapp 10 Jahren zusammenfassend wiedergibt. D.h. wird ie
Immanenz von Wissen und Bildung im Informationszeitalter gewürdigt und als
wesentlicher, vielleicht sogar gleichberechtigter, Pfeiler des geeinten Europas, neben
Finanzen und Handel, etabliert. Des Weiteren macht dieses Zitat deutlich, wie
Wirtschaft und Bildung enggeführt werden und schließlich zusammenfallen. Bildung
und Wissen definieren nur mehr einen Bereich der Wirtschaft. Das Verständnis von
Bildung wird demnach neu-formuliert und steht in dieser neuen Auffassung dem
tradierten emanzipatorischen Impetus gegenüber. Zu Fragen ist auch wie dies dem
Humboldt Bildungsideal gegenüber tritt. Der große deutsche Bildungstheoretiker, gibt
Bildung als Notwendigkeit zu verstehen, durch die der Mensch seinem ideellen Bild
nach geformt werde.
Es geht mir nun zunächst darum, (1). die Reformation des Bildungssystem und damit
auch des Bildungsverständnisses durch die EU nachzuzeichnen. Ich konzentriere
mich dabei auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre und im besonderen den
Wandel im Hochschulewesen.
Des weiteren gilt dann (2.) meine Aufmerksamkeit der Diskussion im Anschluss an
den Reformprozess. Hier wiegt gerade der Vorwurf der Kommerzialisierung des
Bildungswesens schwer.
Zum anderen möchte ich (3.) dieses von der EU entworfene Bildungsverständnis mit
der Theoriefigur der „Gouvernementalität“ Foucaults konfrontieren. Um die
geäußerten Bedenken theoretisch zu untermauern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Der Bologna-Prozess als Reformprojekt
- II. Kommerzialisierung und Konkurrenz im europäischen Hochschulraum
- III. Bologna-Prozess und Gouvernementalität
- IV. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Reformen des Bildungssystems durch die Europäische Union (EU) im Hinblick auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre, insbesondere den Wandel im Hochschulewesen, zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf den Bologna-Prozess und die daran anschließende Diskussion um die Kommerzialisierung des Bildungswesens gelegt.
- Der Bologna-Prozess als Reformprojekt der EU
- Die Kommerzialisierung des Bildungswesens als Folge des Bologna-Prozesses
- Die Verbindung des Bologna-Prozesses mit der Lissabon-Strategie
- Die Kritik an den Reformen durch Studentenvertretungen
- Die Anwendung des Theorierahmens der Gouvernementalität Foucaults auf das europäische Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der europäischen Bildungspolitik ein und stellt die zentrale These der Arbeit vor, dass die Reform des Bildungssystems durch die EU als eine neue Form der Herrschaft interpretiert werden kann. Die Arbeit zielt darauf ab, die Reformen im Bildungsbereich nachzuzeichnen und mit der Theorie der Gouvernementalität Foucaults zu konfrontieren.
I. Der Bologna-Prozess als Reformprojekt
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Bologna-Prozess als dem wichtigsten Reformprojekt der EU im Bildungsbereich. Es beschreibt die Entstehung des Bologna-Abkommens, die zentralen Punkte des Abkommens und die Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses in den Folgekonferenzen. Außerdem werden die unterschiedlichen Perspektiven auf den Bologna-Prozess, vonseiten der Wirtschaft und vonseiten der Studierenden, dargestellt.
II. Kommerzialisierung und Konkurrenz im europäischen Hochschulraum
Dieses Kapitel behandelt die Diskussion um die Kommerzialisierung des Bildungswesens im Zuge des Bologna-Prozesses. Es stellt die Verbindung des Bologna-Prozesses mit der Lissabon-Strategie heraus und beleuchtet die Folgen dieser Verknüpfung für die europäischen Bildungssysteme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der europäischen Bildungspolitik, dem Bologna-Prozess, der Kommerzialisierung des Bildungswesens, der Lissabon-Strategie, der Gouvernementalität nach Foucault und dem Wandel im Hochschulewesen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Bologna-Prozess?
Ein EU-Reformprojekt zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums, das unter anderem die Einführung von Bachelor- und Master-Abschlüssen beinhaltete.
Warum wird von einer Kommerzialisierung der Bildung gesprochen?
Kritiker bemängeln, dass Bildung zunehmend als Wirtschaftsfaktor gesehen wird und Universitäten in einem Wettbewerb stehen, der sich an ökonomischer Effizienz statt an emanzipatorischen Idealen orientiert.
Was bedeutet 'Gouvernementalität' im Kontext der Bildungsreform?
Nach Foucault beschreibt dies neue Herrschaftstechniken, bei denen Individuen durch Qualitätsinstrumente und Standards dazu gebracht werden, sich selbst im Sinne ökonomischer Ziele zu steuern.
Wie unterscheidet sich das neue Bildungsverständnis vom Humboldtschen Ideal?
Während Humboldt die zweckfreie Bildung zur Entfaltung der Persönlichkeit betonte, steht heute oft die Verwertbarkeit von Wissen für den Arbeitsmarkt im Vordergrund.
Was ist die Lissabon-Strategie?
Ein Ziel der EU, Europa zum wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, was eng mit den Bildungsreformen des Bologna-Prozesses verknüpft ist.
- Quote paper
- Alexander Kunz (Author), 2007, „Qualitätsinstrumente als neue Herrschaftstechniken“ – Fragen zum EU-Reformprozess im Bildungsbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92906