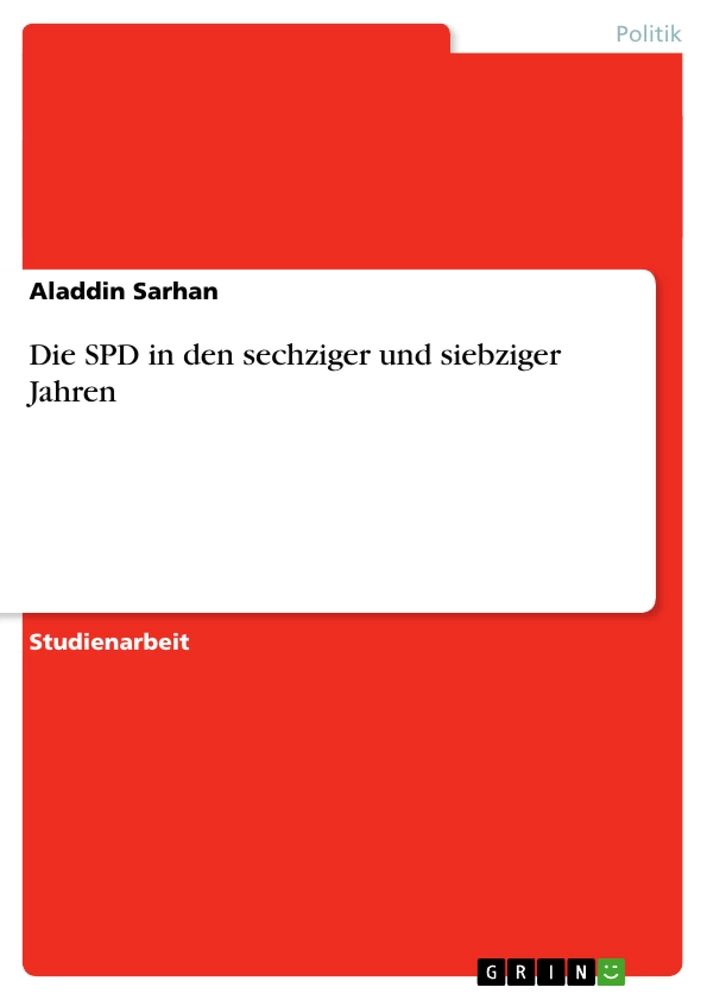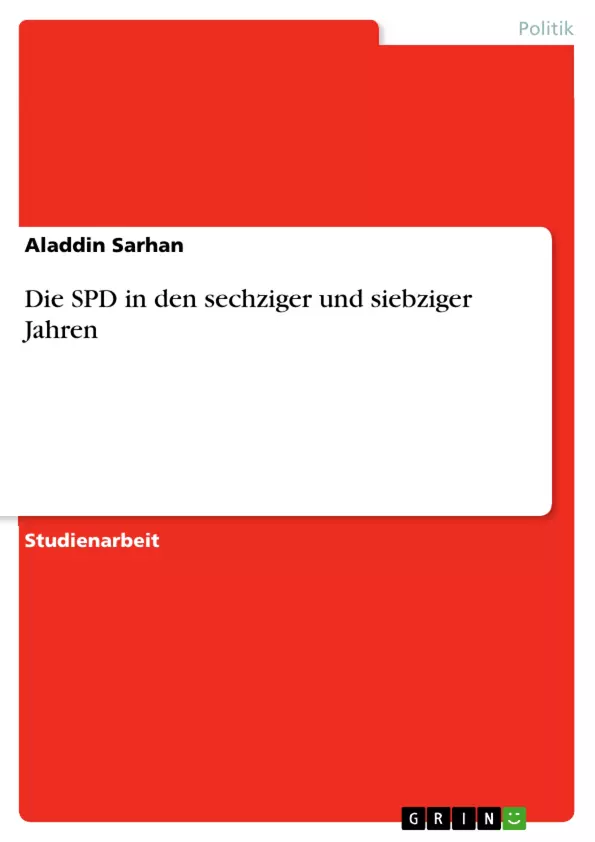Die seit 1998 im Bund mit den Grünen regierende Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist die älteste Volkspartei Deutschlands. Ihre Wurzeln reichen bis in die März-Revolution von 1848/49 zurück.
Im Jahre 1875 entstand aus dem Zusammenschluss des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Gotha die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die 1878 durch das unter Bismarck erlassene Sozialistengesetz verboten wurde. Nach dessen Aufhebung erfolgte 1980 die Umbenennung in Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD). Diese war seit 1912 die stärkste Fraktion des Reichstags und unterstützte während des Ersten Weltkrieges die Reichsregierung. Die SPD zählte zu den Stützen der Weimarer Republik, stellte den ersten Reichspräsidenten, drei Reichskanzler (1919-1920 und 1928-1930) und war in verschiedenen Reichsregierungen vertreten. Die Reichstagsfraktion der SPD stimmte 1933 als einzige gegen das Ermächtigungsgesetz Hitlers und wurde im Juni 1933 verboten.
Nach Emigration und Verfolgung wurde die SPD 1945 wiedergegründet und entwickelte sich zu einer der beiden großen Volksparteien in der Bundesrepublik Deutschland; in der Sowjetischen Besatzungszone erfolgte 1946 die (Zwangs-) Vereinigung mit der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Die Nachkriegs-SPD wurde deutlich von Kurt Schumacher (Vorsitzender von 1946-1952) geprägt. Wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der SPD hatte das Godesberger Programm (1959), das während des Parteivorsitzes von Erich Ollenhauer (1952-1963) verabschiedet wurde. Prägend für die SPD war der langjährige Parteivorsitzende Willy Brandt (1964-1987), in dessen Amtszeit die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene (Große Koalition mit der CDU/CSU 1966-1969) ebenso fällt wie die Koalitionsregierungen mit der FDP unter den sozialdemokratischen Bundeskanzlern Willy Brandt (1969-1974) und Helmut Schmidt (1974-1982).
Im Jahre 1959 verabschiedete die SPD nach einem längeren kontroversen Diskussionsprozess das Godesberger Programm und öffnete sich damit endgültig zur Volkspartei. Sie gewann breite Wählerschichten hinzu und übernahm auf der Bundesebene die Regierungsverantwortung - zunächst ab 1966 im Rahmen einer Großen Koalition mit der CDU, seit 1969 in einer sozial-liberalen Koalition mit der FDP. Auf der Länderebene übernahm die SPD im Jahre 1966 die Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Programmatik
- Programmatik in den Sechziger Jahren
- Programmatik in den Siebziger Jahren
- Organisation
- Organisatorische Diskussionen in den sechziger Jahren
- Die Parteiorganisation in den siebziger Jahren
- Finanzierung
- Die Parteifinanzierung in den sechziger Jahren
- Die Parteifinanzierung in den siebziger Jahren
- Mitglieder
- Die Mitgliedschaft in den sechziger und siebziger Jahren
- Fazit
- Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in den 1960er und 1970er Jahren. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wandels in Bezug auf Programmatik, Organisation, Finanzierung und Mitgliederstruktur. Die Arbeit beleuchtet die Anpassung der SPD an die veränderten politischen und gesellschaftlichen Bedingungen dieser Zeit und zeigt auf, wie die Partei ihren Weg zur Volkspartei gefunden hat.
- Der Wandel der Programmatik der SPD nach dem Godesberger Programm von 1959
- Die Entwicklung der Organisationsstruktur der SPD in den 1960er und 1970er Jahren
- Die Finanzierung der SPD in den 1960er und 1970er Jahren
- Die Veränderungen in der Mitgliederstruktur der SPD in den 1960er und 1970er Jahren
- Die Rolle der SPD in der Regierungsbildung auf Bundes- und Landesebene
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die historische Entwicklung der SPD skizziert und die Bedeutung des Godesberger Programms von 1959 für die Transformation der Partei zur Volkspartei herausstellt.
Das zweite Kapitel analysiert die programmatische Entwicklung der SPD in den 1960er Jahren. Es werden die Bildungs-, Rechts- und Deutschlandpolitik der Partei beleuchtet und die Bedeutung des „Wandels durch Annäherung“ im Kontext der Ostpolitik der SPD diskutiert.
Schlüsselwörter
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Godesberger Programm, Volkspartei, Programmatik, Organisation, Finanzierung, Mitgliederstruktur, 1960er Jahre, 1970er Jahre, Bildungspolitik, Rechtspolitik, Deutschlandpolitik, Ostpolitik, Wandel durch Annäherung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte das Godesberger Programm für die SPD?
Mit dem Godesberger Programm von 1959 öffnete sich die SPD endgültig zur Volkspartei, was den Weg für breitere Wählerschichten und die Übernahme von Regierungsverantwortung auf Bundesebene ebnete.
Wie veränderte sich die Programmatik der SPD in den 1960er Jahren?
Der Fokus lag auf einer Modernisierung in der Bildungs-, Rechts- und Deutschlandpolitik, wobei insbesondere die Ostpolitik und das Konzept des "Wandels durch Annäherung" zentral wurden.
Wer waren die prägenden Persönlichkeiten der SPD in dieser Ära?
Maßgeblich geprägt wurde die Zeit durch Willy Brandt (Parteivorsitzender 1964–1987) und Helmut Schmidt, die beide als Bundeskanzler sozial-liberale Koalitionen anführten.
Wann übernahm die SPD erstmals Regierungsverantwortung im Bund?
Nach der Neugründung 1945 trat die SPD 1966 erstmals in eine Große Koalition mit der CDU/CSU ein, gefolgt von der ersten sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt ab 1969.
Wie entwickelte sich die Mitgliederstruktur der Partei?
Die Arbeit untersucht die Veränderungen in der Mitgliedschaft während der 60er und 70er Jahre, in denen die SPD durch ihre Öffnung zur Volkspartei einen signifikanten Wandel und Zuwachs erlebte.
- Arbeit zitieren
- Aladdin Sarhan (Autor:in), 2002, Die SPD in den sechziger und siebziger Jahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9293