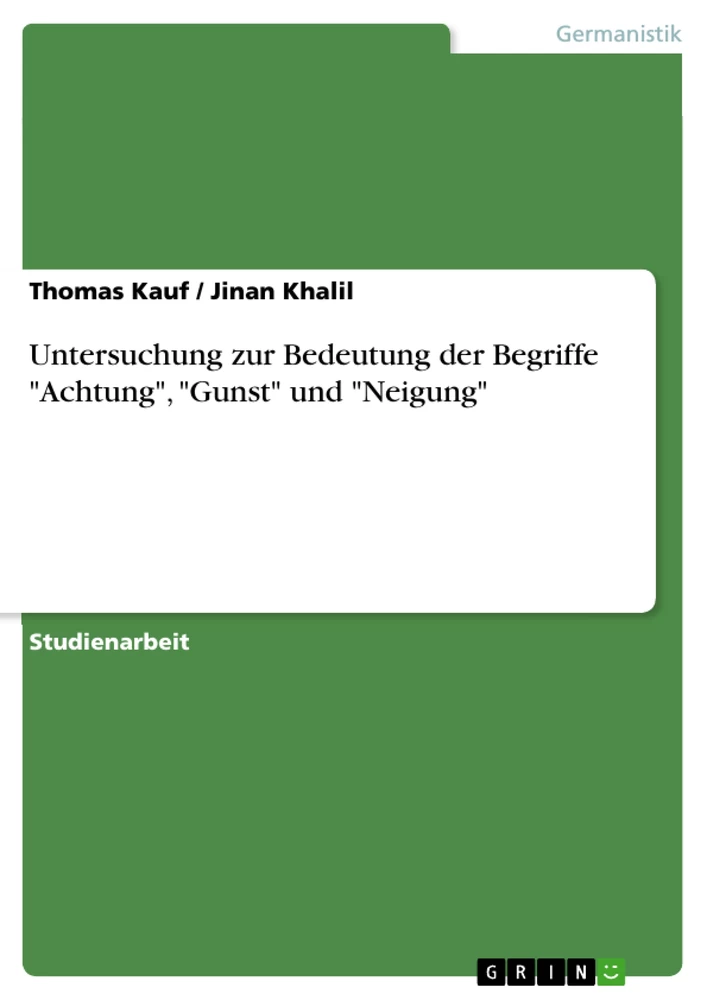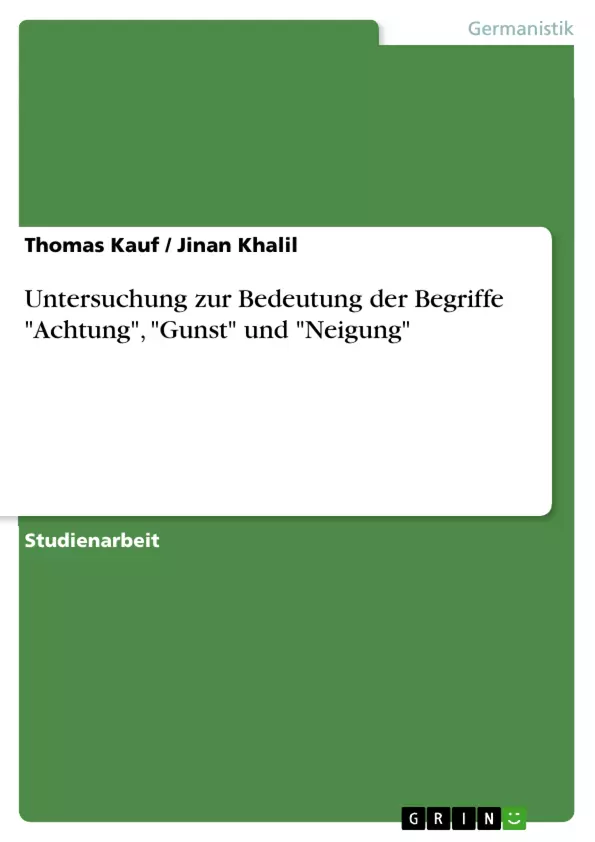In dieser Arbeit wird die Bedeutung der Begriffe Achtung, Gunst und Neigung untersucht werden. Ausgangspunkt stellt dabei Immanuel Kants „Kritik der Urteilskraft“ dar, in der diese Begriffe miteinander kontrastiert werden, um zu einer Definition des Geschmacks zu gelangen. In genau diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, was unter Achtung, Gunst und Neigung aus der Sprachperspektive heraus verstanden werden kann, weshalb in den folgenden Kapiteln eine eingehendere Untersuchung dieser drei Begriffe stattfinden wird. Um die Bedeutungen der Begriffe aus möglichst vielen unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten wurden verschiedene Ansätze gewählt. Auf eine Erläuterung der Begriffe im kantischen Verständnis folgen zunächst Annäherungen an heute geläufige Verwendungsweise, gestützt durch aktuelle Lexika und eigene Korpora-Stichproben, um schließlich die Begriffe einer eingehenden etymologischen Untersuchung zu unterziehen. Das jeweilige methodische Vorgehen wird an den entsprechenden Stellen eingehender darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Begriffe Achtung, Neigung und Gunst bei Kant
- Gebrauch und Herkunft der Begriffe Achtung, Gunst und Neigung
- Achtung
- Allgemeiner heutiger Wortgebrauch
- Etymologischer Hintergrund
- Schlussfolgerung
- Neigung
- Allgemeiner heutiger Sprachgebrauch
- Etymologischer Hintergrund
- Schlussfolgerung
- Gunst
- Allgemeiner heutiger Sprachgebrauch
- Etymologischer Hintergrund
- Schlussfolgerung
- Achtung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bedeutung der Begriffe Achtung, Gunst und Neigung im Kontext von Immanuel Kants „Kritik der Urteilskraft“. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis der Beziehung dieser Begriffe zur ästhetischen Urteilskraft und der Definition des Schönen zu erlangen.
- Erläuterung der Begriffe Achtung, Neigung und Gunst im kantischen Kontext
- Analyse des heutigen Sprachgebrauchs der Begriffe anhand von Lexika und Korpora
- Etymologische Untersuchung der Begriffsgeschichte von Achtung, Neigung und Gunst
- Bedeutung der Begriffe für die Bestimmung des Schönen
- Kontrastierung der drei Begriffe zur Abgrenzung des Begriffs der Gunst als Grundlage für das freie Wohlgefallen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die methodischen Ansätze. Das zweite Kapitel beleuchtet die drei Begriffe Achtung, Neigung und Gunst im kantischen Verständnis und setzt sie in Bezug zu den drei Formen des Wohlgefallens: Lust am Angenehmen, Lust am Guten und Lust am Schönen. Das dritte Kapitel befasst sich mit der gegenwärtigen Verwendung und der etymologischen Herkunft der drei Begriffe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen Achtung, Gunst und Neigung im Kontext der Kant’schen Ästhetik, insbesondere im Hinblick auf das freie Wohlgefallen und die Definition des Schönen. Sie untersucht deren sprachliche Entwicklung, die Bedeutung im heutigen Sprachgebrauch und die etymologischen Wurzeln.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Immanuel Kant die Begriffe Achtung, Gunst und Neigung?
Kant nutzt diese Begriffe in der „Kritik der Urteilskraft“, um verschiedene Arten des Wohlgefallens (am Guten, am Schönen und am Angenehmen) voneinander abzugrenzen.
Was ist der etymologische Hintergrund des Begriffs "Achtung"?
Die Arbeit untersucht die sprachgeschichtliche Entwicklung von "Achtung" von seinen Wurzeln bis zum heutigen Gebrauch als Ausdruck von Respekt oder Beachtung.
Warum ist "Gunst" für die Definition des Schönen wichtig?
Laut Kant ist Gunst das einzige freie Wohlgefallen, da es weder durch ein Bedürfnis (Neigung) noch durch ein moralisches Gesetz (Achtung) erzwungen wird.
Was unterscheidet Neigung von Achtung?
Neigung bezieht sich auf das sinnliche Verlangen nach dem Angenehmen, während Achtung sich auf die Anerkennung des moralisch Guten bezieht.
Wie wird der heutige Sprachgebrauch dieser Begriffe analysiert?
Die Analyse stützt sich auf aktuelle Lexika und Korpora-Stichproben, um die Bedeutungsverschiebungen seit Kants Zeit aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Thomas Kauf (Autor), Jinan Khalil (Autor), 2007, Untersuchung zur Bedeutung der Begriffe "Achtung", "Gunst" und "Neigung", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93025