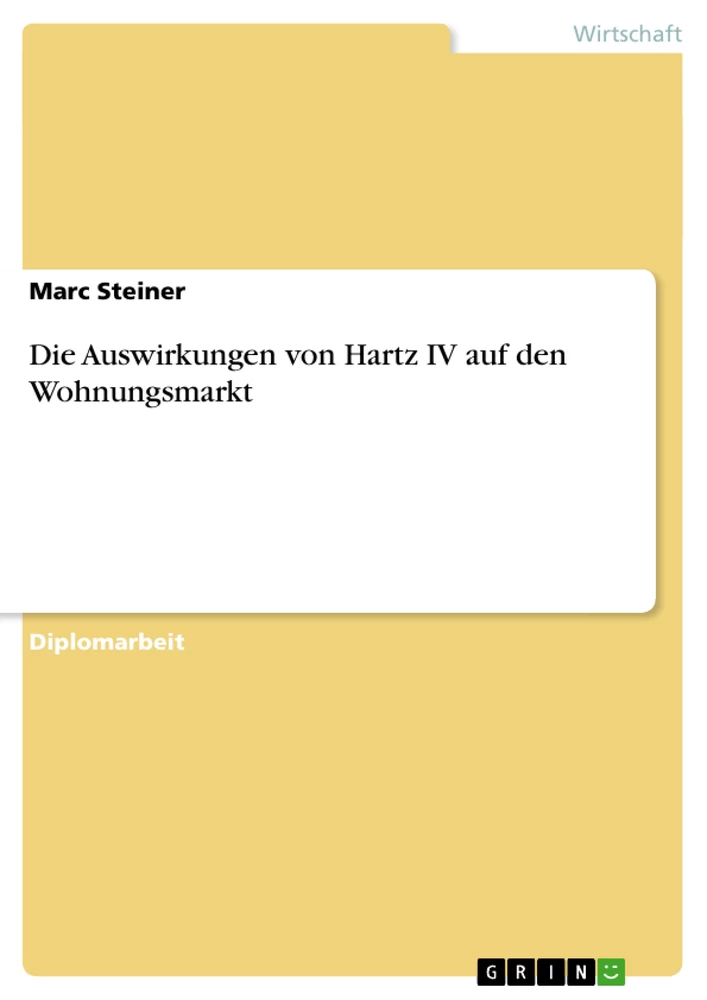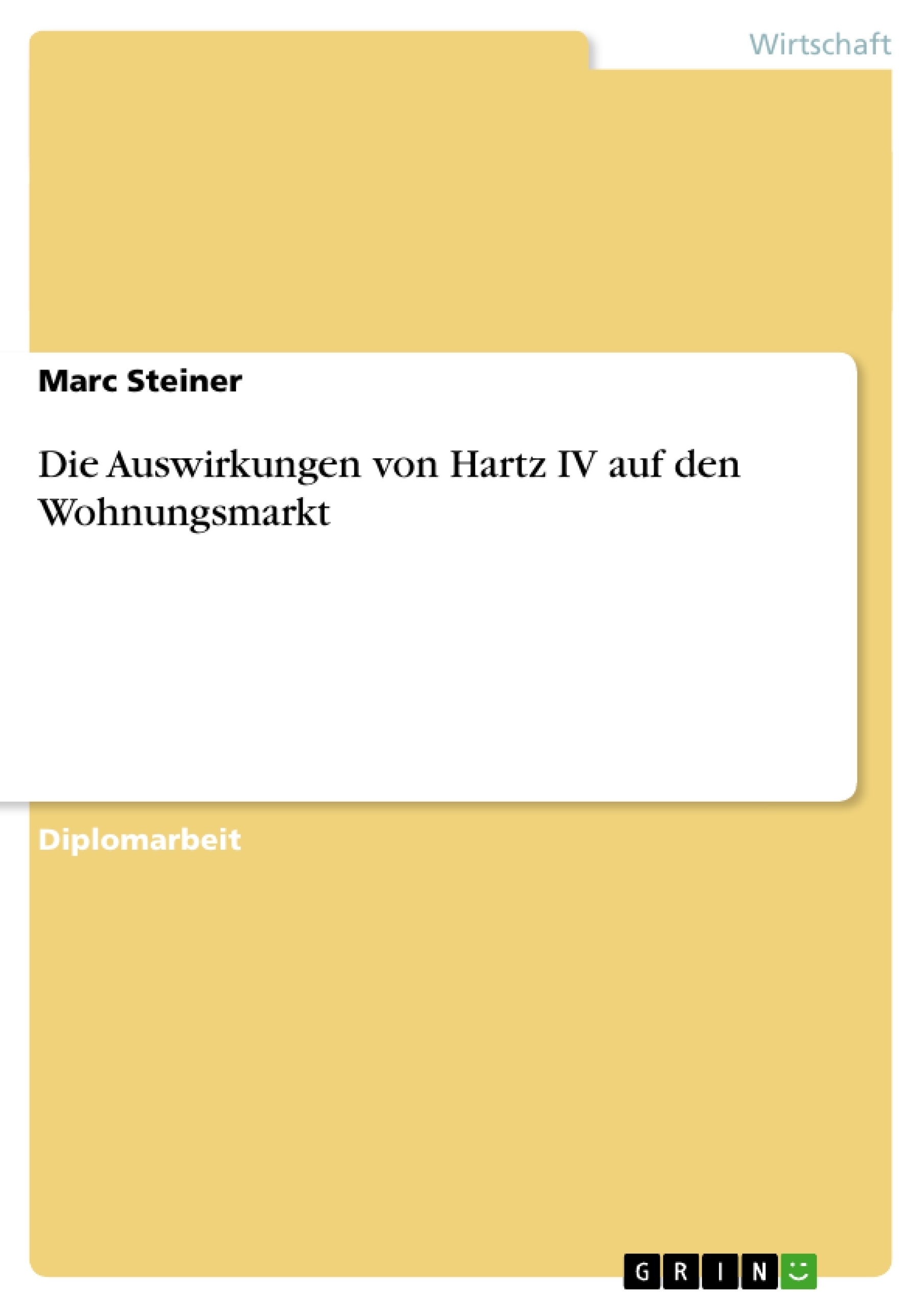Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Auswirkungen, die die Hartz-Reform,
speziell die vierte Stufe dieser Reform, auf den Wohnungsmarkt hat. Ziel dieser
Arbeit ist es, einen Gesamtüberblick über die für den Wohnungsmarkt relevanten
Punkte zu geben und daraus die Auswirkungen für den Wohnungsmarkt abzuleiten.
Daher ist die Arbeit in zwei Bereiche gegliedert: Der erste Teil beschäftigt sich mit der
gesetzlichen Grundlage, der zweite Abschnitt analysiert die Auswirkungen dieser
Reform auf den Wohnungsmarkt. Anschließend an den zweiten Abschnitt folgen kurz
ein paar Anregungen zur Bekämpfung der mit dieser Reform verbundenen Probleme.
Da es zu diesem Themengebiet, besonders zum zweiten Teil der Arbeit, noch kaum
Material gibt, werden durch eine schriftliche Expertenbefragung nach der DELPHIMethode verschiedene Auswirkungen und deren Lösungsmöglichkeiten
herausgearbeitet. Die Experten haben sich aufgrund ihrer Tätigkeit und ihres Knowhows für diese Befragung angeboten. Schlagworte: • Hartz IV, • Wohnungsmarkt, • SGB II, • Sozialgesetzbuch, • Alg-II-Empfänger
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Methodisches Vorgehen
- 2 Die Entwicklung am Wohnungs- und Arbeitsmarkt
- 2.1 Der Wohnungsmarkt in Deutschland
- 2.2 Die Lage auf dem Arbeitsmarkt
- 3 Rechtliche Grundlage von Hartz IV - SGB XII und SGB II
- 3.1 Rechtsanspruch auf Sozialhilfe nach SGB XII
- 3.1.1 Grundsätze der Sozialhilfe
- 3.1.2 Träger der Sozialhilfe
- 3.1.3 Überblick über die Sozialhilfeleistungen
- 3.1.3.1 Hilfe zum Lebensunterhalt - Kosten der Unterkunft
- 3.1.3.2 Hilfe zum Lebensunterhalt – Heizkosten
- 3.2 Rechtsanspruch auf Alg II nach SGB II
- 3.2.1 Leistungen nach SGB II
- 3.2.1.1 Alg II gemäß §§ 19 und 20 SGB II
- 3.2.1.2 Sozialgeld nach § 28 SGB II
- 3.2.1.3 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 3.2.1.3.1 Angemessenheit der Unterkunft
- 3.2.1.3.2 Zahlungsabwicklung nach § 22 SGB II
- 3.2.1.3.3 Kosten der Wohnraumbeschaffung
- 3.2.1.3.4 Wohneigentum
- 3.2.1.3.4 Kosten für die Instandhaltung und Heizung
- 3.2.2 Anrechenbare Einkommens- und Vermögenswerte
- 3.2.2.1 Einkommen
- 3.2.2.2 Vermögen
- 4 Konsequenzen für den Wohnungsmarkt
- 4.1 Zunahme der Nachfrage nach angemessenem Wohnraum
- 4.2 Zunahme der Umzüge
- 4.2.1 Notwendigkeit eines Umzugs
- 4.2.2 Kosten der Umzüge
- 4.2.3 Kosten für die Wohnungsbeschaffung und Mietkaution
- 4.2.4 Problem der Umzüge - Entstehung eines Ghettos - Obdachlosigkeit
- 4.2.5 Verlust sozialer Kontakte der Alg-II-Empfänger durch einen Umzug
- 4.3 Probleme bei Schönheitsreparaturen und Instandhaltungskosten
- 4.4 Thema Nebenkosten und Hartz IV
- 4.5 Unterschiedlich starke Auswirkungen auf kleine und große Wohnungsunternehmen
- 4.6 Unterschiedliche Auswirkungen im urbanen und im ländlichen Raum
- 4.7 Betrug im Zusammenhang mit Alg II am Beispiel Wohnungsmarkt Berlin
- 4.8 Diskriminierung bei Ablehnung eines „Alg-II-Mieter“
- 4.9 Weitere Probleme für Alg-II-Empfänger
- 4.9.1 Mietausgleich durch einen Ein-Euro-Job
- 4.9.2 Überschuldung / Mietschulden am Beispiel Berlin
- 4.10 Auswirkung der Demografie auf den Immobilienmarkt
- 5 Lösungsansätze
- 5.1 Analyse des Einzelfalles
- 5.2 Untervermietung von Wohnraum
- 5.3 Problemlösungsansätze bei Umzügen
- 5.3.1 Umzüge im Wohnungsbestand eines Vermieters
- 5.3.2 Wechsel in ein Wohnungsunternehmen im Nachbarort
- 5.4 Mitarbeit im Wohnungsunternehmen
- 5.5 Inanspruchnahme von Fördermittel
- 5.6 Senken der Regelleistung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Hartz-Reform, insbesondere der vierten Stufe, auf den deutschen Wohnungsmarkt. Das Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die für den Wohnungsmarkt relevanten Aspekte der Reform zu geben und daraus die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt abzuleiten.
- Analyse der rechtlichen Grundlagen von Hartz IV, insbesondere SGB XII und SGB II
- Untersuchung der Auswirkungen der Reform auf die Nachfrage nach Wohnraum
- Bewertung der Auswirkungen auf Umzüge, Mietkosten und Instandhaltung
- Identifizierung von Problemen für Alg-II-Empfänger im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt
- Entwicklung von Lösungsansätzen zur Bewältigung der Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil befasst sich mit der gesetzlichen Grundlage von Hartz IV, der zweite Teil analysiert die Auswirkungen der Reform auf den Wohnungsmarkt.
- Kapitel 1: Einführung in die Problemstellung und das methodische Vorgehen der Diplomarbeit.
- Kapitel 2: Analyse der Entwicklungen am Wohnungs- und Arbeitsmarkt, die den Kontext für die Reform bilden.
- Kapitel 3: Detaillierte Darstellung der rechtlichen Grundlage von Hartz IV, einschließlich der Leistungen nach SGB XII und SGB II.
- Kapitel 4: Analyse der Konsequenzen von Hartz IV für den Wohnungsmarkt, u.a. die Zunahme der Nachfrage nach angemessenem Wohnraum, die Auswirkungen auf Umzüge, die Probleme bei Schönheitsreparaturen und Instandhaltung sowie die Auswirkungen auf verschiedene Wohnungsunternehmen und Regionen.
- Kapitel 5: Präsentation von Lösungsansätzen für die Herausforderungen, die durch Hartz IV auf dem Wohnungsmarkt entstehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Hartz-Reform und ihren Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind:
- Hartz IV
- Wohnungsmarkt
- SGB II
- Sozialgesetzbuch
- Alg-II-Empfänger
- Quote paper
- Marc Steiner (Author), 2006, Die Auswirkungen von Hartz IV auf den Wohnungsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93053