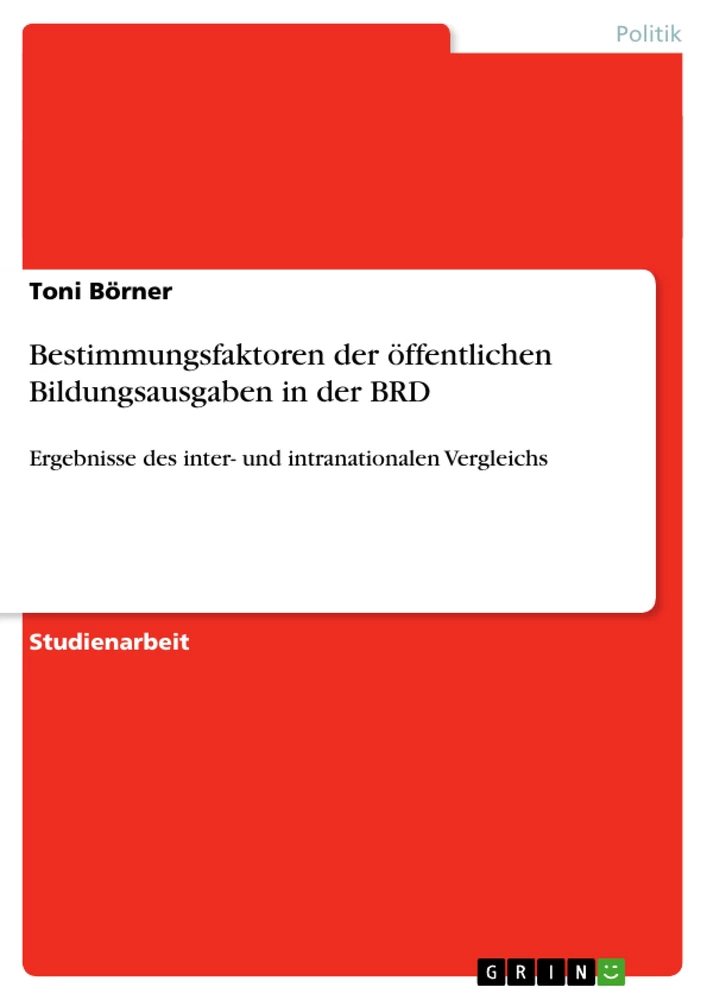Ende des Jahres 2003 rollte eine Schockwelle durch die deutsche Medienlandschaft. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der zweiten PISA-Studie rief ein allgemeines Echo der Empörung hervor. Schon seit der Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten PISA-Studie stand fest, dass das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich der Schülerleistungen nur unteres Mittelmaß ist . Zudem habe die Bundesrepublik „das unsozialste Schulsystem der Welt“, das unteren Schichten kaum Zugang zu höherer Bildung ermöglicht . PISA galt fortan als Verkörperung der deutschen Bildungsmisere. Sofort kam eine Debatte über die Reform des deutschen Schulwesens in Gang. Von der Abschaffung des 3-gliedrigen Systems bis hin zur flächendeckenden Einführung von Ganztagsschulen wurde alles erwogen.
Über die Höhe der öffentlichen Bildungsausgaben, die nach OECD-Untersuchungen ebenfalls unter dem OECD-Schnitt liegt , wurde jedoch weit weniger und vor allem weniger heftig diskutiert. Auch in der Politikwissenschaft gewinnt diese Thematik erst langsam an Bedeutung. Die lange Zeit von der Politikwissenschaft stiefmütterlich behandelten öffentlichen Bildungsausgaben spiegeln sich auch im Forschungsstand wider, der eher dürftig ausfällt. Zu nennen wäre für die 1990er Jahre der Industrieländervergleich von Castles (1998) und die Arbeiten von Heidenheimer . Nach der Jahrtausendwende nimmt die Zahl der Publikationen langsam zu. Schmidt verweist 2002 darauf, dass die öffentlichen Bildungsausgaben der Bundesrepublik unter dem Schnitt der EU- und auch unter dem Schnitt der OECD-Staaten liegen. Dem Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am BIP nach zu urteilen ist Deutschland also auch hier nur unteres Mittelmaß (Schmidt 2002). Ein breit angelegtes Forschungsprojekt über öffentliche Bildungsausgaben im inter- und intranationalen Vergleich beleuchtet Bestimmungsfaktoren von Bildungsausgaben in den OECD-Staaten (Schmidt u.a. 2006). Gerade der intranationale Vergleich erscheint in einem föderalen System, wie dem der Bundesrepublik, besonders ergiebig, da Bildung ausschließlich Sache der Bundesländer ist . Die Ausformung des Schulwesens und die Höhe der finanziellen Ausstattung variiert von Bundesland zu Bundesland. Daher muss gefragt werden, was eine gesamtdeutsche Betrachtung leisten kann und ob nicht ein Vergleich der einzelnen Bundesländer zu besseren Ergebnissen führt.
Im Rahmen dieser Arbeit soll daher der Frage nachgegangen werden, wie sich die Bildungsausgaben der einzelnen Bundesländer zueinander verhalten und wie man ihre teilweise beträchtliche Variation erklären kann. Anschließend soll anhand eines Bundeslandes nachgezeichnet werden, wie sich die Höhe der Bildungsausgaben zusammensetzt. Als Beispielland soll hier Thüringen dienen, da es in vielen untersuchten Bereichen eine Sonderstellung einnimmt, die es zu untersuchen gilt.
Um diese Ziele zu erreichen, wird diese Arbeit kurz auf gesamtdeutsche Befunde eingehen, die sich aus dem internationalen Vergleich her ableiten lassen (Kapitel 2). Danach soll der Blick nach innen gewendet werden, um die einzelnen Bundesländer miteinander zu vergleichen und Erklärungsansätze für die unterschiedliche Finanzausstattung der Bildungssysteme zu überprüfen (Kapitel 3). Abschließend soll untersucht werden, welche Eigenheiten das thüringische Bildungssystem aufweist, die seine Sonderstellung erklären können (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die öffentlichen Bildungsausgaben der Bundesrepublik im internationalen Vergleich
- 3. Vergleich der öffentlichen Bildungsausgaben der Bundesländer
- 4. Fallbeispiel Thüringen
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bestimmungsfaktoren der öffentlichen Bildungsausgaben in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Ausgaben im internationalen Vergleich, vergleicht die Ausgaben der einzelnen Bundesländer und beleuchtet die Besonderheiten des thüringischen Bildungssystems.
- Internationale Positionierung der deutschen Bildungsausgaben
- Variation der Bildungsausgaben zwischen den Bundesländern
- Einflussfaktoren auf die Höhe der Bildungsausgaben
- Sonderstellung des thüringischen Bildungssystems
- Zusammenhänge zwischen Bildungsausgaben und Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
2. Die öffentlichen Bildungsausgaben der Bundesrepublik im internationalen Vergleich
Dieses Kapitel beleuchtet die Positionierung der deutschen Bildungsausgaben im internationalen Kontext. Es werden die Ergebnisse von vergleichenden Studien zur Höhe der öffentlichen Bildungsausgaben in verschiedenen OECD-Staaten diskutiert. Dabei wird besonderes Augenmerk auf den Vergleich mit anderen Industrieländern gelegt.
3. Vergleich der öffentlichen Bildungsausgaben der Bundesländer
Dieses Kapitel analysiert die Variation der Bildungsausgaben zwischen den einzelnen Bundesländern. Es untersucht die Faktoren, die zu diesen Unterschieden führen, und analysiert mögliche Zusammenhänge zwischen den Bildungsausgaben und den Bildungsergebnissen in den verschiedenen Bundesländern.
4. Fallbeispiel Thüringen
Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse des thüringischen Bildungssystems. Es untersucht die Höhe der Bildungsausgaben in Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern und beleuchtet die Besonderheiten des thüringischen Schulsystems, die seine Sonderstellung erklären können.
Schlüsselwörter
Öffentliche Bildungsausgaben, Bundesländer, internationaler Vergleich, Bildungssystem, Bildungserfolg, Thüringen, PISA-Studie, OECD, Föderalismus, Finanzausgleich, Bildungsfinanzierung
Häufig gestellte Fragen
Wie stehen Deutschlands Bildungsausgaben im internationalen Vergleich da?
Gemessen am BIP liegen die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland oft unter dem OECD-Schnitt, was in der Arbeit als „unteres Mittelmaß“ kritisiert wird.
Warum variieren die Bildungsausgaben zwischen den Bundesländern?
Da Bildung in Deutschland Ländersache ist, führen unterschiedliche politische Schwerpunkte, finanzielle Möglichkeiten und Schulstrukturen zu beträchtlichen Variationen.
Welche Rolle spielte die PISA-Studie für die Bildungsdebatte?
Die PISA-Ergebnisse lösten eine Schockwelle aus und führten zu intensiven Diskussionen über Reformen wie Ganztagsschulen und die Struktur des Schulsystems.
Was ist die Besonderheit des Bildungssystems in Thüringen?
Thüringen nimmt in vielen untersuchten Bereichen eine Sonderstellung ein, die in der Arbeit detailliert als Fallbeispiel analysiert wird.
Haben höhere Bildungsausgaben direkten Einfluss auf den Erfolg?
Die Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen finanzieller Ausstattung und den tatsächlichen Schülerleistungen in den verschiedenen Bundesländern.
- Quote paper
- Toni Börner (Author), 2007, Bestimmungsfaktoren der öffentlichen Bildungsausgaben in der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93090