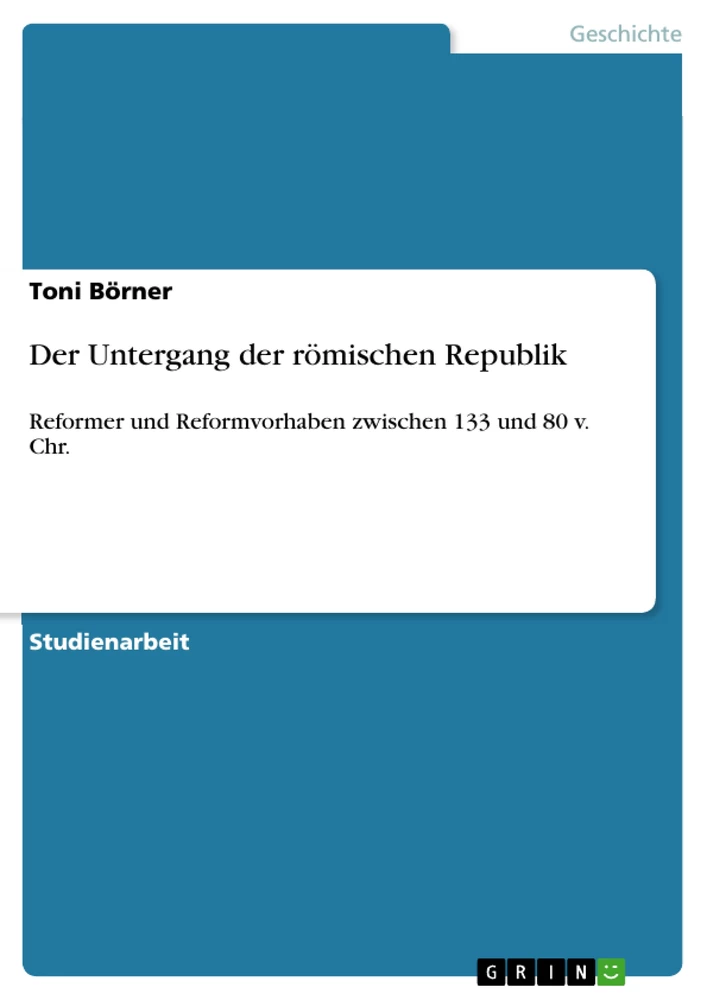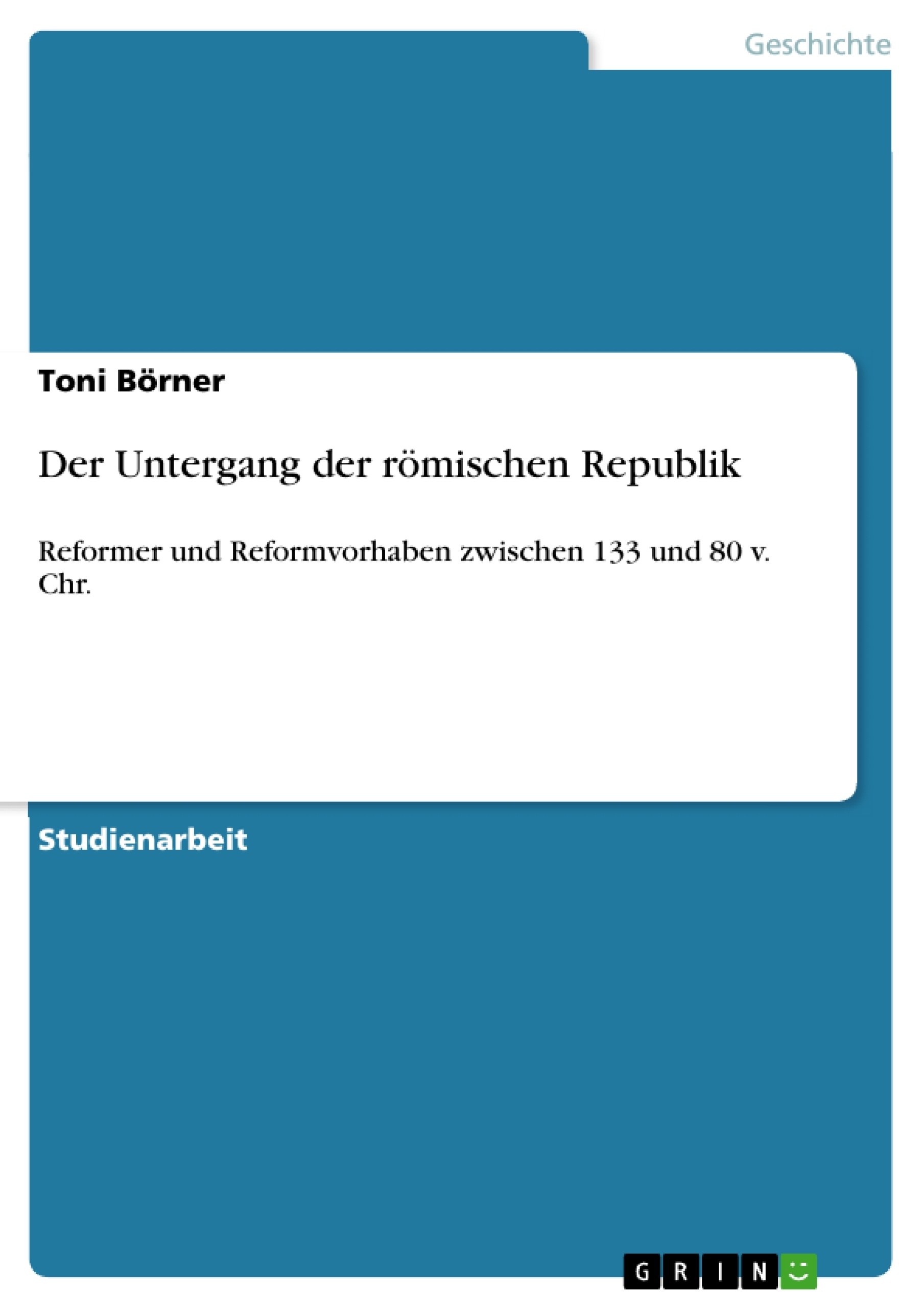Nach Valerius Maximus soll der Zensor des Jahres 142 v. Chr., P. Cornelius Scipio Aemilianus, das von den Zensoren alle vier Jahre verrichtete Gebet, „die Götter möchten den römischen Staat besser und größer machen“, dahingehend geändert haben, dass er dem das Gebet Vortragenden zurief: „Er ist mächtig und groß genug. So bitte ich die Götter nur darum, ihn für immer unversehrt zu erhalten“ (Val. Max. 4,1,10). In dieser neuen Formulierung wird deutlich, woran die römische Republik knapp 100 Jahre später scheitern wird: an ihrer Unreformierbarkeit. Denn in dem Bestreben, den Staat zu erhalten oder vielmehr: den Staat so zu erhalten wie er ist, werden alle Möglichkeiten zur Reform verbaut, wird jeder, der an den bestehenden Verhältnissen rüttelt, als Zerstörer des Staates angesehen. Nicht die großen Kriege gegen Karthago oder gegen die hellenistischen Großmächte, nicht die inneren Probleme Roms und auch nicht der Bundesgenossenkrieg sind die Ursachen für den Untergang der Republik gewesen. Sie waren eher Faktoren, die die Eroberung der Weltherrschaft, wie die Expansion des römischen Reiches zwischen 241 und 100 v. Chr. häufig genannt wird, mit sich brachte und die es erforderten, den Stadtstaat Rom an die gegebenen Verhältnisse anzupassen. So sind vor allem seit 133 v. Chr. immer wieder Reformer auf der politischen Bühne erschienen, die versuchten, den römischen Staat umzugestalten. Jedoch scheiterten fast alle Reformvorhaben bzw. verschärften die Krise derart, dass am Ende dieser Epoche die Republik scheiterte und seit Pompeius und konkret dann unter Caesar und Augustus die Herrschaft im Staat sich auf eine einzelne Person zentrierte und sich die Errichtung einer Monarchie im republikanischen Rom abzeichnete.
Im Rahmen dieser Arbeit wird zuerst auf die Hauptkonflikte im 2. Jahrhundert v. Chr. eingegangen, danach einzelne Reformer und Reformvorhaben genauer betrachtet und die Gründe für ihr scheitern analysiert. Beginnen wird diese Übersicht mit dem Volkstribunat des Tiberius Gracchus. Auch wenn in der neueren Forschung das Jahr 133 v. Chr. nicht mehr wie noch bei Mommsen als Epochenjahr angesehen, sondern vielmehr die Zeit nach dem 2. Pu-nischen Krieg gemeinsam betrachtet wird , scheint mir dieses Jahr für den Beginn der Betrachtung angemessen zu sein, da mit dem Volkstribunat des Tiberius die großen Reformen beginnen und die Zuspitzung der Missstände im Bereich der Agrarwirtschaft, der Eigentumsverhältnisse und des Militärapparates in den Mittelpunkt rückten. Enden wird die Darstellung mit der Diktatur Sullas und der „Wiederherstellung“ der Republik. Denn, und nun folgt die Betrachtung erneut der Epocheneinteilung Mommsens , nach Sulla war die republikanische Ordnung schon so weit gestört, dass von einem funktionierendem Staatsgebilde keine Rede mehr sein konnte und man von der „Begründung der Militärmonarchie“ sprechen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hauptkonflikte im 2. Jahrhundert vor Christi
- Die Reformer und ihre Reformvorhaben
- Tiberius Sempronius Gracchus
- Gaius Sempronius Gracchus
- Gaius Marius
- Livius Drusus
- Lucius Cornelius Sulla
- abschließende Betrachtung der Reformen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Untergang der römischen Republik im Kontext der Reformen zwischen 133 und 80 v. Chr. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Ursachen des Scheiterns der Republik zu untersuchen und die Rolle von Reformen und Reformern in diesem Prozess zu beleuchten.
- Die Folgen des 2. Punischen Krieges für die römische Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Entstehung der Agrarkrise und die Probleme der Landverteilung
- Die Reformversuche der Gracchen und ihre Auswirkungen
- Die militärische Krise und die Reform des Heeres durch Gaius Marius
- Die Rolle von Lucius Cornelius Sulla und der Beginn der "Militärmonarchie"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert die Problematik der Unreformierbarkeit der römischen Republik und die Bedeutung der Reformen im Prozess des Untergangs.
- Die Hauptkonflikte im 2. Jahrhundert vor Christi: Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen des 2. Punischen Krieges für die römische Wirtschaft und Gesellschaft. Es zeigt die Entstehung der Agrarkrise und die zunehmende Konzentration des Landbesitzes in den Händen weniger Großgrundbesitzer auf.
- Die Reformer und ihre Reformvorhaben: Die Kapitel 3.1 - 3.6 behandeln die Reformversuche verschiedener Persönlichkeiten wie Tiberius und Gaius Gracchus, Gaius Marius, Livius Drusus und Lucius Cornelius Sulla. Die Zusammenfassung der jeweiligen Kapitel konzentriert sich auf die Ziele und Maßnahmen der Reformer sowie auf die Gründe für deren Scheitern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des Untergangs der römischen Republik, darunter die Agrarkrise, die Reformbewegungen der Gracchen, die militärische Entwicklung und die Entstehung der "Militärmonarchie". Die zentralen Begriffe sind Agrarwirtschaft, Landverteilung, Volkstribunat, Heerreform, Bürgerkrieg und Diktatur.
- Quote paper
- Toni Börner (Author), 2004, Der Untergang der römischen Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93092