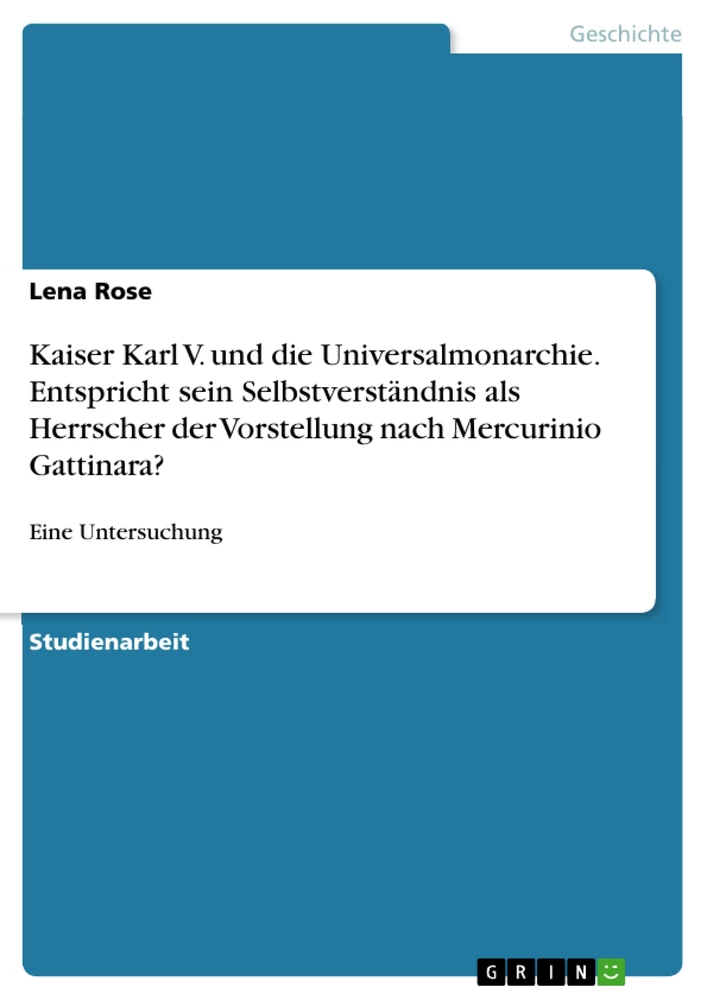Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit folgender Forschungsfrage: Inwiefern findet sich in Karls V. Selbstverständnis als Herrscher die Vorstellung eines Universalmonarchen nach Mercurinio Gattinara wieder?
Zu deren Untersuchung wird zunächst die Bedeutung, welche dem Begriff der "Universalmonarchie" im Einzelnen und zur Zeit Karls V. im Besonderen zukommt, betrachtet und identifiziert was einen Universalmonarchen letztendlich charakterisiert. Im Fokus der Betrachtung steht dabei vor allem der Entwurf der Universalmonarchie nach Marcurinio Gattinara.
Anschließend wird das Selbstverständnis Karls V. und dessen damit verbundenes Regierungskonzept fokussiert. Wie präsentierte sich Karl V. zu seiner Wahl zum römisch-deutschen Kaiser 1519 und welche Anschauung hatte er von sich selbst zur Zeit seines Herrschaftshöhepunktes 1548, ferner wie trat dieser am Ende seiner Regierung 1555 auf? Im Fokus der Betrachtung steht dabei vor allem letzteres und die damit verbundene Abdankungsrede. Schlussendlich kann die Forschungsfrage ermittelt werden, inwiefern sich in Karls V. Selbstverständnis als Herrscher die Vorstellung eines Universalmonarchen wiederfindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Universalmonarchie
- Mittelalterliche Grundlagen und eine traditionelle Kaiseridee
- Universalmonarchie zur Zeit Karls V.
- Die Universalmonarchie nach Mercurinio Gattinara
- Ein Universalmonarch bei Mercurinio Gattinara
- Selbstverständnis Karls V.
- Karl V.: Leben, Regentschaft und Abdankung.
- Karls V. Selbstverständnis als Herrscher
- Inwiefern findet sich in Karls V. Selbstverständnis als Herrscher die Vorstellung eines Universalmonarchen nach Mercurinio Gattinara wieder?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Selbstverständnis Karls V. als Herrscher und untersucht, inwiefern seine Vorstellung von Herrschaft mit der zeitgenössischen Idee der Universalmonarchie übereinstimmt, insbesondere mit dem Konzept von Mercurinio Gattinara. Die Arbeit analysiert die Entstehung des Begriffs der Universalmonarchie und deren mittelalterliche Wurzeln, beleuchtet Gattinaras Entwurf der Universalmonarchie und untersucht, inwieweit diese Vorstellung Karls V. beeinflusste.
- Die Bedeutung der Universalmonarchie im 16. Jahrhundert
- Das Selbstverständnis Karls V. als Herrscher
- Der Einfluss von Mercurinio Gattinara auf Karls V. Herrschaftsverständnis
- Das Verhältnis von mittelalterlicher Tradition und neuzeitlichen Entwicklungen
- Die Rolle der Universalmonarchie in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein und stellt den historischen Kontext sowie die Relevanz des Themas dar. Sie erläutert die Bedeutung Karls V. für die Geschichte und seine Rolle im Wandel vom mittelalterlichen Herrschaftspluralismus zur modernen Staatsform.
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff der Universalmonarchie im Kontext der mittelalterlichen Traditionen und präsentiert die verschiedenen Vorstellungen von Universalmonarchie im 15. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorstellung der Universalmonarchie von Mercurinio Gattinara, dem ersten und letzten Großkanzler Karls V.
Das zweite Kapitel fokussiert sich auf das Selbstverständnis Karls V. als Herrscher, seine Lebensgeschichte und die Entwicklung seiner Herrschaftskonzeption. Es wird untersucht, wie Karl V. sich in unterschiedlichen Phasen seiner Regierung präsentierte, insbesondere in seiner Abdankungsrede.
Schlüsselwörter
Universalmonarchie, Karl V., Mercurinio Gattinara, Mittelalter, Neuzeit, Herrschaftsverständnis, Selbstverständnis, Reformation, Abdankung, Geschichte, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was verstand man unter einer "Universalmonarchie" zur Zeit Karls V.?
Es war die Idee eines christlichen Gesamtherrschers, der über den nationalen Königen steht und die Christenheit gegen äußere Feinde (wie das Osmanische Reich) eint.
Welchen Einfluss hatte Mercurinio Gattinara auf Karl V.?
Gattinara, Karls Großkanzler, entwarf das Konzept der Universalmonarchie und sah in Karl V. den rechtmäßigen Nachfolger der römischen Kaiser zur Führung der Welt.
Entsprach Karls Selbstverständnis dieser Vision?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Karl V. diese imperiale Rolle annahm oder ob er sich eher als Verteidiger des Glaubens in einer zerbrechenden politischen Ordnung sah.
Was sagt die Abdankungsrede von 1555 über sein Herrschaftsverständnis aus?
In seiner Rede blickt Karl V. auf ein Leben voller Reisen und Kriege zurück. Sie verdeutlicht seine Erschöpfung und das Scheitern der Idee einer geeinten Universalmonarchie angesichts der Reformation.
Warum ist Karl V. eine Schlüsselfigur zwischen Mittelalter und Neuzeit?
Er war der letzte Kaiser, der ernsthaft versuchte, den mittelalterlichen Gedanken der Universalherrschaft in einer Zeit aufstrebender Nationalstaaten und religiöser Spaltung umzusetzen.
- Quote paper
- Lena Rose (Author), 2019, Kaiser Karl V. und die Universalmonarchie. Entspricht sein Selbstverständnis als Herrscher der Vorstellung nach Mercurinio Gattinara?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/931346