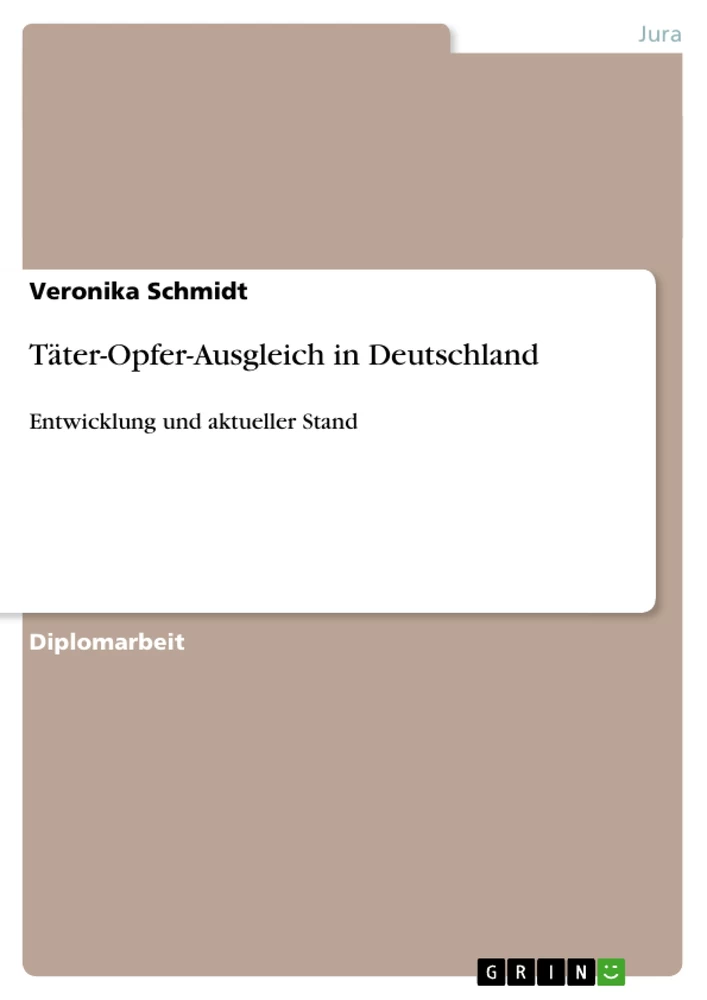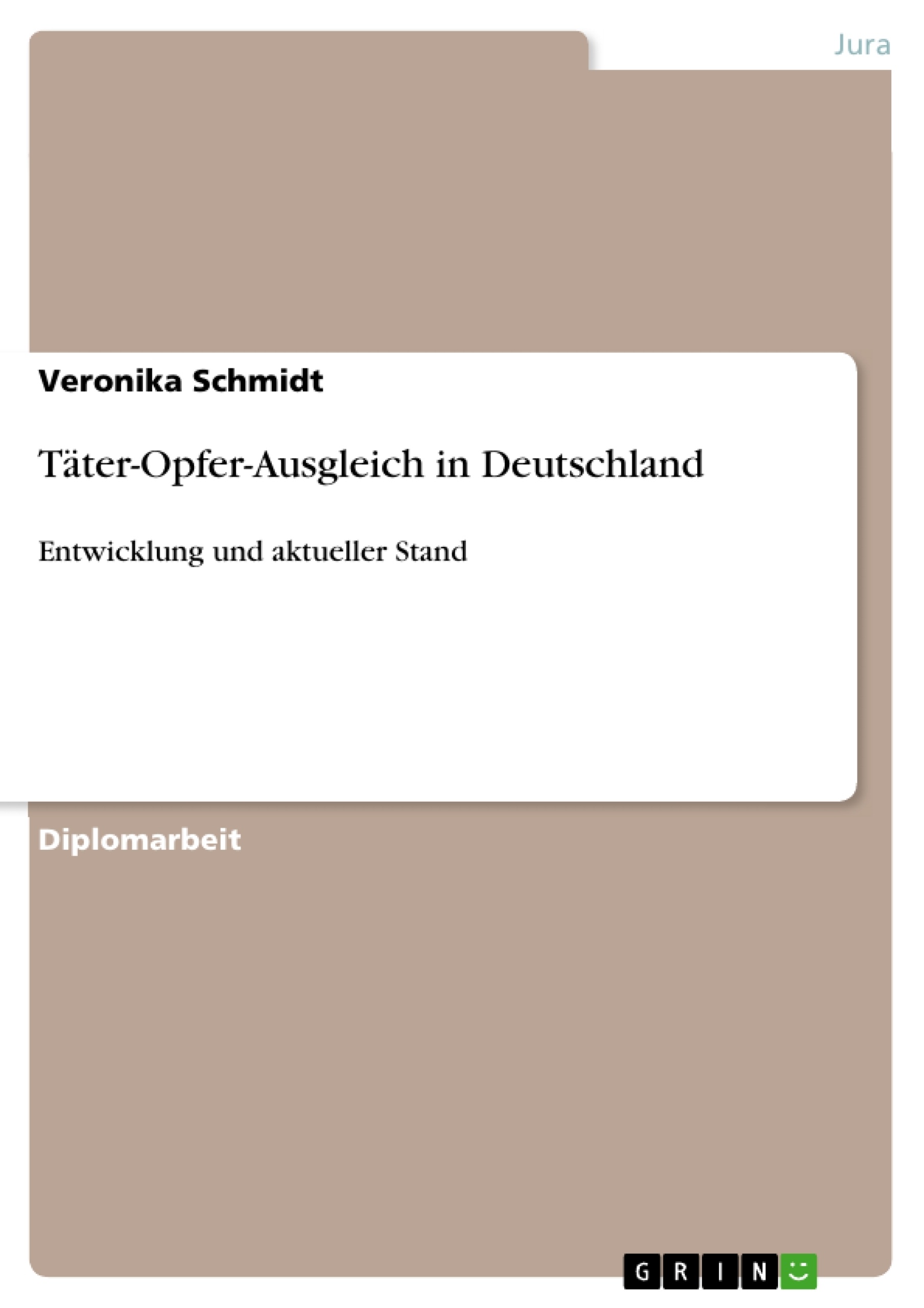Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) als Alternative zur traditionellen Strafrechtspraxis in Deutschland.
Ziel ist, den Täter-Opfer-Ausgleich in seiner heutigen Form praktisch und menschlich möglichst umfassend zu beschreiben und seine rechtliche Verankerung aufzuzeigen. Die praktische Durchführung und die menschlichen Hintergründe sind hierbei wie ein roter Faden der sich durch die ganze Arbeit zieht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Täter- und Opferrolle und ihrer Bedeutung im Täter-Opfer-Ausgleich im Gegensatz zum herkömmlichen Gerichtsverfahren. Auch die Rolle des Mediators wird entsprechend behandelt in Bezug auf die an ihn gestellten Anforderungen, seine Ausbildung und sein Rollenverständnis. Auch eingegangen wird auf das Zusammenspiel von Täter-Opfer-Ausgleichsstellen mit den gesetzlichen Stellen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Die Vorteile des Täter-Opfer-Ausgleichs und seine Möglichkeiten, sich positiv auf den Rechtsfrieden auszuwirken werden dargestellt, ebenso die Einwände gegen den Täter-Opfer-Ausgleich. Auch wird geklärt, warum der Täter-Opfer-Ausgleich trotz guter Aussichten und gesetzlicher Legitimierung immer noch so wenig praktische Durchführung findet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition Täter-Opfer-Ausgleich
- 2.1 Definition TOA mit Hilfe des Begriffs Mediation
- 2.2 Aussage des Begriffs „Täter-Opfer-Ausgleich“
- 2.3 Definition TOA mit Hilfe von sinnverwandten Begriffen
- 2.3.1 TOA und Konfliktschlichtung
- 2.3.2 (Schadens-)Wiedergutmachung
- 2.3.3 Versöhnung
- 2.3.4 Diversion
- 2.4 Definition TOA mit Hilfe von Gesetzestexten
- 2.5 Definition TOA aus dem Lehrbuch
- 3 Die Geschichtliche Entwicklung des TOA
- 4 Zielsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- 4.1 Täterorientierte Ziele
- 4.2 Opferorientierte Ziele
- 4.3 Ziele für die Justiz
- 4.4 Allgemeine Ziele
- 5 Rechtsgrundlagen
- 5.1 Erwachsenenstrafrecht
- 5.1.1 Die Voraussetzungen des § 46a Nr. 1 StGB
- 5.1.2 Die Voraussetzungen des § 46a Nr. 2 StGB
- 5.1.3 Die Rechtsfolgen des § 46a StGB
- 5.1.4 Weitere gesetzliche Verankerungen des TOAs
- 5.2 Jugendstrafrecht
- 5.1 Erwachsenenstrafrecht
- 6 Voraussetzungen für die Anwendung eines TOA
- 6.1 Formale Voraussetzungen
- 6.2 Eignung von Fällen
- 6.3 Entscheidungsstellen über die Eignung
- 7 Formaler Ablauf des TOA in einer Ausgleichsstelle
- 7.1 Die Vorgespräche
- 7.1.1 Vorgespräch mit dem Täter
- 7.1.2 Vorgespräch mit dem Opfer
- 7.2 Das Ausgleichsgespräch zwischen den Beteiligten
- 7.2.1 Die Einstiegsphase
- 7.2.2 Die Hauptphase
- 7.2.3 Die Abschlussphase
- 7.3 Die Umsetzungsphase
- 7.1 Die Vorgespräche
- 8 Die Rolle des Vermittlers
- 8.1 Die Ausbildung des Mediators
- 8.2 Das Rollenverständnis des Mediators
- 8.3 Möglichkeiten der Intervention
- 8.4 Die Auswirkung des Zweitberufs des Mediators
- 8.5 Der Mediator und die richtige Atmosphäre
- 8.6 Hemmnisse des Mediators
- 8.6.1 Konflikte
- 8.6.2 Widerstände
- 8.6.3 Konsistenz
- 8.6.4 Denkblockaden
- 8.7 Methoden des Mediators
- 8.7.1 Differenziertes Fragen
- 8.7.2 Zusammenfassen und Fokussieren
- 8.7.3 Normalisieren, Zukunftsorientieren und Paraphrasieren
- 9 Finanzierung
- 10 Servicebüro Täter-Opfer-Ausgleich
- 11 Einwände gegen den TOA
- 11.1 Einwände aus rechtsstaatlicher Sicht
- 11.2 Nachteile für das Opfer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) in Deutschland, seine praktische Anwendung und seine rechtliche Grundlage. Ziel ist eine umfassende Beschreibung des TOA, inklusive der Rolle von Tätern, Opfern und Mediatoren.
- Definition und Abgrenzung des TOA zu ähnlichen Konzepten
- Rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen für die Anwendung des TOA
- Der Ablauf eines TOA-Verfahrens und die Rolle des Mediators
- Vorteile und Nachteile des TOA
- Gründe für die geringe praktische Anwendung des TOA trotz gesetzlicher Legitimierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die praktische und menschliche Seite des TOA sowie seine rechtliche Verankerung. Sie hebt die Bedeutung der Täter- und Opferrolle und die Rolle des Mediators hervor.
2 Definition Täter-Opfer-Ausgleich: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen des TOA. Es betrachtet den TOA im Kontext von Mediation, Konfliktschlichtung, Wiedergutmachung, Versöhnung und Diversion. Verschiedene Gesetzestexte und Lehrbücher werden herangezogen, um ein umfassendes Verständnis der Begrifflichkeit zu schaffen.
3 Die Geschichtliche Entwicklung des TOA: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des TOA in Deutschland, seine Entstehung und seine allmähliche Akzeptanz innerhalb des Strafrechtsystems. Es analysiert die Faktoren, die zu seiner Entwicklung beigetragen haben.
4 Zielsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs: Hier werden die verschiedenen Ziele des TOA aus den Perspektiven des Täters, des Opfers und der Justiz detailliert analysiert. Es werden sowohl die individuellen als auch die gesellschaftlichen Ziele des TOA beleuchtet.
5 Rechtsgrundlagen: Dieses Kapitel behandelt die gesetzlichen Grundlagen des TOA im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht. Es beschreibt die Voraussetzungen für die Anwendung des TOA gemäß § 46a StGB und weitere relevante gesetzliche Bestimmungen.
6 Voraussetzungen für die Anwendung eines TOA: Hier werden die formalen Voraussetzungen für die Anwendung eines TOA und die Kriterien zur Eignung von Fällen detailliert erläutert. Die Rolle der Entscheidungsstellen bei der Beurteilung der Eignung von Fällen wird ebenfalls diskutiert.
7 Formaler Ablauf des TOA in einer Ausgleichsstelle: Dieses Kapitel beschreibt den formalen Ablauf eines TOA-Verfahrens in einer Ausgleichsstelle. Es umfasst detaillierte Informationen zu den Vorgesprächen mit Täter und Opfer, dem Ausgleichsgespräch und der Umsetzungsphase. Die einzelnen Phasen des Ausgleichsgesprächs werden eingehend erklärt.
8 Die Rolle des Vermittlers: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle des Mediators im TOA. Es behandelt die Ausbildung, das Rollenverständnis, mögliche Interventionsmethoden und die Herausforderungen, denen ein Mediator gegenübersteht. Die Bedeutung einer richtigen Atmosphäre und Methoden wie differenziertes Fragen, Zusammenfassen und Paraphrasieren werden detailliert analysiert.
9 Finanzierung: Das Kapitel beschreibt die Finanzierung von TOA-Stellen und -Programmen. Es analysiert die verschiedenen Finanzierungsmodelle und deren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von TOA-Dienstleistungen.
10 Servicebüro Täter-Opfer-Ausgleich: Hier wird die Funktion und Organisation von Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich detailliert dargestellt. Die Rolle dieser Büros als zentrale Anlaufstelle und ihr Beitrag zur Organisation und Durchführung von TOA-Verfahren wird analysiert.
11 Einwände gegen den TOA: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit den Einwänden gegen den TOA, sowohl aus rechtsstaatlicher Sicht als auch aus der Perspektive der Opfer. Es wägt die Argumente ab und analysiert deren Relevanz.
Schlüsselwörter
Täter-Opfer-Ausgleich, TOA, Mediation, Konfliktlösung, Wiedergutmachung, Versöhnung, Strafrecht, Jugendstrafrecht, § 46a StGB, Mediator, Opfer, Täter, Rechtsfrieden, Rechtsgrundlagen, praktische Durchführung.
Häufig gestellte Fragen zum Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Täter-Opfer-Ausgleich?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) in Deutschland. Sie behandelt die Definition und Abgrenzung des TOA zu ähnlichen Konzepten, die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen, den Ablauf eines TOA-Verfahrens, die Rolle des Mediators, die Vor- und Nachteile sowie Gründe für die geringe praktische Anwendung. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist ein Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)?
Der TOA ist ein Verfahren, das darauf abzielt, zwischen Tätern und Opfern von Straftaten einen Ausgleich zu schaffen. Er wird definiert im Kontext von Mediation, Konfliktschlichtung, Wiedergutmachung, Versöhnung und Diversion und stützt sich auf gesetzliche Grundlagen (§ 46a StGB). Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Welche Ziele verfolgt der TOA?
Der TOA verfolgt verschiedene Ziele für Täter, Opfer und die Justiz. Für Täter kann es um Reue, Wiedergutmachung und die Vermeidung weiterer Straftaten gehen. Für Opfer stehen oft der Ausgleich von Schäden, die Aufarbeitung des Erlebten und die Wiederherstellung von Gerechtigkeit im Vordergrund. Die Justiz erhofft sich durch den TOA eine Entlastung und eine höhere Effizienz.
Wie läuft ein TOA-Verfahren ab?
Ein TOA-Verfahren umfasst Vorgespräche mit Täter und Opfer, ein Ausgleichsgespräch mit verschiedenen Phasen (Einstieg, Haupt- und Abschlussphase) und eine Umsetzungsphase. Der Ablauf wird detailliert in der Arbeit beschrieben. Ein Mediator spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielt der Mediator im TOA?
Der Mediator ist eine neutrale Person, die das Gespräch zwischen Täter und Opfer leitet und unterstützt. Seine Ausbildung, sein Rollenverständnis und seine Interventionsmethoden sind entscheidend für den Erfolg des Verfahrens. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen für den Mediator und beschreibt hilfreiche Methoden.
Welche rechtlichen Grundlagen hat der TOA?
Die rechtlichen Grundlagen des TOA sind im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht verankert, insbesondere in § 46a StGB. Die Arbeit beschreibt die Voraussetzungen für die Anwendung des TOA gemäß diesem Paragraphen und weitere relevante gesetzliche Bestimmungen.
Welche Voraussetzungen müssen für einen TOA erfüllt sein?
Es gibt formale Voraussetzungen für die Durchführung eines TOA und Kriterien zur Eignung der Fälle. Die Entscheidung über die Eignung eines Falles für ein TOA-Verfahren wird von entsprechenden Stellen getroffen. Die Arbeit beschreibt diese Voraussetzungen und Kriterien detailliert.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für den TOA?
Die Arbeit beschreibt die Finanzierung von TOA-Stellen und -Programmen und analysiert verschiedene Finanzierungsmodelle und deren Auswirkungen auf Verfügbarkeit und Zugänglichkeit.
Welche Einwände gibt es gegen den TOA?
Die Arbeit diskutiert kritische Einwände gegen den TOA, sowohl aus rechtsstaatlicher Sicht als auch aus der Opferperspektive, und analysiert deren Relevanz.
Wo finde ich mehr Informationen über Servicebüros für den Täter-Opfer-Ausgleich?
Die Arbeit beschreibt die Funktion und Organisation von Servicebüros für Täter-Opfer-Ausgleich und deren Rolle als zentrale Anlaufstellen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des TOA?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Täter-Opfer-Ausgleich, TOA, Mediation, Konfliktlösung, Wiedergutmachung, Versöhnung, Strafrecht, Jugendstrafrecht, § 46a StGB, Mediator, Opfer, Täter, Rechtsfrieden, Rechtsgrundlagen, praktische Durchführung.
- Citar trabajo
- Veronika Schmidt (Autor), 2007, Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93140