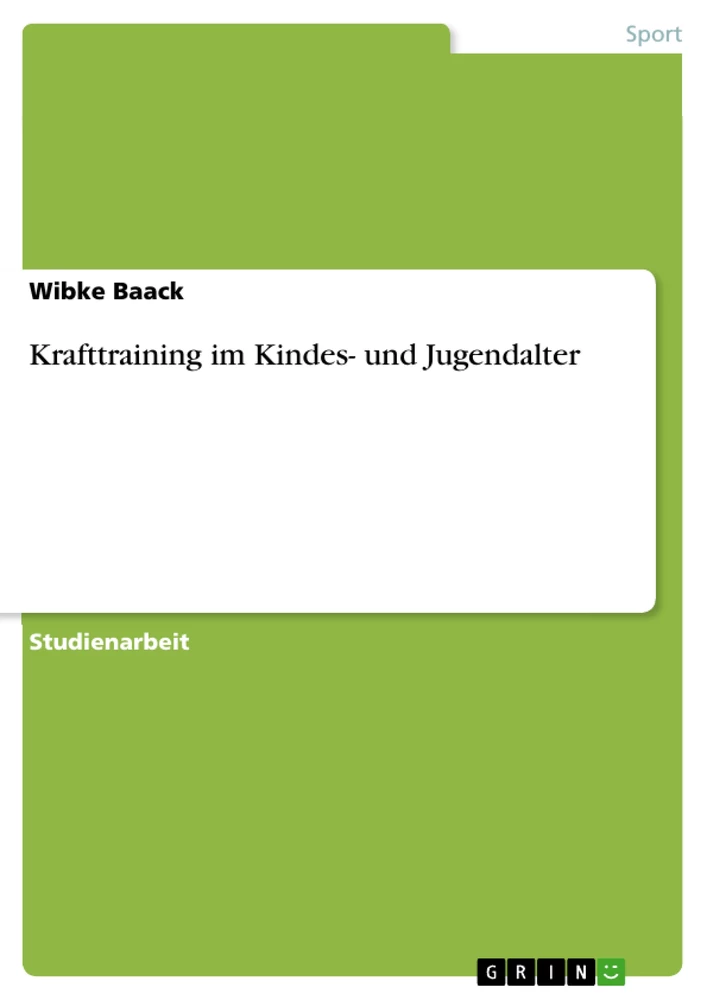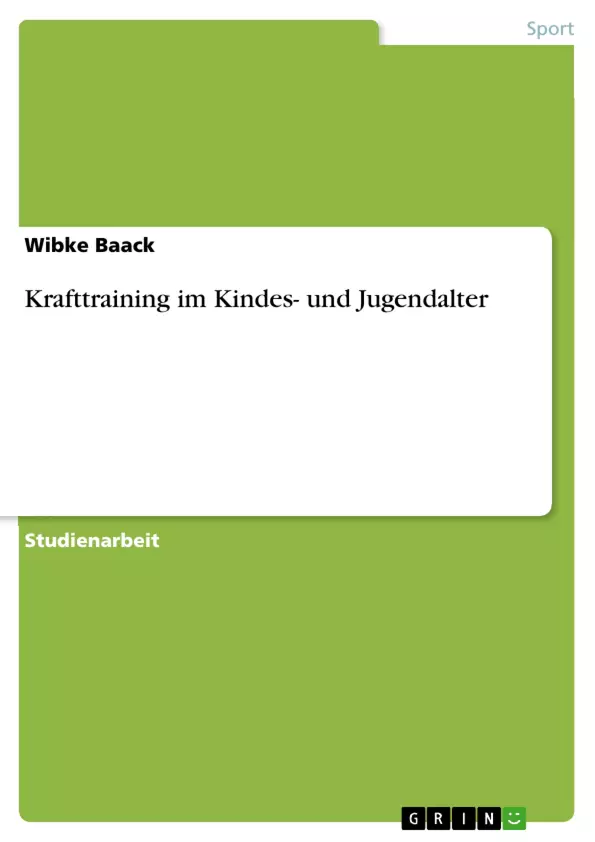Spricht man vom Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen, ist jedoch weder Bodybuilding noch Gewichtheben oder das so genannte „Power-Lifting“ gemeint. Die spezielle Form des Krafttrainings für Kinder und Jugendliche resultiert insbesondere aus deren altersspezifischen, physiologischen Voraussetzungen. Dabei stehen einerseits die Trainierbarkeit der Muskulatur und andererseits die Vermeidung der Schädigung des passiven Bewegungsapparates im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
1. Krafttraining
1.1 Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen – Definition
1.2 Bedingungsfaktoren der Kraft .
2. Physiologische Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen
2.1 Muskeln
2.1.1 Muskelfaserzusammensetzung
2.1.2 Muskelwachstum
2.1.3 Inter- und Intramuskuläre Koordination
2.1.4 Stoffwechsel des Muskels
2.2 Knochen
2.2.1 Knochenwachstum
2.2.2 Arten von Knochenschädigungen und deren Folgen
2.3 Weitere physiologischen Besonderheiten des kindlichen bzw. jugendlichen Organismus
3. Auswirkungen des Krafttrainings im Kindes- und Jugendalter .
4. Risiken des Krafttrainings im Kindes- und Jugendalter
5. Grundsätze zur Methodik des Krafttrainings im Kindes- und Jugendalter
6. Quellenverzeichnis
1. Krafttraining
1.1 Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen – Definition
Allgemein wird Krafttraining als ein Sammelbegriff verstanden, der im übergeordneten Sinne eine Trainingsart mit dem generellen Ziel der Verbesserung der Kraftfähigkeit (Maximalkraft, Schnellkraft und Kraftausdauer) beschreibt.[1]
Spricht man vom Krafttraining mit Kindern und Jugendliche, ist jedoch weder Bodybuilding noch Gewichtheben oder das so genannte „Power-Lifting“ gemeint.[2] Die spezielle Form des Krafttrainings für Kinder und Jugendlichen resultiert insbesondere aus deren altersspezifischen, physiologischen Voraussetzungen. Dabei stehen einerseits die Trainierbarkeit der Muskulatur und andererseits die Vermeidung der Schädigung des passiven Bewegungsapparates im Vordergrund.
1.2 Bedingungsfaktoren der Kraft
Um die Wertigkeit eines Krafttrainings mit Kindern und Jugendlichen zu verstehen, ist es hilfreich sich zu vergegenwärtigen, durch welche Faktoren die Kraftentfaltung bedingt ist. Neben des physiologischen Muskelquerschnitts und der Länge der Muskeln spielen die Muskelfaserzusammensetzung und insbesondere die inter- und intramuskuläre Koordination eine entscheidende Rolle.[3]
Kraft erscheint als Kraftausdauer, Maximalkraft und Schnellkraft. Jeder Erscheinungsform liegen andere biologische Bedingungen zugrunde, die der folgenden Tabelle zu entnehmen sind:[4]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Bedingungsfaktoren der Erscheinungsformen der Kraft[5]
2. Physiologische Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen
Wie bereits unter 1.1 erwähnt, müssen sowohl die alterspezifischen Bedingungen hinsichtlich der Muskulatur als auch des passiven Bewegungsapparates – insbesondere der Knochen - bei Konzeption eines Krafttrainings für Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden. Mit Beginn der Vorpubertät unterliegt der Körper einer hormonellen Veränderung. Das Testosteron hat insbesondere Einfluss auf das Muskel- und Knochenwachstum und impliziert geschlechtsspezifische Unterschiede.[6]
2.1 Muskeln
Anhand von Versuchsreihen leiten Hollmann / Hettinger ab, dass die Trainierbarkeit der Muskelkraft alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede aufweist: Obgleich ein Kräftezuwachs auch bei Kindern durch Krafttraining verzeichnet werden kann, besteht unterhalb des 8. – 10. Lebensjahres nur eine geringe Trainierbarkeit im Sinne der morphologischen Adaption. Mit zunehmendem Alter steigt die Trainierbarkeit des männlichen Jugendlichen rapide an, die des weiblichen Jugendlichen auch, aber langsamer.[7]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.1 Muskelfaserzusammensetzung
Die menschlichen Skelettmuskeln bestehen aus unterschiedlichen Muskelfaserarten. Allgemein wird zwischen schnellen Muskelfasern (FT- oder Typ2-Fasern) und langsamen Muskelfasern (ST- oder Typ1-Fasern) unterschieden.[8] Man schätzt, dass die Muskelfaserzusammensetzung zu ungefähr 70% genetisch bestimmt ist und nur etwa 30% beeinflussbar sind.[9] Weil durch gezieltes Training nur geringfügig die Qualität der Muskelfaserzusammensetzung veränderbar ist, liegt die Hauptbedeutung eines speziellen Trainings nicht in der Umwandlung von Muskelfasertypen, sondern in der Vergrößerung des Querschnitts und damit der Oberfläche einer Muskelfaserart.[10] Da im Kindesalter keine Muskelbiopsien durchgeführt werden, gibt es keinen Aufschluss über trainingsinduzierte Umwandlungen der Muskelfasern im Kindesalter.[11]
[...]
[1] http://aesk.de/SHAE/200107/h017055a.htm, S.1; (Im Folgenden: Siewers)
[2] vgl. Siewers, S.1 und vgl. http://www.sgsm.ch/ssms_publication/file/260/Krafttraining_2.07-5.pdf, S.1; (Im Folgenden: Menzi et al.)
[3] vgl. Menzi et al., S. 1
[4] vgl. http://www.im.nrw.de/sspo/doks/tf/w_03/kraftdiagnostik.pdf, S.1
[5] vgl. http://www.im.nrw.de/sspo/doks/tf/w_03/kraftdiagnostik.pdf
[6] vgl. Siewers, S.2
[7] vgl. Hollmann / Hettinger: Sportmedizin – Grundlagen für Arbeit, Training und Präventionsmedizin, Schattauer Verlag, Stuttgart 2000, S. 225; (Im Folgenden: Hollmann / Hettinger)
[8] vgl. Hollmann / Hettinger, S. 46
[9] vgl. Menzi et al., S. 39
[10] vgl. Hollmann / Hettinger, S. 51
[11] vgl. Menzi et al., S.39
Häufig gestellte Fragen
Ist Krafttraining für Kinder dasselbe wie Bodybuilding?
Nein, Krafttraining im Kindes- und Jugendalter ist kein Bodybuilding oder Gewichtheben. Es ist eine spezielle Form des Trainings, die auf die physiologischen Voraussetzungen der Altersgruppe abgestimmt ist.
Ab welchem Alter ist Muskelkraft-Training effektiv trainierbar?
Unterhalb des 8. bis 10. Lebensjahres ist die Trainierbarkeit im Sinne einer morphologischen Anpassung (Muskelwachstum) gering. Mit Beginn der Vorpubertät steigt die Trainierbarkeit durch hormonelle Veränderungen rapide an.
Welche Risiken gibt es beim Krafttraining für Jugendliche?
Das Hauptrisiko liegt in der Schädigung des passiven Bewegungsapparates, insbesondere der noch wachsenden Knochen. Daher steht die Vermeidung von Überlastungsschäden im Vordergrund.
Welche Rolle spielt die Genetik bei der Muskelkraft?
Die Muskelfaserzusammensetzung ist zu etwa 70 % genetisch bestimmt. Training beeinflusst primär den Querschnitt der Fasern, nicht die grundlegende Zusammensetzung (Typ-1 vs. Typ-2 Fasern).
Welche Faktoren bedingen die Kraftentfaltung?
Neben dem Muskelquerschnitt sind die inter- und intramuskuläre Koordination sowie die Muskelfaserzusammensetzung entscheidende Faktoren für die Kraftfähigkeit.
- Quote paper
- Wibke Baack (Author), 2008, Krafttraining im Kindes- und Jugendalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93161