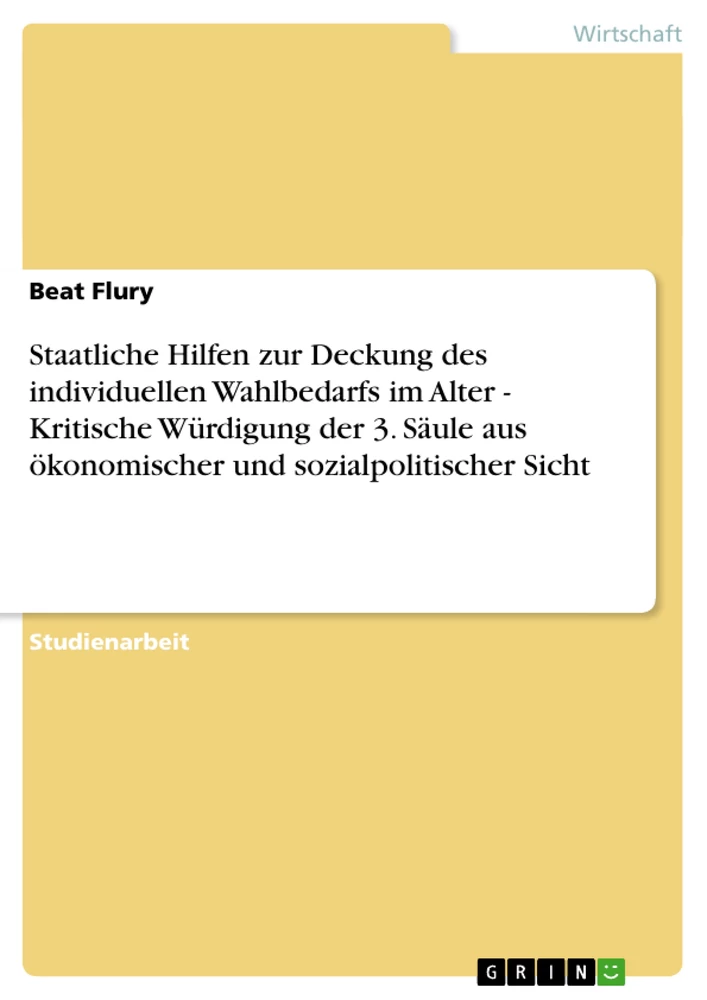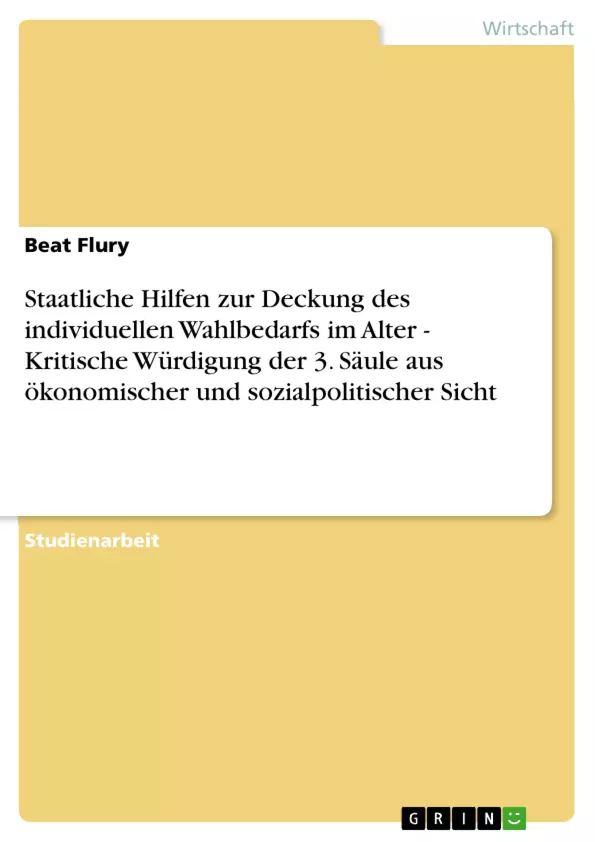Das Schweizerische Vorsorgesystem beruht auf dem sogenannten Drei-Säulen-Prinzip, welches 1972 in einer Volksabstimmung gutgeheissen wurde. Seither steht die erste Säule für die 1948 eingeführte AHV, die Invalidenversicherung (IV), der Erwerbsersatz während des Militärdienstes (EO), die Arbeitslosenversicherung (ALV) sowie die Unfallversicherung.
Erst 13 Jahre später kamen die zwei anderen Säulen dazu: die obligatorische berufliche Vorsorge und die individuelle Vorsorge. Die 2. Säule oder die berufliche Vorsorge soll die Fortsetzung der bisherigen Lebenshaltung sichern, während das freiwillige Vorsorgesparen (3. Säule) den individuellen Wahlbedarf im Alter zu decken hilft.
Innerhalb der 3. Säule muss unterschieden werden, zwischen der mit Steuerprivilegien ausgestatteten Säule 3a und allen andern, meist nicht steuerbegünstigten Sparformen (Säule 3b). Die 3. Säule ist Bestandteil der auf der Bundesverfassung beruhenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (AHI-Vorsorge, Art. 111-113 der Bundesverfassung).
Ich möchte mit der folgenden Arbeit versuchen, die aktuelle Ausgestaltung der dritten Säule darzustellen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse unterstelle ich einer kritischen ökonomischen und sozialpolitischen Würdigung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zielsetzung der 3. Säule
- 2. Entstehung
- 3. Ausgestaltung der 3. Säule
- 3.1 Gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- 3.2 Freie Vorsorge (Säule 3b)
- 3.3 Gegenüberstellung freie-/gebundene Vorsorge
- 4 Kosten der Steuerbegünstigung
- 4.1 Säule 3a
- 4.2 Säule 3b
- 4.3 Fazit zum Steuerverlust
- 5. Was bewirkt die 3. Säule
- 5.1 Nutzniesser der Säule 3a
- 5.2 Befürworter der 3. Säule
- 5.3 Gegner der 3. Säule
- 5.4 Gesellschaftlicher Nutzen
- 5.5 Gesellschaftlicher Schaden
- 5.6 Ausblick, Verbesserungen
- 6. Sozialpolitische Betrachtung der dritten Säule
- 6.1 Umverteilung
- 6.1.1 Chancengleichheit
- 6.1.2 Bedarfsgerechtigkeit
- 6.1 Umverteilung
- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die dritte Säule der schweizerischen Altersvorsorge aus ökonomischer und sozialpolitischer Perspektive. Die Arbeit untersucht die Zielsetzung, Entstehung und Ausgestaltung der Säule 3a und 3b, bewertet die Kosten der Steuerbegünstigung und analysiert die Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Schliesslich wird die Säule 3 im Kontext von Umverteilung, Chancengleichheit und Bedarfsgerechtigkeit betrachtet.
- Zielsetzung und Funktionsweise der 3. Säule der Altersvorsorge
- Ökonomische Bewertung der Steuerbegünstigung der Säule 3a und 3b
- Auswirkungen der 3. Säule auf verschiedene Bevölkerungsgruppen
- Sozialpolitische Implikationen der 3. Säule im Hinblick auf Umverteilung und Gerechtigkeit
- Potentiale und Herausforderungen für zukünftige Entwicklungen der 3. Säule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die dritte Säule der Schweizer Altersvorsorge, ihre Ausgestaltung und die ökonomischen und sozialpolitischen Implikationen. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen der gebundenen (Säule 3a) und der freien Vorsorge (Säule 3b) und setzt sich kritisch mit deren Auswirkungen auseinander.
1. Zielsetzung der 3. Säule: Dieses Kapitel definiert den "individuellen Wahlbedarf" im Alter und diskutiert die Rolle der 3. Säule in Bezug auf die Ergänzung der staatlichen Altersvorsorge (1. und 2. Säule). Es analysiert die angestrebte Ergänzung zum gewohnten Lebensstandard und setzt diese in Relation zum durchschnittlichen Vorsorgeschutz.
2. Entstehung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Drei-Säulen-Modells, den Entstehungsprozess der 3. Säule im Kontext des Gegenvorschlags zum Volksbegehren der PdA für eine "wirkliche Volkspension", sowie die rechtliche Grundlage im Artikel 111 der Bundesverfassung.
3. Ausgestaltung der 3. Säule: Das Kapitel erläutert die Unterschiede zwischen der gebundenen (Säule 3a) und der freien Vorsorge (Säule 3b), detailliert deren Charakteristika und vergleicht die Vor- und Nachteile beider Systeme. Es bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und strukturellen Grundlagen beider Säulen.
4 Kosten der Steuerbegünstigung: Dieser Abschnitt analysiert die Kosten der Steuerbegünstigung für die Säule 3a und 3b. Er bewertet den finanziellen Aufwand aus staatlicher Sicht und diskutiert die Effizienz und Gerechtigkeit dieser Begünstigungen.
5. Was bewirkt die 3. Säule: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der 3. Säule auf verschiedene Gruppen der Bevölkerung. Es identifiziert Nutznießer und Gegner des Systems und analysiert die gesellschaftlichen Nutzen und Schäden, die mit der 3. Säule verbunden sind. Die Analyse beinhaltet eine Prognose zukünftiger Entwicklungen.
6. Sozialpolitische Betrachtung der dritten Säule: Dieses Kapitel befasst sich mit der sozialpolitischen Dimension der 3. Säule. Es untersucht die Aspekte der Umverteilung, Chancengleichheit und Bedarfsgerechtigkeit im Zusammenhang mit der individuellen Altersvorsorge und analysiert die gesellschaftlichen Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Dritte Säule, Altersvorsorge, Schweiz, Säule 3a, Säule 3b, Steuerbegünstigung, ökonomische Analyse, sozialpolitische Bewertung, Umverteilung, Chancengleichheit, Bedarfsgerechtigkeit, individuelle Vorsorge, gebundene Vorsorge, freie Vorsorge.
Häufig gestellte Fragen zur Schweizerischen Altersvorsorge (3. Säule)
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die dritte Säule der schweizerischen Altersvorsorge umfassend. Sie beleuchtet die Zielsetzung, Entstehung und Ausgestaltung der Säulen 3a (gebundene Vorsorge) und 3b (freie Vorsorge), bewertet die Kosten der Steuerbegünstigung und untersucht die Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sozialpolitischen Betrachtung im Hinblick auf Umverteilung, Chancengleichheit und Bedarfsgerechtigkeit.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Zielsetzung und Funktionsweise der 3. Säule, ökonomische Bewertung der Steuerbegünstigung von Säule 3a und 3b, Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen, sozialpolitische Implikationen bezüglich Umverteilung und Gerechtigkeit, sowie Potentiale und Herausforderungen für zukünftige Entwicklungen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zielsetzung der 3. Säule, Entstehung der 3. Säule, Ausgestaltung der 3. Säule (inkl. detaillierter Betrachtung von Säule 3a und 3b), Kosten der Steuerbegünstigung (für Säule 3a und 3b), Auswirkungen der 3. Säule auf verschiedene Bevölkerungsgruppen (inkl. Nutznießer und Gegner), sozialpolitische Betrachtung der 3. Säule (inkl. Umverteilung, Chancengleichheit und Bedarfsgerechtigkeit) und schliesslich eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Was sind die Unterschiede zwischen Säule 3a und Säule 3b?
Die Arbeit erläutert detailliert die Unterschiede zwischen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) und der freien Vorsorge (Säule 3b). Sie beschreibt die Charakteristika beider Systeme und vergleicht deren Vor- und Nachteile. Die rechtlichen und strukturellen Grundlagen beider Säulen werden umfassend dargestellt.
Wie werden die Kosten der Steuerbegünstigung analysiert?
Die Kosten der Steuerbegünstigung für Säule 3a und 3b werden aus staatlicher Sicht bewertet. Die Effizienz und Gerechtigkeit dieser Begünstigungen werden kritisch diskutiert.
Welche sozialpolitischen Aspekte werden betrachtet?
Die sozialpolitische Dimension der 3. Säule wird im Hinblick auf Umverteilung, Chancengleichheit und Bedarfsgerechtigkeit untersucht. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der individuellen Altersvorsorge werden analysiert.
Wer sind die Nutznießer und Gegner der 3. Säule?
Die Arbeit identifiziert die Nutznießer und Gegner des Systems und analysiert die gesellschaftlichen Nutzen und Schäden, die mit der 3. Säule verbunden sind. Eine Prognose zukünftiger Entwicklungen ist ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dritte Säule, Altersvorsorge, Schweiz, Säule 3a, Säule 3b, Steuerbegünstigung, ökonomische Analyse, sozialpolitische Bewertung, Umverteilung, Chancengleichheit, Bedarfsgerechtigkeit, individuelle Vorsorge, gebundene Vorsorge, freie Vorsorge.
Welche Rolle spielt die 3. Säule im Kontext des Drei-Säulen-Modells?
Die Arbeit beschreibt die historische Entwicklung des Drei-Säulen-Modells und die Entstehung der 3. Säule im Kontext des Gegenvorschlags zum Volksbegehren der PdA für eine "wirkliche Volkspension". Die rechtliche Grundlage im Artikel 111 der Bundesverfassung wird ebenfalls erläutert. Die 3. Säule wird als Ergänzung zur staatlichen Altersvorsorge (1. und 2. Säule) betrachtet.
- Quote paper
- Beat Flury (Author), 2002, Staatliche Hilfen zur Deckung des individuellen Wahlbedarfs im Alter - Kritische Würdigung der 3. Säule aus ökonomischer und sozialpolitischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9317