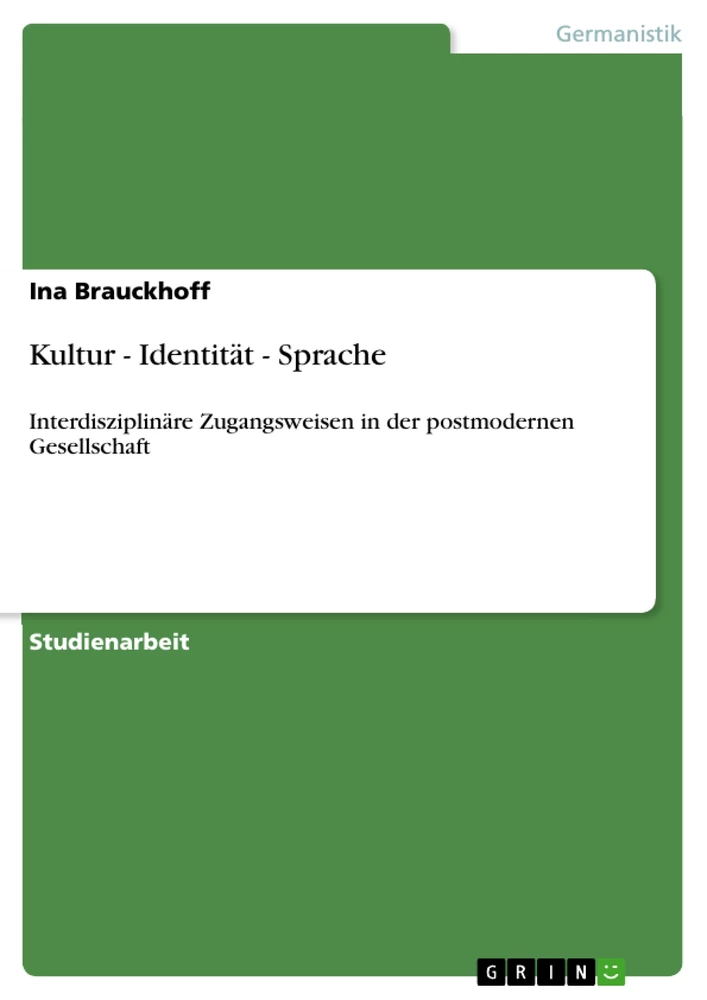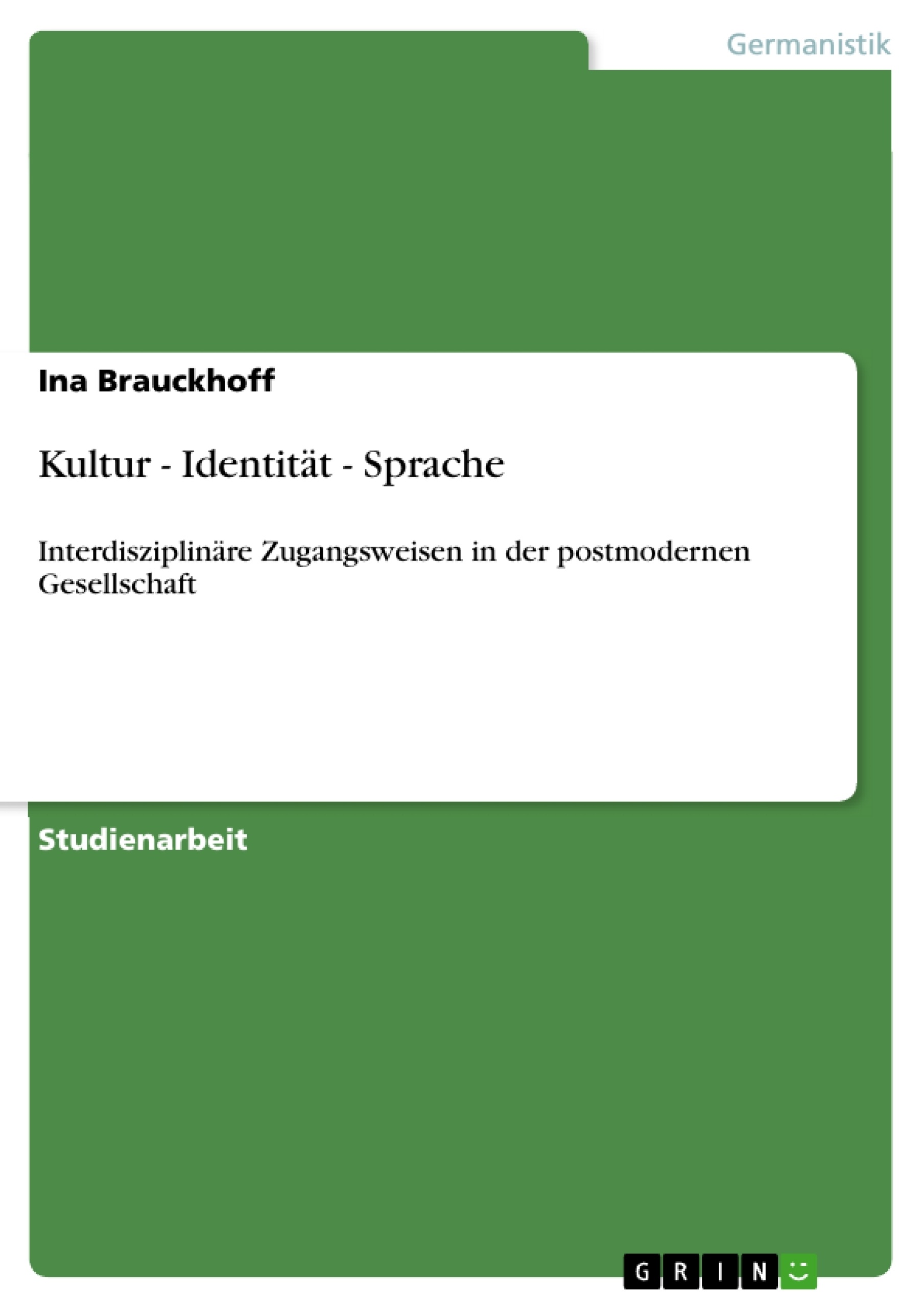Diese Arbeit setzt sich damit auseinander, dass das Selbst- und Weltbild der postmodernen Gesellschaft einen Perspektivwechsel in Bezug auf die Konzepte von Kultur, Identität und Sprache erfordert. Die Postmoderne kreiert ein neues Weltbild, das gravierende Auswirkungen auf das Verständnis von Kultur, Identität und Gesellschaft hat. Daher gehe ich folgenden Fragen nach: Welche gesellschaftlichen Veränderungen hat die Postmoderne bewirkt? Wie hängt die Postmodernisierung mit Kultur und Identität zusammen?
Ich werde mich dem Problem aus sozialwissenschaftlicher Seite nähern und verschiedene Sichtweisen aus der Kulturwissenschaft, der Kommunikations- und Medienwissenschaft, der Soziologie und der Psychologie vorstellen, um letztendlich auf die Linguistik zurück zu schließen. Durch Kontingenzerfahrung ist Sprache zu einem Spielzeug geworden, mit dem Wirklichkeit und Identität bewusst konstruiert und dekonstruiert werden können.
Welcher sprachtheoretische Ansatz kann dem heutigen Verständnis von Kultur, Identität und Sprache sowie Wirklichkeit und Gesellschaft daher gerecht werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kultur
- 2.1 Kultur als Programm
- 2.2 Anbindung an die Cultural Studies
- 2.2.1 Das Encoding-Decoding-Modell nach Stuart Hall
- 2.2.2 Stuart Halls Identitätspolitik
- 3. Kennzeichen der Postmoderne und postmoderner Gesellschaften
- 4. Sprache als natürliches soziales Phänomen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der Postmoderne auf die Konzepte von Kultur, Identität und Sprache. Ziel ist es, die Auswirkungen des postmodernen Weltbildes auf das Verständnis von Gesellschaft, Kultur und Identität zu erforschen. Dabei werden verschiedene sozialwissenschaftliche Perspektiven aus der Kulturwissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft, Soziologie und Psychologie beleuchtet.
- Die Auswirkungen der Postmoderne auf Kultur, Identität und Sprache.
- Der Wandel von traditionellen kulturellen Ordnungen hin zu einer Medienkultur.
- Die Rolle von Sprache in der Konstruktion von Wirklichkeit und Identität in der postmodernen Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Medien als Instrumente der Wirklichkeitskonstruktion und der Re- und Dekonstruktion von Kulturprogrammen.
- Der Einfluss von Schmidts Kulturbegriff auf das Verständnis von Gesellschaft und Wirklichkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die These der Hausarbeit vor, welche die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels in Bezug auf Kultur, Identität und Sprache in der postmodernen Gesellschaft postuliert. Die Arbeit wird sich den gesellschaftlichen Veränderungen, die die Postmoderne mit sich gebracht hat, sowie der Verbindung von Postmodernisierung mit Kultur und Identität widmen. - Kapitel 2: Kultur
In Kapitel 2 wird der Kulturbegriff des Kommunikations- und Kulturwissenschaftlers Siegfried J. Schmidt vorgestellt. Zunächst wird auf Schmidts Konzept von Wirklichkeit eingegangen, welches Umwelten, Aktanten, Vergesellschaftungsformen, Gefühle und Werte umfasst. Anschließend wird Schmidts Definition von Kultur als Programm erläutert, das die Anwendung und Bewertung von Wirklichkeitsmodellen in gesellschaftlichen Interaktionen regelt. Kultur wird als "Kontingenzinvisibilisierungsmaschine" betrachtet, die die Kontingenz von Möglichkeiten durch selektive Programmanwendungen reduziert. Es werden die Dualität von Tradition und Potentialität sowie der Zusammenhang zwischen Kultur und kollektivem Wissen hervorgehoben. Abschließend wird Schmidts Medienkompaktbegriff eingeführt, der Medienangebote, technische Dispositive, sozialsystemische Institutionalisierungen und Kommunikationsinstrumente umfasst und die Rolle der Medien in der Wirklichkeitskonstruktion und der Beobachtung von Kulturprogrammen betont.
Schlüsselwörter
Postmoderne, Kultur, Identität, Sprache, Wirklichkeit, Medien, Gesellschaft, Medienkultur, Kulturprogramm, Kontingenz, Wirklichkeitsmodell, Encoding-Decoding-Modell, Stuart Hall, Siegfried J. Schmidt
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Postmoderne unser Verständnis von Kultur?
In der Postmoderne wandelt sich Kultur von einer festen Ordnung hin zu einem flexiblen System, in dem Identitäten und Wirklichkeiten ständig neu konstruiert und dekonstruiert werden.
Was bedeutet "Kultur als Programm" nach Siegfried J. Schmidt?
Schmidt definiert Kultur als ein Programm, das die Anwendung und Bewertung von Wirklichkeitsmodellen in der Gesellschaft regelt und so hilft, die Unvorhersehbarkeit (Kontingenz) des Lebens zu reduzieren.
Was ist das Encoding-Decoding-Modell von Stuart Hall?
Es beschreibt, wie Medienbotschaften produziert (kodiert) und von den Empfängern je nach kulturellem Hintergrund unterschiedlich interpretiert (dekodiert) werden.
Welche Rolle spielt die Sprache in der postmodernen Gesellschaft?
Sprache wird als Werkzeug gesehen, mit dem Individuen ihre Identität und ihre Wahrnehmung der Realität aktiv gestalten können, anstatt nur eine objektive Welt abzubilden.
Warum sind Medien für die Wirklichkeitskonstruktion zentral?
Medien liefern die Bilder und Erzählungen, aus denen wir unsere Vorstellung von Kultur und Gesellschaft zusammensetzen. Sie fungieren als Instrumente zur Beobachtung und Veränderung von Kulturprogrammen.
- Quote paper
- Ina Brauckhoff (Author), 2007, Kultur - Identität - Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93191