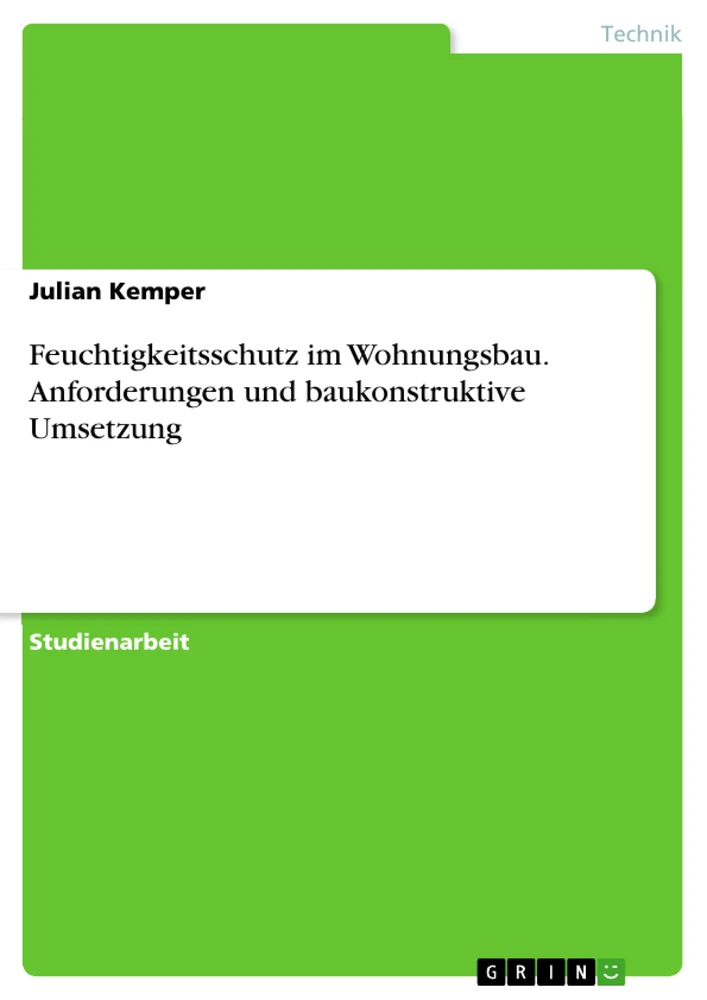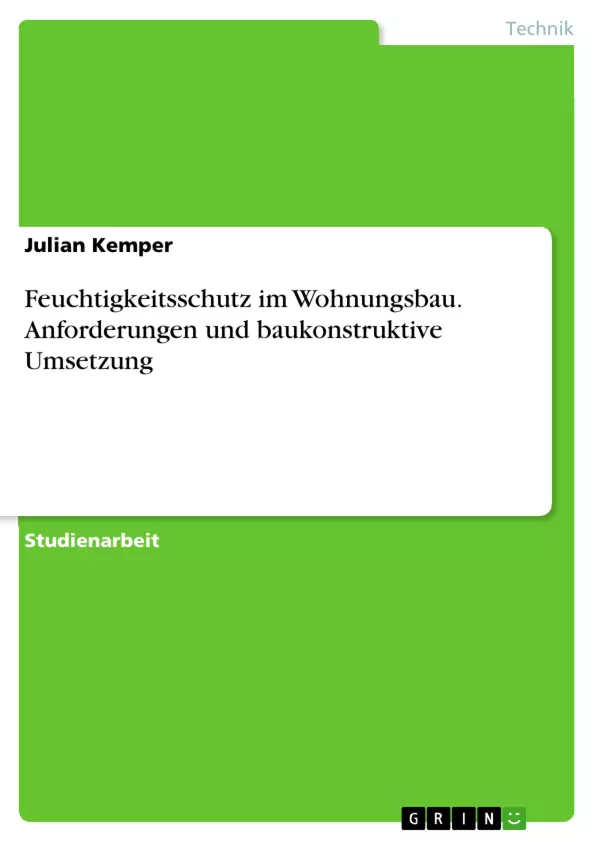Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des baulichen Feuchteschutzes im Wohnungsbau. Dazu werden zunächst relevante Begriffe wie Feuchtigkeit und Behaglichkeit definiert. Im weiteren Verlauf befasst sich die Arbeit mit den physikalischen Transporteigenschaften von Wasser. Im Kern der Hausarbeit werden die vier primären Feuchtigkeitseinflüsse auf das Bauwerk beschrieben und hierzu Schutzmaßnahmen erörtert.
Architektur und Bauwesen stellen einen permanenten Kampf gegen äußere Witterungsverhältnisse dar. Dabei spielt Feuchteschutz eine entscheidende Rolle für den Erhalt der Funktionsfähigkeit eines Bauwerks. Unter dem Begriff Feuchte oder auch Feuchtigkeit wird in der Bauphysik Wasser in allen drei Aggregatzuständen beschrieben. Dringt Feuchtigkeit in Baustoffe ein, kann dies zu wesentlichen Beeinträchtigungen von baulichen und hygienischen Verhältnissen des Baukörpers führen. In diesem Zusammenhang entstehen die meisten Bauschäden unter Einwirkung von Feuchtigkeit, welche die Korrosion und die Zersetzung von Baustoffen beschleunigt und den Nährboden für Schimmelpilzbildung darstellt. Feuchteschutz stellt in diesem Zusammenhang Maßnahmen dar, welche die Durchfeuchtung von Baustoffen und Bau- bzw. Konstruktionsteilen verhindern. Der konstruktive Feuchteschutz definiert dabei Maßnahmen, um den Kontakt zwischen feuchteanfällige Materialien bzw. Konstruktionsteilen und Wasser zu minimieren, sowie dauerhaft vom Wasser beanspruchte Bauteile so zu konstruieren, dass die Feuchtigkeit schnell abgeleitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und rechtliche Grundlagen
- Thermische Behaglichkeit
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Normen
- Physikalische Grundlagen
- Wassertransport
- Absorption
- Diffusion
- Kapillarität
- Taupunkttemperatur
- Wassertransport
- Baukonstruktive Umsetzung von Feuchteschutz
- Baufeuchte und Gebäudekonstruktionsfehler
- Wohnfeuchte und Luftwechsel
- Niederschlag und Spritzwasser
- Bodenfeuchte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Feuchteschutzes im Wohnungsbau und analysiert die verschiedenen Feuchtequellen sowie deren Auswirkungen auf den Baukörper. Das Ziel ist es, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Bauschäden durch Feuchtigkeit zu definieren und zu beschreiben.
- Definition von relevanten Begriffen im Zusammenhang mit dem baulichen Feuchteschutz
- Analyse der physikalischen Eigenschaften von Wasser und den verschiedenen Transportmechanismen
- Bewertung der Schimmelpilzgefahr in Abhängigkeit von der Taupunkttemperatur
- Identifizierung und Darstellung der vier wesentlichen Feuchtequellen
- Definition von Schutzmaßnahmen gegen die verschiedenen Feuchtequellen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 liefert eine Einführung in das Thema Feuchteschutz im Wohnungsbau und erläutert die Bedeutung des Feuchteschutzes für die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit von Gebäuden. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition wichtiger Begriffe wie thermische Behaglichkeit und relative Luftfeuchtigkeit sowie mit den relevanten gesetzlichen Normen im Bereich des Feuchteschutzes. In Kapitel 3 werden die physikalischen Eigenschaften von Wasser und die verschiedenen Transportmechanismen von Wasser in flüssiger und gasförmiger Phase, wie Absorption, Diffusion und Kapillarität, dargestellt. Kapitel 4 fokussiert auf die vier wichtigsten Feuchtequellen und deren Auswirkungen auf den Baukörper, wobei auch geeignete Schutzmaßnahmen gegen die jeweiligen Feuchtequellen vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Feuchteschutz, Wohnungsbau, Bauphysik, Wassertransport, Absorption, Diffusion, Kapillarität, Taupunkttemperatur, Schimmelpilzbildung, Baufeuchte, Wohnfeuchte, Niederschlag, Spritzwasser, Bodenfeuchte, Schutzmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Feuchteschutz im Wohnungsbau so wichtig?
Feuchtigkeit kann zu schweren Bauschäden, Korrosion von Materialien und Schimmelpilzbildung führen, was die Langlebigkeit des Gebäudes und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
Welche physikalischen Transportmechanismen von Wasser gibt es?
Die Arbeit beschreibt Absorption, Diffusion (Wasserdampftransport) und Kapillarität (Flüssigkeitstransport in Poren) als zentrale Mechanismen.
Was hat die Taupunkttemperatur mit Schimmel zu tun?
Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter die Taupunkttemperatur sinkt, fällt Tauwasser aus, was den idealen Nährboden für Schimmelpilze darstellt.
Welche vier primären Feuchtequellen werden unterschieden?
Die Arbeit analysiert Baufeuchte, Wohnfeuchte (Nutzerverhalten), Niederschlag/Spritzwasser und Bodenfeuchte.
Was versteht man unter konstruktivem Feuchteschutz?
Dies sind bauliche Maßnahmen, die den Kontakt zwischen Wasser und empfindlichen Materialien minimieren oder für eine schnelle Ableitung von Feuchtigkeit sorgen.
- Arbeit zitieren
- Julian Kemper (Autor:in), 2020, Feuchtigkeitsschutz im Wohnungsbau. Anforderungen und baukonstruktive Umsetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/932085