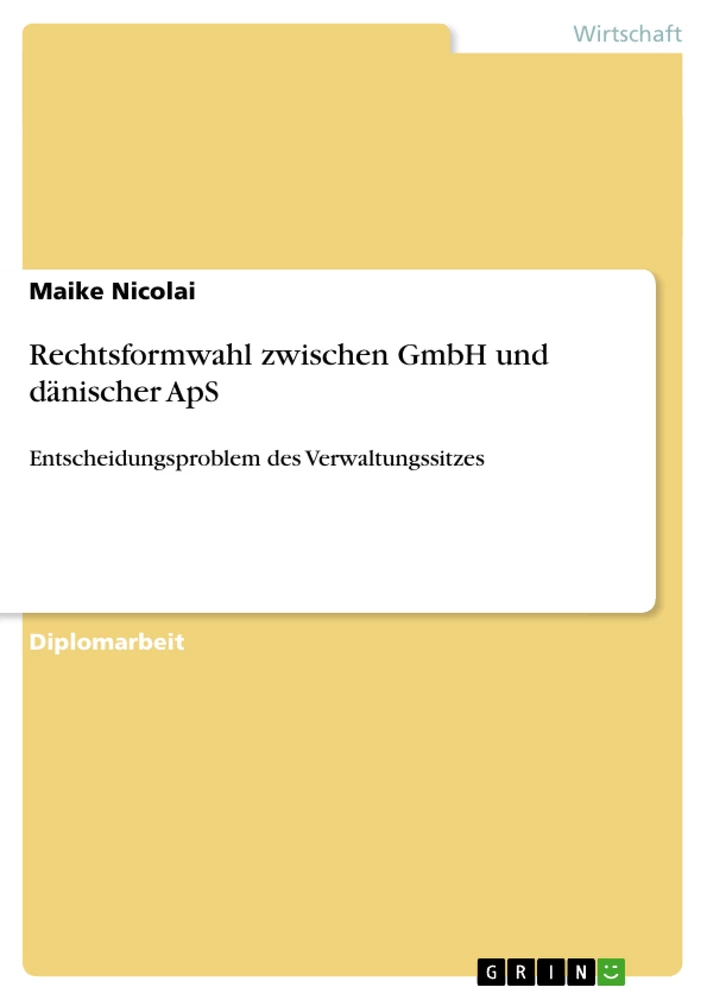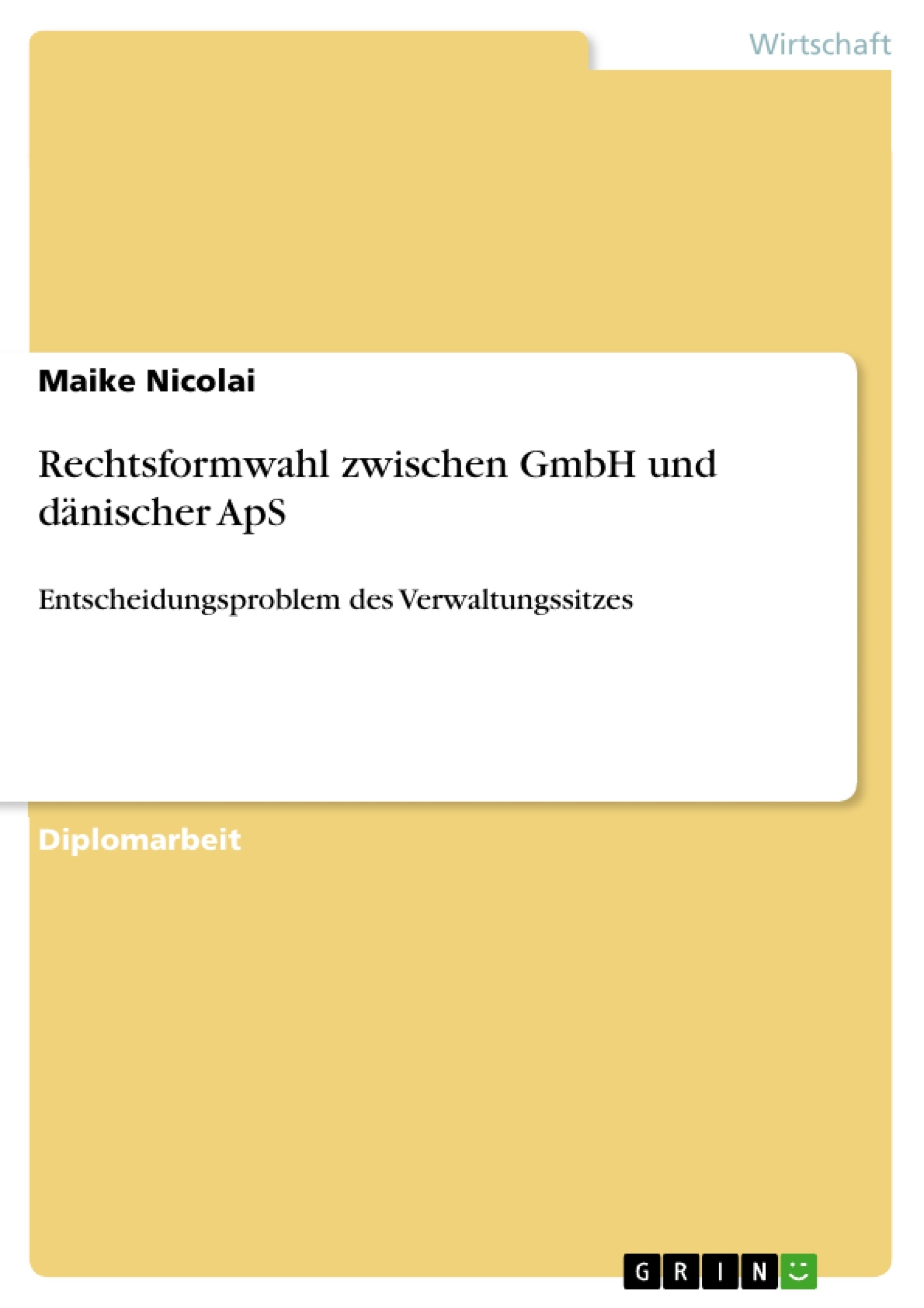Die Rechtsformwahl bildet den rechtlichen Rahmen für Unternehmen und stellt bei Neugründungen ein betriebswirtschaftliches Entscheidungsproblem dar. Die Wahl der optimalen Rechtsform gilt als strategisch, langfristige Entscheidung, welche nicht kurzfristig wieder geändert werden kann. Aufgrund dessen ist eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Auswahlkriterien und individuellen Zielvorstellungen erforderlich. In Deutschland ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung am meisten verbreitet und die von den Existenzgründern bevorzugte Rechtsform. Besonders der Mittelstand profitiert von der Haftungsbeschränkung und den hohen Formalisierungsgrad der Gesellschaft. Jedoch stellt die Mindestkapitalpflicht von 25.000 Euro für viele Unternehmensgründer eine nachteilige Hürde dar. Dieser und einige andere Gründe – bspw. steuerrechtliche Bestimmungen – verstärken die Suche nach alternativen Rechtsformen, welche flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten/ Gründungsprozesse hervorrufen. Im Zuge der Internationalisierung von Recht und Wirtschaft steht die GmbH zunehmend im Wettbewerb. Die neue Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs ermöglicht es statt einer GmbH mit Sitz im Inland eine ausländische Gesellschaft mit tatsächlichem Verwaltungssitz in Deutschland zu gründen. Aufgrund dessen muss sich die GmbH als Rechtsform vermehrt gegenüber ausländischen Rechtformen im Zuge der Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften behaupten. Das Spektrum der bestehenden Rechtsformen innerhalb der Europäischen Union (EU) hat sich erweitert. Künftig hat der Unternehmensgründer die Wahl zwischen den traditionell deutschen Rechtsformen und den vergleichbaren europäischen Gesellschaften. Die jüngsten Rechtsprechungen zur Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gestatten diesen Schritt.
Inhaltsverzeichnis
- Gang der Untersuchung
- Grundlagen
- Begriffliche Grundlagen
- Entscheidungskriterien einer Rechtsformwahl
- Einführende Erläuterung
- Haftung der Gesellschaft und deren Organträger
- Leitungsbefugnisse
- Gewinn- und Verlustbeteiligung
- Finanzierungsmöglichkeiten der Gesellschaft
- Rechnungslegungs-, Publizitäts- und Prüfungsvorschriften
- Besteuerung der Gesellschaft und deren Gesellschafter
- Rechtsformspezifische Aufwendungen
- Rechtsformdarstellung – GmbH vs. ApS
- Rechtsgrundlagen der GmbH und ApS
- Entstehung der Gesellschaft
- Organisationsverfassung
- Organisationsverfassung der GmbH
- Organisationsverfassung der ApS
- Finanzverfassung
- Insolvenz der Gesellschaft
- Gläubigerschutz europäischer Gesellschaften
- Die Mobilität von Gesellschaften
- Rechtsprechung des EuGH – Entwicklung
- Kernaussagen der Rechtsprechung
- Konsequenzen für die Verwaltungssitzverlegung
- Europarechtlicher Gestaltungsspielraum des deutschen Rechts
- Einführende Erläuterungen
- Inländische gesellschaftsrechtliche Sonderanknüpfungen
- Alternativanknüpfung - Delikts- und Insolvenzrecht
- Ordre public-Art. 6 EGBGB
- Anwendbarkeit deutscher Gläubigerschutzvorschriften
- Mindestkapital- und Mindestkapitalerhaltungsvorschriften
- Kapitalersatzvorschriften
- Insolvenzverschleppungshaftung
- Überblick
- Qualifizierung der Insolvenzantragspflicht als Vorfrage
- Qualifizierung der Insolvenzverschleppungshaftung
- Europarechtliche Rechtfertigung
- Existenzvernichtungshaftung
- Qualifizierung der Existenzvernichtungshaftung
- Existenzvernichtungshaftung als Unterfall der Durchgriffshaftung
- Europarechtliche Rechtfertigung
- Die ApS - Eine Alternative zur GmbH?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Rechtsformwahl zwischen einer deutschen GmbH und einer dänischen ApS, insbesondere im Hinblick auf das Problem des Verwaltungssitzes. Ziel ist es, die jeweiligen Rechtsformen umfassend zu vergleichen und die Auswirkungen der Rechtsformwahl auf den Gläubigerschutz zu beleuchten.
- Vergleich der Rechtsformen GmbH und ApS
- Auswirkungen des Verwaltungssitzes auf die Rechtsformwahl
- Gläubigerschutz im europäischen Kontext
- Anwendbarkeit deutscher Gläubigerschutzvorschriften auf Gesellschaften mit ausländischem Verwaltungssitz
- Bewertung der ApS als Alternative zur GmbH
Zusammenfassung der Kapitel
Gang der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Methodik der Arbeit. Es skizziert den roten Faden der Argumentation und die einzelnen Schritte der Untersuchung, die von der Problemstellung zur Schlussfolgerung führen. Es dient als Orientierungshilfe für den Leser und strukturiert die folgenden Kapitel.
Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert wichtige Begriffe, wie GmbH und ApS, und analysiert verschiedene Entscheidungskriterien bei der Rechtsformwahl, inklusive Haftung, Leitungsbefugnisse, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Finanzierung, Rechnungslegung und Besteuerung. Diese Grundlagen schaffen die Basis für den detaillierten Rechtsformenvergleich in den folgenden Kapiteln.
Rechtsformdarstellung – GmbH vs. ApS: Hier erfolgt ein umfassender Vergleich der Rechtsformen GmbH und ApS. Die Kapitelteile befassen sich mit den Rechtsgrundlagen, der Gründung, der Organisations- und Finanzverfassung sowie mit Insolvenzfragen beider Rechtsformen. Der Vergleich verdeutlicht sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der beiden Rechtsformen und bildet die Grundlage für die spätere Bewertung der ApS als Alternative zur GmbH.
Gläubigerschutz europäischer Gesellschaften: Dieses Kapitel widmet sich dem Gläubigerschutz im europäischen Kontext, insbesondere der Mobilität von Gesellschaften und der Rechtsprechung des EuGH. Es analysiert die Sitztheorie versus Gründungstheorie und die Konsequenzen für die Verwaltungssitzverlegung. Der Fokus liegt auf der Anwendbarkeit deutscher Gläubigerschutzvorschriften auf Gesellschaften mit ausländischem Verwaltungssitz und dem europarechtlichen Gestaltungsspielraum des deutschen Rechts.
Die ApS - Eine Alternative zur GmbH?: Dieses Kapitel wird einen abschließenden Vergleich der beiden Rechtsformen aus der Perspektive der gewählten Kriterien vornehmen und das Ergebnis der Arbeit zusammenfassen. Hier wird bewertet, inwieweit die ApS tatsächlich eine sinnvolle Alternative zur GmbH darstellt.
Schlüsselwörter
GmbH, ApS, Rechtsformwahl, Verwaltungssitz, Gläubigerschutz, Europarecht, Niederlassungsfreiheit, Sitztheorie, Gründungstheorie, Insolvenz, Haftung, Mindestkapital, Kapitalerhaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: GmbH vs. ApS
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit vergleicht die Rechtsformen der deutschen GmbH und der dänischen ApS, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der Rechtsformwahl auf den Gläubigerschutz und die Problematik des Verwaltungssitzes. Ziel ist die umfassende Gegenüberstellung beider Rechtsformen und die Bewertung der ApS als Alternative zur GmbH.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Rechtsformen GmbH und ApS, Auswirkungen des Verwaltungssitzes auf die Rechtsformwahl, Gläubigerschutz im europäischen Kontext, Anwendbarkeit deutscher Gläubigerschutzvorschriften auf Gesellschaften mit ausländischem Verwaltungssitz und die Bewertung der ApS als Alternative zur GmbH. Es werden die Rechtsgrundlagen, Gründung, Organisations- und Finanzverfassung sowie Insolvenzfragen beider Rechtsformen detailliert untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Gang der Untersuchung (Methodik), Grundlagen (Begriffsbestimmungen und Entscheidungskriterien der Rechtsformwahl), Rechtsformdarstellung – GmbH vs. ApS (umfassender Vergleich), Gläubigerschutz europäischer Gesellschaften (Fokus auf Mobilität, EuGH-Rechtsprechung und Anwendbarkeit deutscher Vorschriften) und Die ApS - Eine Alternative zur GmbH? (abschließende Bewertung).
Welche Entscheidungskriterien für die Rechtsformwahl werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Entscheidungskriterien, darunter Haftung der Gesellschaft und deren Organträger, Leitungsbefugnisse, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Finanzierungsmöglichkeiten, Rechnungslegungs-, Publizitäts- und Prüfungsvorschriften sowie die Besteuerung der Gesellschaft und deren Gesellschafter und rechtsformspezifische Aufwendungen.
Welche Rolle spielt der Gläubigerschutz in der Arbeit?
Der Gläubigerschutz spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit deutscher Gläubigerschutzvorschriften (z.B. Mindestkapital-, Kapitalersatz-, Insolvenzverschleppungs- und Existenzvernichtungshaftung) auf Gesellschaften mit ausländischem Verwaltungssitz im europäischen Kontext, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH und des europarechtlichen Gestaltungsspielraums des deutschen Rechts. Die Sitztheorie und die Gründungstheorie werden dabei analysiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der ApS als Alternative zur GmbH?
Die Arbeit kommt in einem abschließenden Kapitel zu einer Bewertung, inwieweit die ApS tatsächlich eine sinnvolle Alternative zur GmbH darstellt, basierend auf den zuvor analysierten Kriterien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: GmbH, ApS, Rechtsformwahl, Verwaltungssitz, Gläubigerschutz, Europarecht, Niederlassungsfreiheit, Sitztheorie, Gründungstheorie, Insolvenz, Haftung, Mindestkapital, Kapitalerhaltung.
- Quote paper
- Maike Nicolai (Author), 2007, Rechtsformwahl zwischen GmbH und dänischer ApS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93229