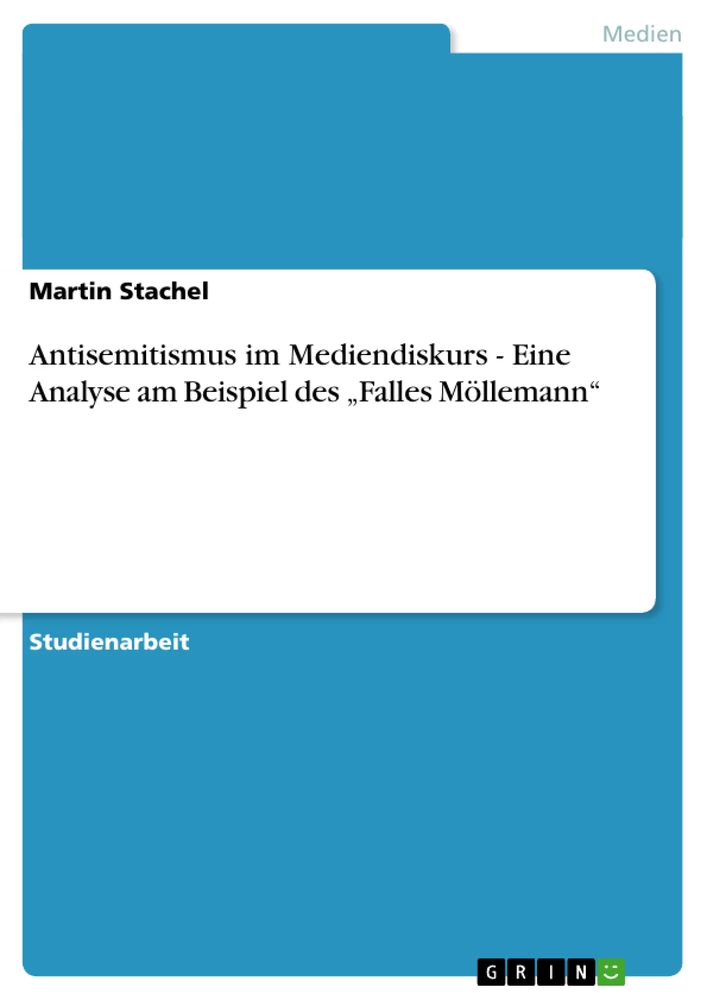Seit den Verbrechen der Nationalsozialisten an den Juden, ist die deutsche Öffentlichkeit besonders sensibilisiert, wenn es um Themen wie Judenhass und Antisemitismus geht. Da Öffentlichkeit in der heutigen Zeit vor allem in den Medien stattfindet, greifen Radio, Fernsehen und Printmedien Geschichten und Äußerungen zu diesem Thema, natürlich nicht ohne eigene wirtschaftlichen Interessen, immer wieder bereitwillig auf. Es stellt sich in dieser Arbeit also weniger die Frage, wieso findet Antisemitismus überhaupt im medialen Diskurs statt, sondern vielmehr die Frage nach dem „wie“. Wie verläuft die mediale Auseinandersetzung zu solchen Themen? Welche Mechanismen dafür spielen eine Rolle? Gibt es immer wiederkehrende Muster? Welche gesellschaftlichen Gruppen nehmen an diesen Diskursen in welcher Art und Weise teil? Und was hat das für Auswirkungen auf den Begriff ‚Antisemitismus’ in der Öffentlichkeit? Fragen, die in dieser Arbeit am Beispiel des „Falles Möllemann“ erörtert werden sollen.
Als wohl bekannteste und spektakulärste Debatte zum Thema „Antisemitismus“ der letzten Jahre, war sie zugleich auch die am meisten in der medialen Öffentlichkeit stattfindende und damit medienpräsenteste aller bisherigen. Gründe für diese Ausweitung des Diskurses von der politischen Ebene auf die „Stammtisch-Ebene“ liegen vor allem in den Rollen der beiden Protagonisten Möllemann und Friedman. Der eine ist ein selbstdarstellerischer Populist im Wahlkampf, der andere diskussionserprobter Talkshow-Moderator. Beide kennen die Mechanismen der Medien und wie sie diese als Sprachrohr für eigene Absichten zu instrumentalisieren haben. Daher ist es auch nicht Anspruch dieser Arbeit, zu klären, ob Möllemann selbst oder seine Aussagen antisemitisch sind, oder zumindest antisemitische Tendenzen aufweisen. Es geht lediglich um einen Rekonstruktionsversuch des medialen Verlaufes des „Falles Möllemann“, um somit Antworten auf oben genannte Fragen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und historische Betrachtung des Antisemitismus
- Christlicher Antijudaismus
- Rassenantisemitismus
- Antizionismus
- Antisemitismus nach dem Holocaust
- Der ,,Fall Möllemann“ im Mediendiskurs
- Bezugssystem,,Projekt 18“
- Der,,Fall Karsli“ als Auslöser
- Skandalisierung und Solidarisierung
- Das,,Reinigungsritual“
- Abschlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der medialen Auseinandersetzung mit Antisemitismus am Beispiel des „Falles Möllemann“. Ziel ist es, den medialen Verlauf dieser Debatte zu rekonstruieren und die Mechanismen und Muster zu analysieren, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Die Arbeit erörtert, welche gesellschaftlichen Gruppen an diesem Diskurs teilnehmen, in welcher Art und Weise und welche Auswirkungen dies auf den Begriff „Antisemitismus“ in der Öffentlichkeit hat.
- Die Definition und historische Entwicklung des Antisemitismus
- Die mediale Inszenierung des „Falles Möllemann“
- Die Rolle der Medien im Antisemitismus-Diskurs
- Die Auswirkungen des Diskurses auf den Begriff „Antisemitismus“
- Die Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Antisemitismus im medialen Diskurs dar und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des „Falles Möllemann“ als Beispiel für eine medienpräsente und kontroverse Debatte zum Thema.
Definition und historische Betrachtung des Antisemitismus
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Antisemitismus“ und beleuchtet seine historische Entwicklung. Es erläutert verschiedene Formen des Antisemitismus, darunter den christlichen Antijudaismus, den Rassenantisemitismus und den Antizionismus.
Der ,,Fall Möllemann“ im Mediendiskurs
Dieses Kapitel analysiert den medialen Verlauf des „Falles Möllemann“ und untersucht die Rolle der Medien in dieser Debatte. Es befasst sich mit dem Bezugssystem „Projekt 18“, dem „Fall Karsli“ als Auslöser der Debatte, der Skandalisierung und Solidarisierung sowie dem „Reinigungsritual“.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Mediendiskurs, „Fall Möllemann“, „Projekt 18“, „Fall Karsli“, Skandalisierung, Solidarisierung, Reinigungsritual, Medienmechanismen, gesellschaftliche Gruppen, Begriffstransformation, historische Entwicklung, christlicher Antijudaismus, Rassenantisemitismus, Antizionismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde der „Fall Möllemann“ in den Medien inszeniert?
Die Medien griffen die Äußerungen Möllemanns und die Reaktionen darauf (insbesondere von Michel Friedman) bereitwillig auf, wobei Mechanismen der Skandalisierung und Personalisierung eine zentrale Rolle spielten.
Was war der Auslöser der Antisemitismus-Debatte im Jahr 2002?
Auslöser war die Kritik Möllemanns an Michel Friedman und der israelischen Politik im Kontext des „Falles Karsli“ sowie ein kontroverses Wahlkampf-Flugblatt der FDP.
Welche Rolle spielte das „Projekt 18“ der FDP?
„Projekt 18“ war das Wahlziel der FDP (18 % der Stimmen). In diesem Rahmen versuchte Möllemann durch populistische Themen neue Wählerschichten zu erreichen, was den Diskurs befeuerte.
Was versteht man unter dem „Reinigungsritual“ im Mediendiskurs?
Es beschreibt den medialen Prozess, bei dem durch öffentliche Distanzierung, Entschuldigungen oder den Rücktritt einer Person die moralische Integrität der Gesellschaft oder einer Partei wiederhergestellt werden soll.
Wie unterscheiden sich Antiziganismus, Antijudaismus und Antisemitismus?
Während Antijudaismus religiös motiviert ist, basiert der Rassenantisemitismus auf pseudowissenschaftlichen biologischen Theorien. Antizionismus richtet sich gegen den Staat Israel, kann aber antisemitische Züge tragen.
- Quote paper
- Diplom-Medienwirt Martin Stachel (Author), 2005, Antisemitismus im Mediendiskurs - Eine Analyse am Beispiel des „Falles Möllemann“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93236