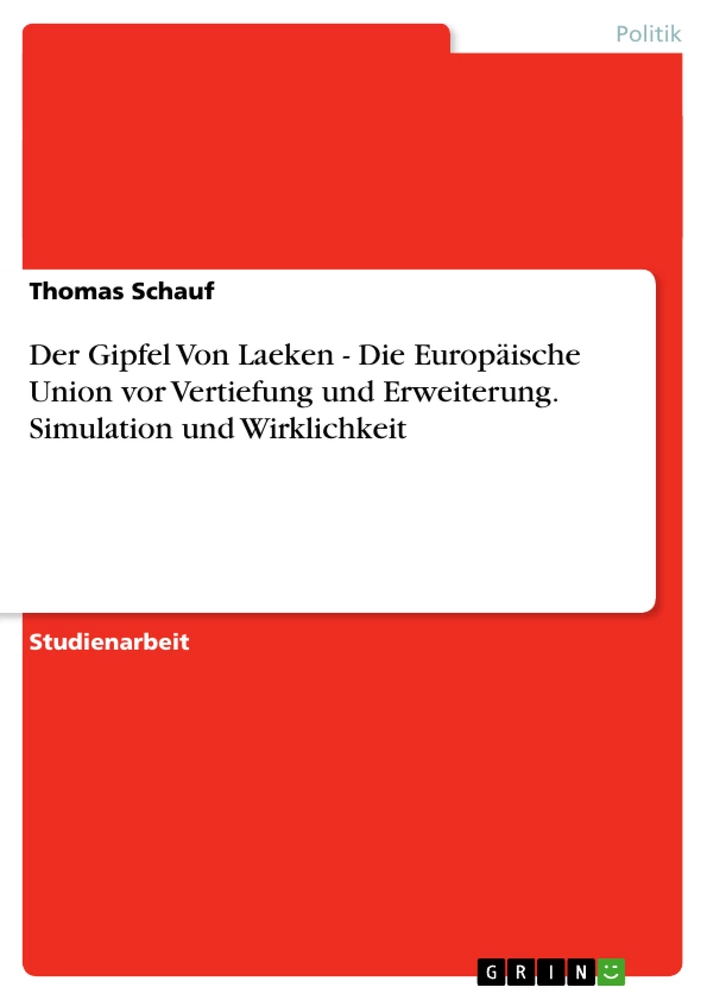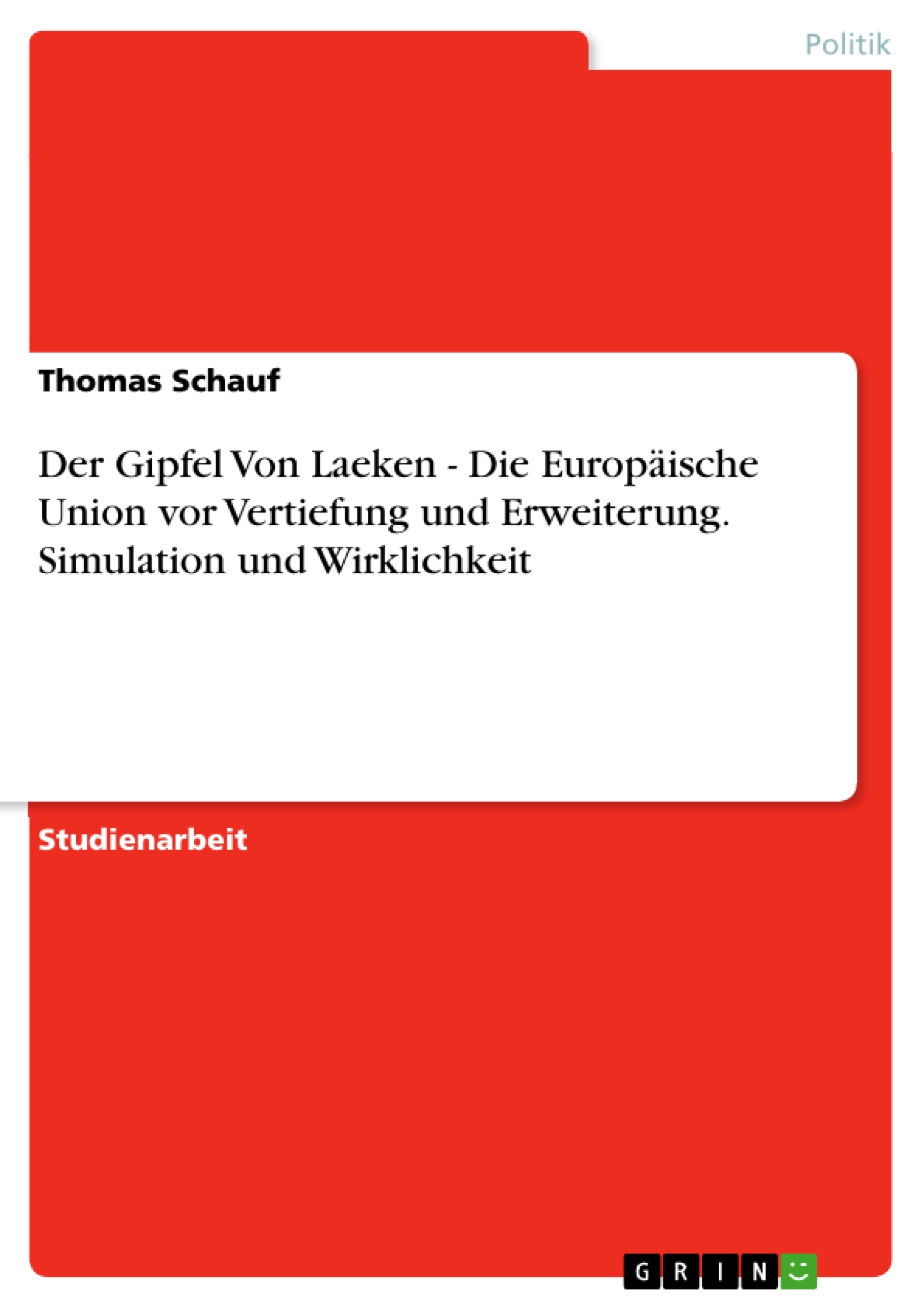Diese Arbeit hat im wesentlichen zwei Kerninhalte. Zum Einen soll sie die derzeitige Position (Bezupspunkt ist das Jahr 2002) der Europäischen Union (EU) darstellen, den Reformbedarf
hinsichtlich der aktuell diskutierten Vertiefungs- und Erweiterungsproblematik aufzeigen und die von den politischen Entscheidungsträgern bevorzugten Problemlösungsstrategien skizzieren.
Als Zweites wird die im Rahmen des Hauptseminars durchgeführte Simulation analysiert.
Beide Kerninhalte, zum Einen die politische Wirklichkeit und zum Anderen die politische Simulation, werden hinsichtlich der Frage, welche Ergebnisse ,,besser" sind, begutachtet.
Die Frage, welche Ergebnisse ,,besser" sind, unterteilt sich in drei Bereiche: Erstens, welche der beiden Positionen erhöht die Handlungsfähigkeit der EU? Zweitens, durch welches implizierte Handeln wird die Transparenz der EU gesteigert? Und abschließend, wo werden die Akteure adäquater beteiligt?
Hierbei ist zu beachten, dass der normative Bezug von der EU als handelnden Akteur ausgeht; d.h. im Vordergrund steht eine Stärkung der EU als politisches System und als politischer Akteur. A
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE EU NACH NIZZA – ERGEBNISSE UND ERWARTUNGEN
- WO STEHT DIE EUROPÄISCHE UNION?
- MÖGLICHKEITEN FÜR VERTIEFUNG UND ERWEITERUNG
- DER GIPFEL VON LAEKEN
- DIE SIMULATION – EIN KONVENT FÜR EUROPA
- AUFBAU UND THEMATISCHER ANSATZ
- DURCHFÜHRUNG
- ERGEBNIS
- ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT
- ZUSAMMENFASSUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
- FRAGEBOGEN UND BEANTWORTETE FRAGERASTER
- ABLAUFPLAN
- REFERENTENLISTE
- GESCHÄFTSORDNUNG
- FEIERLICHE ERKLÄRUNG VON BRÜHL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die aktuelle Position der Europäischen Union (EU) und zeigt den Reformbedarf im Hinblick auf Vertiefung und Erweiterung auf. Darüber hinaus wird die im Rahmen des Hauptseminars durchgeführte Simulation untersucht, um die Ergebnisse der politischen Wirklichkeit mit den Ergebnissen der Simulation zu vergleichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, welche Ergebnisse die Handlungsfähigkeit, Transparenz und Beteiligung der EU verbessern können.
- Die Position der EU nach der Regierungskonferenz von Nizza
- Der Reformbedarf hinsichtlich der Vertiefungs- und Erweiterungsproblematik
- Die Simulation des Laekener Gipfels und ihre analytische Vergleichskomponente zur politischen Wirklichkeit
- Der Vergleich zwischen Simulation und politischer Wirklichkeit
- Die Stärkung der EU als politisches System und Akteur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Kerninhalte der Arbeit vor: die Analyse der Position der EU nach Nizza und die Untersuchung der Simulation des Laekener Gipfels. Kapitel 2 bietet eine Standortbestimmung der EU nach der Regierungskonferenz von Nizza und erläutert die daraus resultierenden Möglichkeiten für Vertiefung und Erweiterung. Kapitel 3 behandelt den Gipfel von Laeken im Dezember 2001 und analysiert, inwiefern die Staats- und Regierungschefs den Anforderungen nach der Regierungskonferenz von Nizza gerecht wurden. Kapitel 4 beschreibt die Simulation des Laekener Gipfels und entwirft eine analytische Vergleichskomponente zur politischen Wirklichkeit. Schließlich führt Kapitel 5 einen detaillierten Vergleich zwischen der Simulation und der politischen Wirklichkeit durch.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Europäische Union, Vertiefung, Erweiterung, Regierungskonferenz von Nizza, Gipfel von Laeken, Simulation, Handlungsfähigkeit, Transparenz, Beteiligung, politische Wirklichkeit, politische Entscheidungsträger, Problemlösungsstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Gipfels von Laeken?
Der Gipfel im Dezember 2001 sollte Reformen zur Vertiefung und Erweiterung der EU auf den Weg bringen und die Handlungsfähigkeit sowie Transparenz des politischen Systems stärken.
Was ist der Unterschied zwischen politischer Simulation und Wirklichkeit?
Die Arbeit vergleicht reale politische Ergebnisse mit einer akademischen Simulation eines EU-Konvents, um zu prüfen, welches Modell „bessere“ Lösungen für die EU-Reform bietet.
Warum war die EU nach dem Vertrag von Nizza reformbedürftig?
Der Vertrag von Nizza wurde als unzureichend angesehen, um die EU auf die geplante große Osterweiterung vorzubereiten und die demokratische Beteiligung zu sichern.
Wie kann die Transparenz der EU gesteigert werden?
Diskutiert werden klarere Entscheidungsprozesse, eine bessere Einbindung der Bürger und eine Vereinfachung der Verträge, wie sie im Laekener Konvent angestrebt wurden.
Was bedeutet „Vertiefung“ der Europäischen Union?
Vertiefung bezeichnet die engere politische und rechtliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie die Stärkung der supranationalen Institutionen der EU.
Welche Rolle spielten die Staats- und Regierungschefs in Laeken?
Sie verabschiedeten die „Erklärung von Laeken“, die den Weg für einen Konvent zur Erarbeitung einer europäischen Verfassung ebnete.
- Arbeit zitieren
- Thomas Schauf (Autor:in), 2002, Der Gipfel Von Laeken - Die Europäische Union vor Vertiefung und Erweiterung. Simulation und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9324