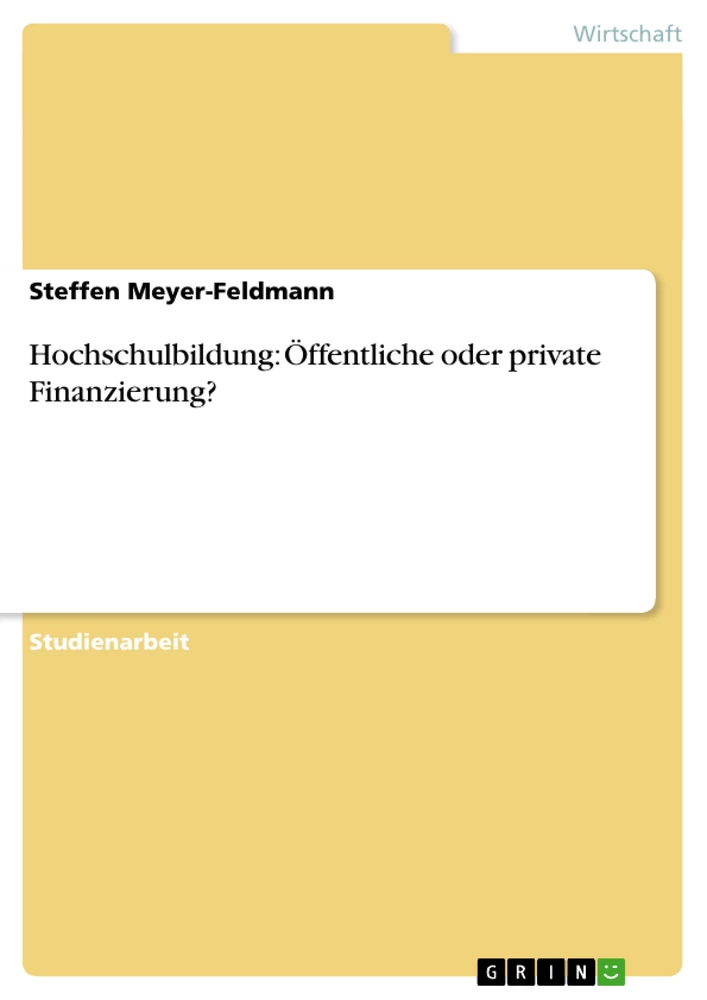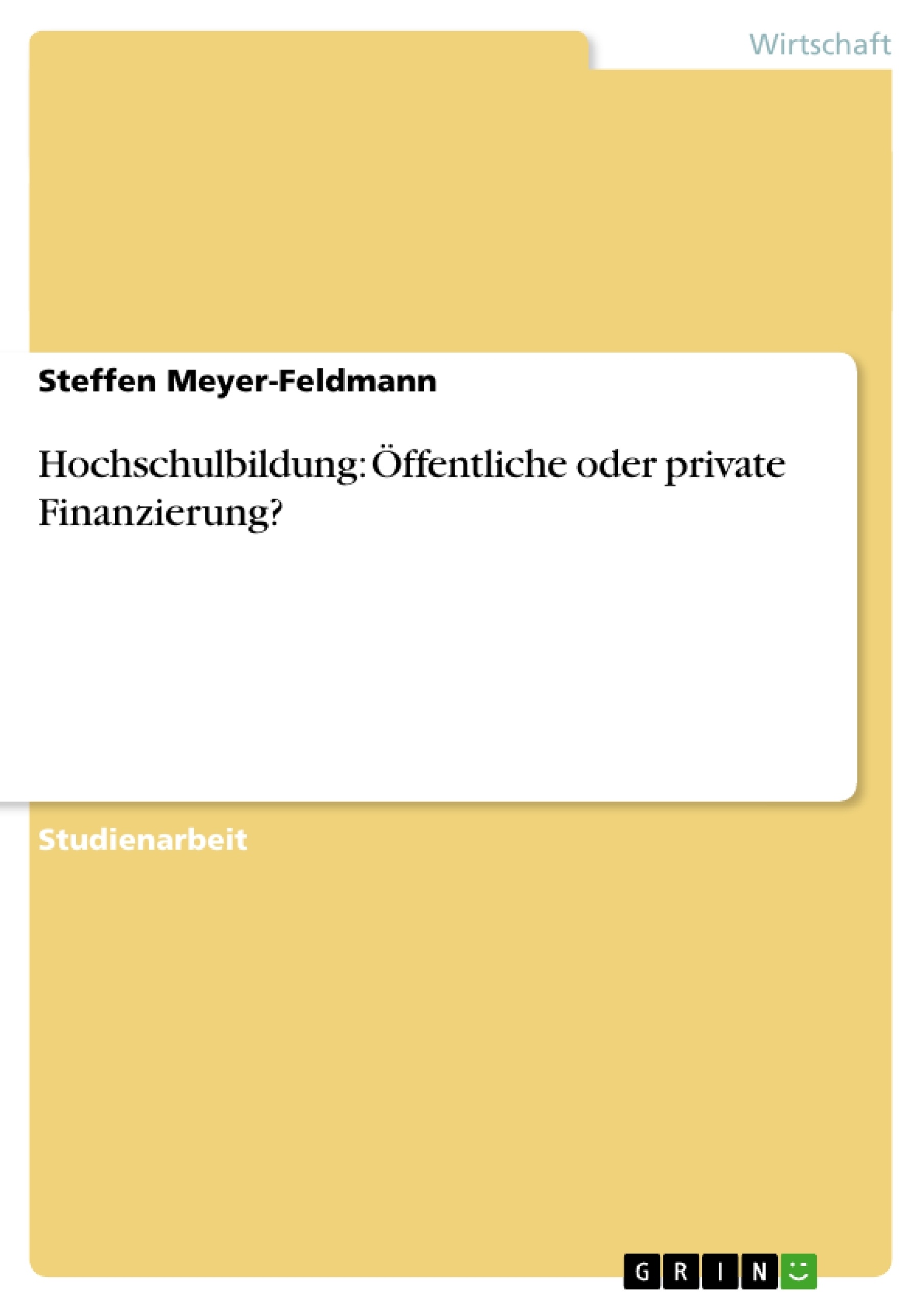Als das Bundesverfassungsgericht im Januar 2005 das Verbot von Studiengebühren – eingeführt von der rot-grünen Regierungskoalition im April 2002 - aufhob, wurde die bis dato immer wieder geführte Diskussion um die Finanzierung der Hochschulausbildung erneut entfacht. Generelle Überlegungen wurden angestellt, ob Hochschüler weiterhin auf Staatskosten studieren dürfen oder ob sie sich an der Studienfinanzierung selbst zu beteiligen haben. Viele Bundesländer sprachen sich daraufhin für die Einführung von Studiengebühren beim Erststudium aus, darunter auch Nordrhein-Westfalen.
„In den unterschiedlichen Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes sind sowohl verteilungspolitische als auch effizienzorientierte Erwägungen zum Ausdruck gekommen – auch wenn erstere zu dominieren scheinen.“ Aus der Verteilungsperspektive wird die Einführung von Gebühren entweder begrüßt, da nicht mehr nur die Besserverdienenden exklusiv profitieren; oder sie wird abgelehnt, weil einkommensschwache Gruppen von der Bildung ausgeschlossen werden.
Aus der Effizienzperspektive gibt es auch einige Gründe, die für oder gegen die öffentliche Bereitstellung der Hochschulbildung sprechen.
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Bildung als solche zu erwähnen. Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen des sonst rohstoffarmen Deutschlands; erhöhtes Humankapital und ein damit einhergehendes erhöhtes Einkommensniveau sorgt laut OECD-Analysen für überproportionales Wirtschaftswachstum. Dies zeigt sehr genau wie wichtig das Bildungssystem, speziell der tertiäre Be-reich, für Deutschland und seine internationale Positionierung ist. Im Vergleich der Bildungsausgaben weltweit führender Industriestaaten belegt Deutschland einen der hinteren Ränge - nur 4,5% des BIP wurden im Jahre 2003 in die Bildung investiert, der OECD Durchschnitt lag hingegen bei 5,2%. Im Laufe dieser Arbeit werde ich zunächst die Effizienzaspekte der öffentlichen und der privaten Finanzierung des Hochschulstudiums beleuchten. Hierunter fallen speziell die effizienzpolitischen Argumente des Marktversagens wie positive externe Effekte der Hochschulbildung, imperfekte Kapitalmärkte für Bildungskredite sowie die fehlende Möglichkeit, sich durch Bildungskredite gegen Bildungsrisiken zu versichern. Auch das Argument, dass Hochschulbildung ein öffentliches Gut ist und so vom Staat zur Verfügung zu stellen sei, wird hierbei nicht außer Acht gelassen und kritisch hinterfragt. Die Steuereinflussfaktoren auf Bildungsinvestitionen finden ebenfalls Berücksichtigung.
Anschließend setze ich mich ausführlich mit den Verteilungsaspekten der Hochschulfinanzierung auseinander. Diese werden anhand empirischer Studien erörtert. Hierbei wird auf die Unterschiede zwischen einer Längsschnittanalyse und einer Querschnittanalyse der Perspektiven eingegangen, welche für das jeweilige Ergebnis von entscheidender Bedeutung sind.
Am Ende dieser Arbeit wird deutlich, dass es keine vertretbaren Gründe für eine ausschließlich öffentliche Kostenübernahme der Hochschulbildung gibt. Vertretbare Argumente gegen die (Wieder-) Einführung von Studiengebühren können ebenfalls nicht angeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Effizienzaspekte
- 2.1 Marktversagen
- 2.2 Bildungsinvestitionen vs. Einkommensteuer
- 3. Verteilungsaspekte
- 3.1 Empirische Untersuchungen zu den Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung
- 3.1.1 Längsschnittanalyse vs. Querschnittanalyse
- 3.1.2 Die Nettotransferkalkulation
- 3.2 Die Hansen-Weisbrod-Pechman-Debatte – ihre Entstehung, ihre Folgen
- 3.2.1 Die Studie von Hansen und Weisbrod
- 3.2.2 Die Hansen-Weisbrod-Pechman-Debatte
- 3.2.3 Die Studie von Grüske
- 3.2.4 Die Studie von Sturn und Wohlfahrt
- 3.2.5 Die Studie von Barbaro
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Finanzierung der Hochschulbildung öffentlich oder privat erfolgen soll. Sie analysiert die Effizienz- und Verteilungsaspekte der verschiedenen Finanzierungsmodelle und beleuchtet die Folgen der Einführung von Studiengebühren.
- Die Effizienz der öffentlichen Hochschulfinanzierung im Kontext von Marktversagen (positive externe Effekte, imperfekte Kapitalmärkte, Bildungsrisiken)
- Die Bedeutung der Bildung als Ressource für die deutsche Wirtschaft und die Rolle des tertiären Bildungsbereichs
- Die Auswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung auf die Einkommensverteilung und die Diskussion um die Hansen-Weisbrod-Pechman-Debatte
- Die empirische Analyse der Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung anhand von Längsschnitt- und Querschnittanalysen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Bundesverfassungsgericht hob 2005 das Verbot von Studiengebühren auf und entfachte die Debatte um die Finanzierung der Hochschulausbildung. Die Arbeit betrachtet die verschiedenen Argumente für und gegen die Einführung von Studiengebühren aus Effizienz- und Verteilungsperspektive.
- Effizienzaspekte: Die Arbeit beleuchtet Marktversagen als Argument für öffentliche Finanzierung. Externe Effekte, imperfekte Kapitalmärkte und Bildungsrisiken werden als Gründe für staatliche Intervention angeführt. Die Bedeutung der Bildung als Ressource für die deutsche Wirtschaft und die Rolle des tertiären Bildungsbereichs werden hervorgehoben.
- Verteilungsaspekte: Es werden empirische Studien betrachtet, die die Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung analysieren. Dabei werden die Unterschiede zwischen Längsschnitt- und Querschnittanalysen diskutiert.
Schlüsselwörter
Hochschulfinanzierung, Studiengebühren, Effizienz, Verteilungsaspekte, Marktversagen, externe Effekte, Kapitalmärkte, Bildungsrisiken, öffentliche Güter, Bildung als Ressource, Einkommensverteilung, Hansen-Weisbrod-Pechman-Debatte, Längsschnittanalyse, Querschnittanalyse, Nettotransferkalkulation.
Häufig gestellte Fragen
Sollte Hochschulbildung öffentlich oder privat finanziert werden?
Die Arbeit zeigt, dass es keine rein vertretbaren Gründe für eine ausschließlich öffentliche Kostenübernahme gibt und eine private Beteiligung oft effizienter ist.
Was sind positive externe Effekte der Hochschulbildung?
Dazu gehören Wirtschaftswachstum, höhere Steuereinnahmen und gesellschaftlicher Fortschritt, von denen auch Nicht-Akademiker profitieren.
Was ist die Hansen-Weisbrod-Pechman-Debatte?
Eine wissenschaftliche Diskussion darüber, ob öffentliche Hochschulfinanzierung zu einer Umverteilung von Arm zu Reich führt (da oft Kinder aus wohlhabenden Familien studieren).
Warum gibt es Marktversagen bei Bildungskrediten?
Kapitalmärkte sind oft imperfekt, da Banken ohne staatliche Garantien ungern Kredite für „Humankapital“ vergeben, da dieses nicht als physische Sicherheit dienen kann.
Wie hoch sind die Bildungsausgaben in Deutschland im OECD-Vergleich?
Deutschland lag in der Vergangenheit mit ca. 4,5% des BIP unter dem OECD-Durchschnitt von 5,2%.
- Quote paper
- Steffen Meyer-Feldmann (Author), 2007, Hochschulbildung: Öffentliche oder private Finanzierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93263