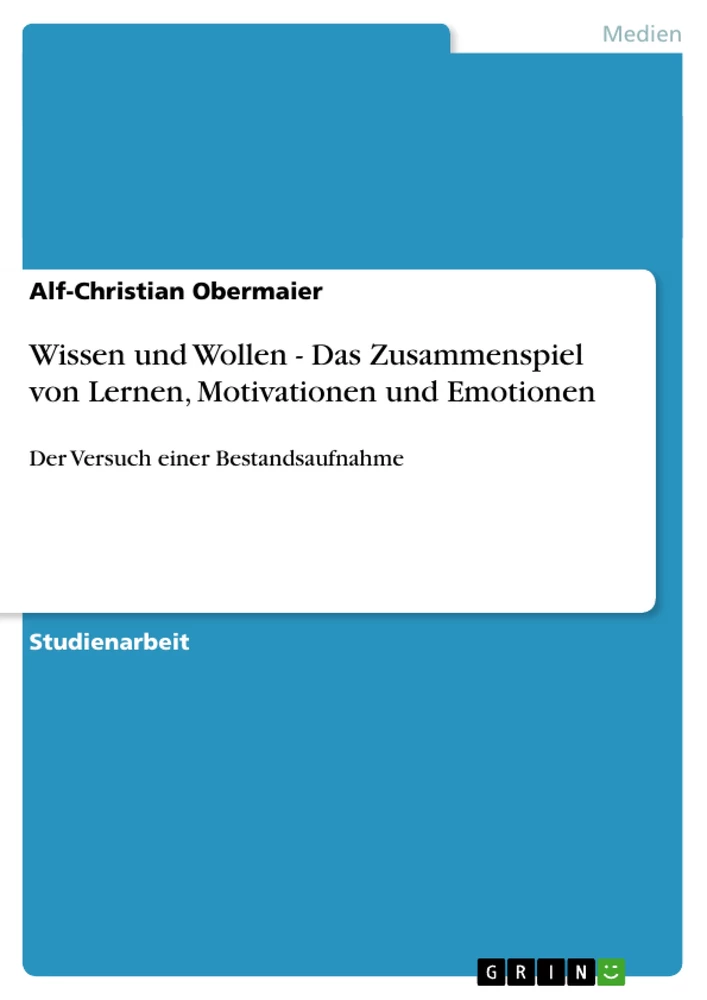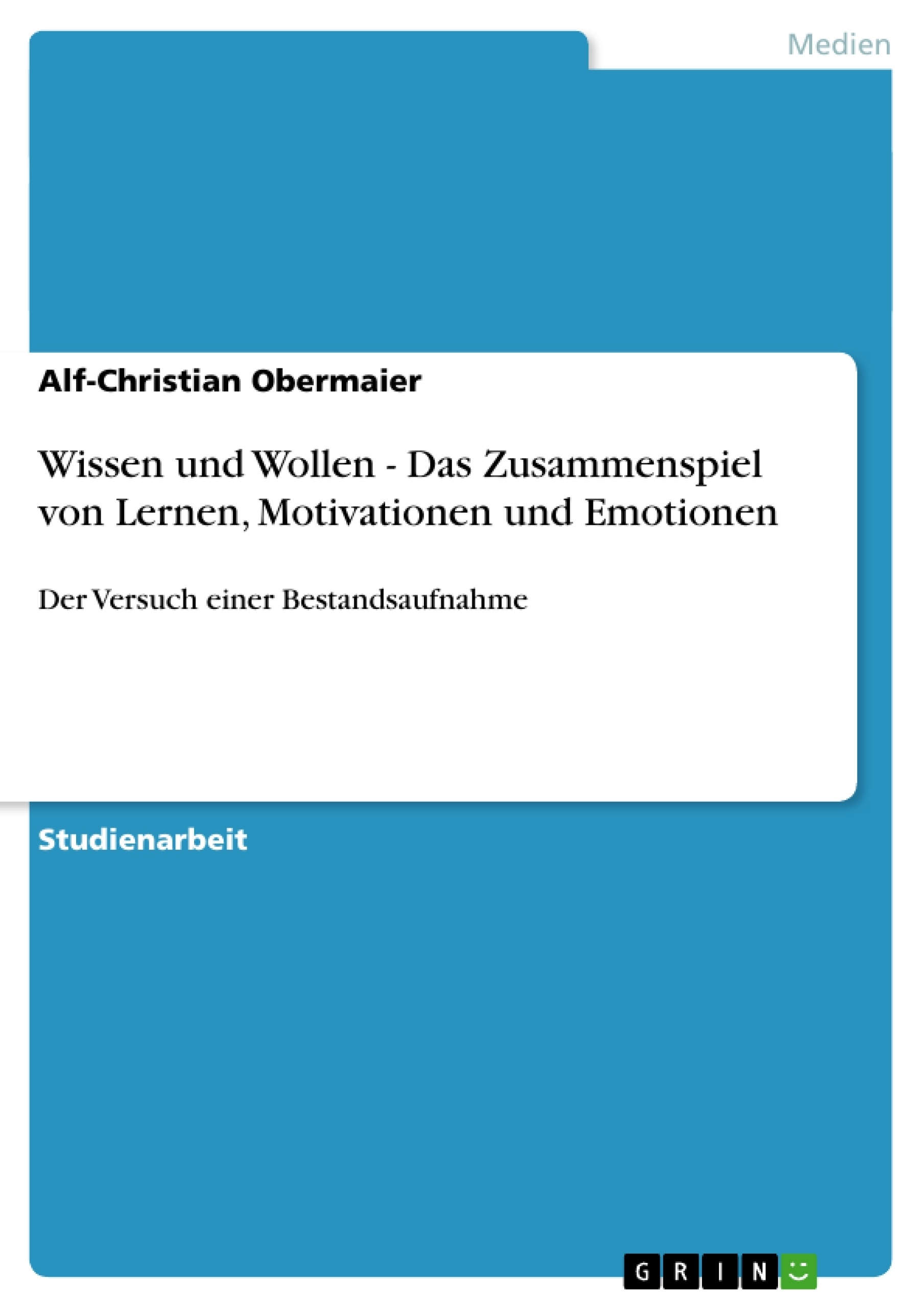Was ist Motivation? Eine Frage, die leicht auch ins Philosophische abdriften kann und die die Menschen zu jeder Zeit beschäftigt hat. Was bewegt den Mensch, was treibt ihn an? Dies sind die Fragen, die die Philosophen immer wieder in den Raum warfen, wenn Neuerungen das Leben der Menschen herausforderten.
Die Geschichtsschreibung kennt und unterscheidet die Phasen der Gesellschaftsformen und des Arbeitens.
Von der Agrargesellschaft zur Industrie- und nun zur Informationsgesellschaft führt der Weg der Neuerungen auf den diversen Gebieten menschlichen Zusammenlebens. Die Anforderungen sind andere als vor hundert Jahren, man fordert die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und die Zukunft den sich ständig neuen Aufgaben anpassenden Wissensarbeiter.
Was ist nun aber Motivation im engeren Sinne und wie wird mit dem Begriff in den Wissenschaften umgegangen? Welche Begriffe sind damit unabdingbar verknüpft und wie lässt sich das Beziehungsgeflecht zwischen der Motivation und den anderen Faktoren veranschaulichen und möglicherweise zu einem Modell des medialen Wissenserwerbs zusammenfügen? [...] Kommunikation ist eine kognitive Erfahrung; in der Erinnerung wird die Erfahrung mit dem zeitgleich erfahrenen Gefühl verknüpft und es entsteht ein Bild dieser Erfahrung. Dieses Bild beinflusst späteres Handeln. Dem Handeln liegt die Motivation zugrunde. Dementsprechend müsste Kommunikation zur Motivierung von Menschen zu bestimmtem Handeln beitragen können.
Diese Vorstellung ist nicht neu: mit dem Einsatz von Lob und Tadel wird in den Schulen gearbeitet, das Lob, aber auch die gemäßigte Kritik dienen dem Ansporn des Lernenden. Wir benutzen Kommunikation um Wirkungen zu erzielen, um zu motivieren.
Welche Wirkungen Kommunikation hat und insbesondere die Massenkommunikation wird weitgehend in der Werbung verarbeitet und angewendet und beschäftigt als Medienwirkungsforschung implizit auch die Kommunikationswissenschaft. Aufgrund der Komplexität der Fragestellung wird am Ende dieser Seminararbeit kein elaboriertes Modell zum Wissenserwerb stehen, allerdings kann und soll die Bandbreite des Bezugsspektrums aufgezeigt werden.
Wie diese Seminararbeit zeigen soll, gehört der Motivation eine Schlüsselrolle in kommunikationspsychologischen und pädagogischen Betrachtungen zugedacht. Die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft wächst, man spricht vom „Informationszeitalter“. Für den „Brainworker von morgen“ wird die Forderung nach der lebenslangen Lernbereitschaft zum existentiellen Kriterium der Überlebensfähigkeit. Auf dieser Ebene findet ein „fast ständiges“ Lernen statt und so kann man fragen, inwieweit für den Menschen im Informationszeitalter Lernen, und vorgelagert die Kommunikation, zum existenziellen Grundbedürfnis avanciert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionsversuche
- Emotion und Kognition
- Emotion und Motivation
- Triebtheoretische Auffassung von Motivation
- Die Hierarchie der Bedürfnisse nach Maslow
- Neugiermotivation
- Anreiztheoretisches Modell der Motivation
- Entscheidung und Handlungsregulation
- Leistungsmotivation
- Zum Unterschied von Leistungsmotivation und Machtmotivation
- Motivation und Kommunikation
- Kommunikation als Bestandteil motivationaler Vorgänge und die Medien
- Medialer Wissenserwerb
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Lernen, Motivation und Emotionen, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis des medialen Wissenserwerbs zu entwickeln. Dazu werden verschiedene Definitionen und Theorien zur Motivation beleuchtet und die Rolle der Kommunikation in diesem Kontext untersucht.
- Definitionen von Motivation und deren Verhältnis zu Emotion und Kognition
- Die Bedeutung von Motivation für den Wissenserwerb und die Rolle der Medien
- Der Einfluss von Kommunikation auf Motivation und emotionale Prozesse
- Die Bedeutung von Motivation für das Lernen im Informationszeitalter
- Interdisziplinäre Verknüpfungen der Motivationsforschung, insbesondere im Zusammenhang mit Lernprozessen und Glaubwürdigkeitsbeurteilung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie wirkt sich Motivation auf den medialen Wissenserwerb aus? Sie beleuchtet den historischen Wandel von der Agrar- zur Informationsgesellschaft und die damit verbundenen Anforderungen an den "Wissensarbeiter" von heute.
- Definitionsversuche: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Definitionen von Motivation und beleuchtet deren Verhältnis zu Emotion und Kognition. Es werden verschiedene motivationstheoretische Ansätze vorgestellt, darunter die Triebtheorie, Maslows Bedürfnishierarchie und das Anreiztheoretische Modell.
- Motivation und Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Motivation und Kommunikation. Es wird argumentiert, dass Kommunikation eine kognitive Erfahrung ist, die mit Emotionen verknüpft ist und somit Einfluss auf das Verhalten haben kann. Die Rolle der Medien in diesem Kontext, insbesondere im Hinblick auf den medialen Wissenserwerb, wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Motivation, Lernen, Emotion, Kognition, Kommunikation, Medien, Wissenserwerb, Informationszeitalter, Glaubwürdigkeitsbeurteilung und Selbstständigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Motivation beim medialen Wissenserwerb?
Motivation gilt als Schlüsselrolle, da sie das Handeln steuert und bestimmt, wie intensiv und nachhaltig Informationen aus Medien aufgenommen werden.
Wie hängen Emotionen und Kognition beim Lernen zusammen?
Erfahrungen werden in der Erinnerung mit zeitgleich erlebten Gefühlen verknüpft, wodurch ein Bild entsteht, das zukünftiges Handeln und Lernen beeinflusst.
Was besagt Maslows Bedürfnishierarchie im Kontext der Motivation?
Sie ordnet menschliche Bedürfnisse in Stufen ein, wobei das Erreichen höherer Stufen (wie Selbstverwirklichung) oft erst nach Befriedigung der Basisbedürfnisse motiviert.
Warum ist lebenslanges Lernen im Informationszeitalter so wichtig?
In der modernen Wissensgesellschaft ist ständige Anpassungsfähigkeit für „Wissensarbeiter“ ein existenzielles Kriterium für die berufliche Überlebensfähigkeit.
Kann Kommunikation zur Motivierung von Menschen beitragen?
Ja, durch gezielten Einsatz von Lob, Kritik oder Werbebotschaften kann Kommunikation genutzt werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen und Lernprozesse anzustoßen.
- Quote paper
- Alf-Christian Obermaier (Author), 2002, Wissen und Wollen - Das Zusammenspiel von Lernen, Motivationen und Emotionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93319