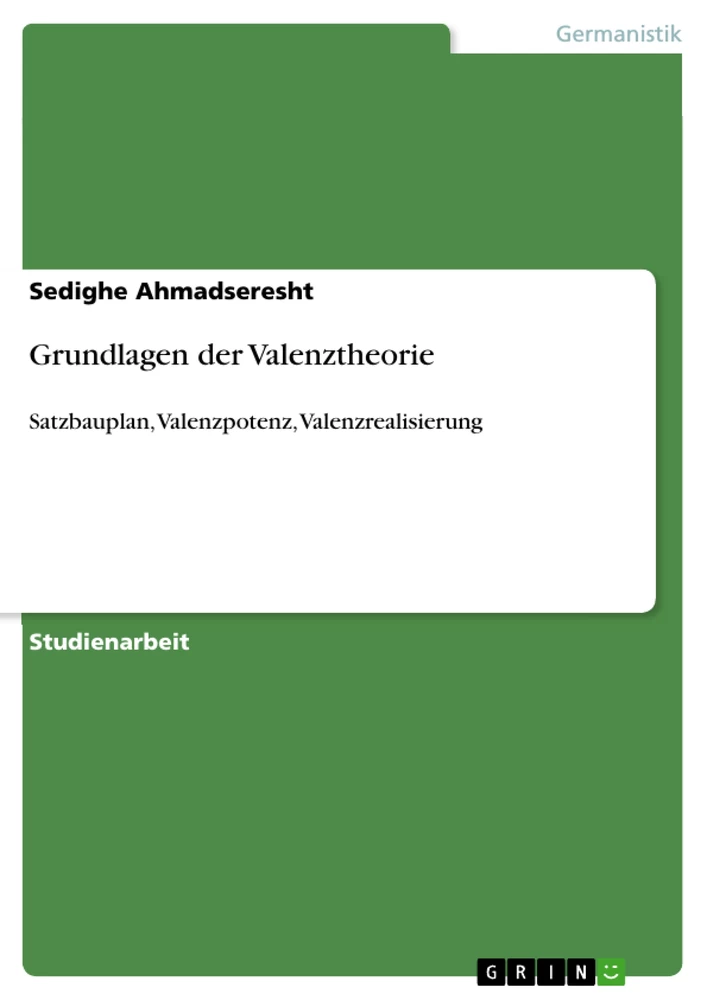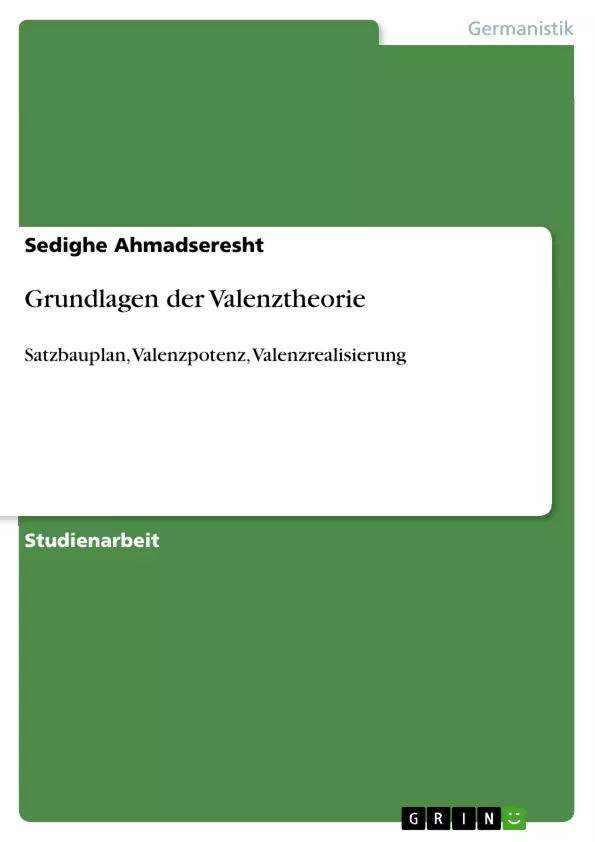In der nun folgenden Hausarbeit möchte ich die Grundlagen der Valenz-theorie, d. h. genau genommen die basalen Grundfragen der Valenzpotenz- und der Valenzrealisierungstheorie sowie auf den Satzbauplan darstellen.
„Die Theorie der strukturellen Valenzrealisierung hilft uns einzusehen, dass Sprachen einer 'gleichberechtigten' Untersuchung bedürfen und dass nur Theorien, die keine Sprache als Messlatte für andere Sprachen anlegen, überhaupt die Chance haben, adäquate Ergebnisse zu liefern.“ Basis für die Valenztheorie ist die Valenzidee. Diese besagt, „dass Wörter – vor allem Verben – die Satzstruktur prädeterminieren.“ Im weiteren Verlauf wird der Fokus auf die Kategorie Verb gelegt, um die Idee etwas präziser zu fassen. „Relationale Sprachzeichen, die der Kategorie Verb angehören, haben qua
ihres Aktantenpotenzials die Fähigkeit/Potenz, die semantische und syntaktische
Organisation des Satzes zu prädeterminieren.“
Diese Reformulierung beinhaltet zwei unterspezifizierte Größen. Zum einen
die Größe Y, die für die relationalen Sprachzeichen steht, die zu der Kategorie
Verb gehört, und zum anderen die Größe X, die für das Aktantenpotenzial
steht. Aus den beiden Größen X und Y ergeben sich zwei Grundfragen
für die Valenztheorie: Was ist das Aktantenpotenzial (X) und was sind
die relativen Sprachzeichen (Y)? Vilmos Àgel bezeichnet die relationalen Sprachzeichen als „verbale Valenzträger“ und das Aktantenpotenzial des ver-
balen Valenzträgers als „Valenz(potenz)“.4
Weiter werden zwei Grundfragen aufgestellt, „die das Verhältnis der Valenzpotenz
zu deren Realisierung betreffen“5: Zum einen stellt Vilmos Àgel die
Frage nach der strukturellen Valenzrealisierung, d. h. die Form und der Typ
der grammatischen Valenzrealisierung in den unterschiedlichen Sprachen
bzw. in den unterschiedlichen Varietäten einer Sprache. Die strukturelle
Valenzrealisierung impliziert die Valenz und die Sprachstruktur. Die zweite
Grundfrage bezieht sich auf die kontextuell-situative-Valenzrealisierung, d .h.
der Valenz in einem Text. Die Bedingungen für die Realisierbarkeit bzw.
Nichtrealisierbarkeit der Formen und Typen der grammatischen Valenzrealisierung
in Texten sollen hier näher betrachtet werden. Die Bedeutung der
Grundfragen der Valenzpotenztheorie und der Valenzrealisierungstheorie für
die Valenztheorie soll im weiteren Verlauf meiner Hausarbeit dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Grundfragen der Valenztheorie
- 2.1. Die Valenzpotenz- und die Valenzrealisierungstheorie
- 3. Die Valenzpotenztheorie
- 3.1. Relationale Sprachzeichen der Kategorie Verb
- 3.2. Das Aktantenpotenzial des verbalen Valenzträgers
- 3.2.1. Notwendigkeit (NOT)
- 3.2.2. Argumenthaftigkeit (ARG)
- 3.2.3. Formale Spezifizität (FOSP)
- 3.2.4. Inhaltliche Spezifizität (INSP)
- 3.2.5. Subklassenspezifik (SUBKLASS)
- 4. Die Valenzrealisierungstheorie
- 4.1. Die strukturelle Valenzrealisierung
- 4.2. Die kontextuell-situative-Valenzrealisierung
- 5. Der Satzbauplan
- 5.1. Das syntaktische Modell
- 5.2. Das semantische Modell
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Grundlagen der Valenztheorie, insbesondere die Valenzpotenz- und die Valenzrealisierungstheorie sowie den Satzbauplan. Der Fokus liegt auf der Kategorie Verb und der Prädetermination der Satzstruktur durch Wörter, insbesondere Verben. Die Arbeit analysiert die Interdependenz zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung und deren Auswirkungen auf die Satzstruktur in verschiedenen Sprachen.
- Valenzpotenz und deren Einfluss auf die Satzstruktur
- Valenzrealisierung und ihre strukturellen und kontextuellen Aspekte
- Das Verhältnis zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung
- Der Satzbauplan und seine syntaktischen und semantischen Modelle
- Vergleichende Betrachtung der Valenz in verschiedenen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und skizziert die zentralen Fragestellungen: die Grundlagen der Valenzpotenz- und Valenzrealisierungstheorie sowie den Satzbauplan. Sie betont die Bedeutung der Valenzidee, wonach Wörter, insbesondere Verben, die Satzstruktur prädeterminieren, und kündigt den Fokus auf die Kategorie Verb an. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Aspekten der Valenztheorie.
2. Die Grundfragen der Valenztheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Fragen der Valenztheorie. Es differenziert zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung und erläutert deren gegenseitige Abhängigkeit. Die Unterscheidung zwischen struktureller und kontextuell-situativer Valenzrealisierung wird eingeführt und als zentrale Thematik der weiteren Analyse hervorgehoben. Die Kapitel legt die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die essentiellen Konzepte der Valenztheorie definiert und ihre Interdependenzen aufzeigt.
3. Die Valenzpotenztheorie: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Valenzpotenztheorie, indem es das Aktantenpotenzial verbaler Valenzträger und deren Eigenschaften (Notwendigkeit, Argumenthaftigkeit, formale und inhaltliche Spezifität sowie Subklassenspezifität) analysiert. Die Kapitel untersucht, wie das Valenzkonzept verschiedene Arten der Rektionspotenz integrieren muss. Es veranschaulicht die hierarchische Natur der verbalen Valenz, indem es die Möglichkeit der Ergänzung und vertikalen Dominanz von verbalen Valenzträgern herausarbeitet. Die Diskussion von Infinitiven und Partizipialergänzungen bereichert das Verständnis der Komplexität des Valenzkonzepts.
4. Die Valenzrealisierungstheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den beiden Grundfragen der Valenzrealisierungstheorie: strukturelle und kontextuell-situative Valenzrealisierung. Es analysiert die Unterschiede in der Realisierung der Valenz in verschiedenen Sprachen am Beispiel von Italienisch und Deutsch. Die Diskussion über die kontextbedingte Anpassung der Grundstruktur durch Reduktion oder Expansion verdeutlicht die Abhängigkeit der strukturellen und kontextuellen Aspekte der Valenzrealisierung. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl die strukturellen als auch die kontextuellen Faktoren bei der Analyse der Valenz zu berücksichtigen.
5. Der Satzbauplan: Dieses Kapitel untersucht den Satzbauplan anhand syntaktischer und semantischer Modelle. Es beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Beschreibung der Satzstruktur und deren Beziehung zur Valenztheorie. Durch die Betrachtung syntaktischer und semantischer Modelle wird ein umfassendes Verständnis des Satzbaus im Kontext der Valenztheorie entwickelt.
Schlüsselwörter
Valenztheorie, Valenzpotenz, Valenzrealisierung, Satzbauplan, Verb, Aktantenpotenzial, strukturelle Valenzrealisierung, kontextuell-situative Valenzrealisierung, syntaktisches Modell, semantisches Modell, Rektionspotenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Valenztheorie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Grundlagen der Valenztheorie, mit besonderem Fokus auf die Valenzpotenz- und Valenzrealisierungstheorie sowie den Satzbauplan. Im Mittelpunkt steht die Kategorie Verb und die Prädetermination der Satzstruktur durch Wörter, insbesondere Verben. Analysiert wird die Interdependenz zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung und deren Auswirkungen auf die Satzstruktur in verschiedenen Sprachen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Valenzpotenz und ihren Einfluss auf die Satzstruktur, die Valenzrealisierung mit ihren strukturellen und kontextuellen Aspekten, das Verhältnis zwischen Valenzpotenz und Valenzrealisierung, den Satzbauplan mit seinen syntaktischen und semantischen Modellen und einen vergleichenden Blick auf die Valenz in verschiedenen Sprachen.
Welche Theorieansätze werden unterschieden?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen der Valenzpotenztheorie und der Valenzrealisierungstheorie. Die Valenzpotenztheorie befasst sich mit dem Aktantenpotenzial verbaler Valenzträger und ihren Eigenschaften (Notwendigkeit, Argumenthaftigkeit, formale und inhaltliche Spezifität, Subklassenspezifität). Die Valenzrealisierungstheorie betrachtet die strukturelle und kontextuell-situative Realisierung der Valenz.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundfragen der Valenztheorie, Valenzpotenztheorie, Valenzrealisierungstheorie, Satzbauplan und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Valenztheorie, beginnend mit einer Einführung und der Definition grundlegender Konzepte, um dann in eine detaillierte Analyse der einzelnen Komponenten einzutauchen.
Was sind die zentralen Ergebnisse der einzelnen Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und zentrale Fragestellungen. Kapitel 2 (Grundfragen): Differenzierung zwischen Valenzpotenz und -realisierung. Kapitel 3 (Valenzpotenztheorie): Analyse des Aktantenpotenzials verbaler Valenzträger. Kapitel 4 (Valenzrealisierungstheorie): Untersuchung der strukturellen und kontextuell-situativen Valenzrealisierung. Kapitel 5 (Satzbauplan): Betrachtung syntaktischer und semantischer Modelle des Satzbaus. Kapitel 6 (Zusammenfassung): Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Valenztheorie, Valenzpotenz, Valenzrealisierung, Satzbauplan, Verb, Aktantenpotenzial, strukturelle Valenzrealisierung, kontextuell-situative Valenzrealisierung, syntaktisches Modell, semantisches Modell und Rektionspotenz.
Welche Sprachen werden im Vergleich betrachtet?
Die Hausarbeit vergleicht die Valenzrealisierung exemplarisch am Beispiel von Italienisch und Deutsch.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit Linguistik, insbesondere mit Valenztheorie, beschäftigen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Aspekte der Valenztheorie und kann als Grundlage für weiterführende Studien dienen.
- Quote paper
- Sedighe Ahmadseresht (Author), 2008, Grundlagen der Valenztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93327