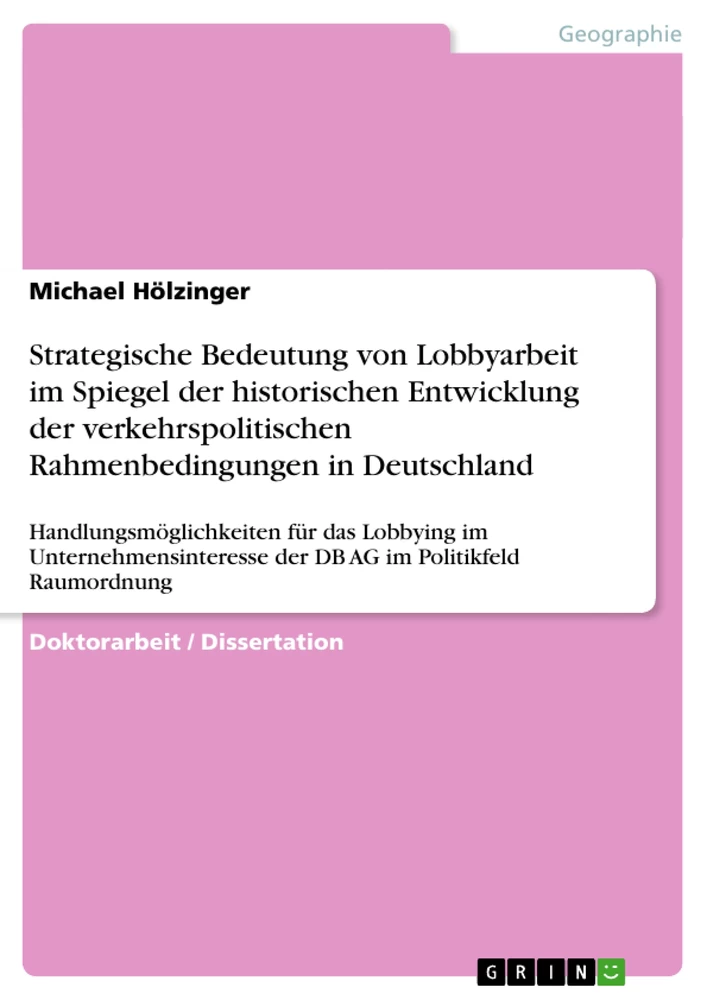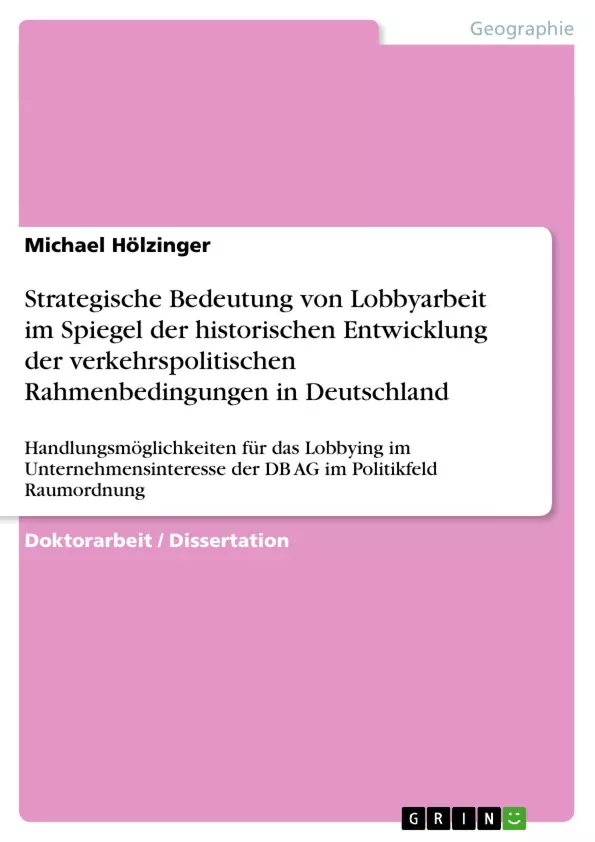Die Eisenbahn entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Landverkehrsträger mit überragender gesellschaftspolitischer Bedeutung. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert war der ehemals starke Einfluss privater Eisenbahnunternehmen nur noch gering. Verstaatlichte Bahnen waren der Regelfall. Interessengruppen, die die Verstaatlichungspolitik Bismarcks gefördert hatten, wurden dafür belohnt. Das Staatsmonopol behinderte private Kleinbahnen und produzierte im System Schiene viele Transportkettenbrüche. Die politische Einflussnahme der verstaatlichten – später verreichlichten – Bahnen beschränkte sich auf defensive Maßnahmen mit der Zielsetzung, Besitzstände zu wahren. Die Vertreter des aufstrebenden Kfz nahmen offensiv auf die politische Spitze Einfluss, um ihre Ideen und Pläne (z. B. von einem gesamtdeutschen Autobahnnetz) voranzubringen. Trotz der Behinderung durch die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft wurde das Kfz immer populärer. Im Dritten Reich setzte die Naziregierung auf das Auto und ließ – mit maßgeblicher Unterstützung durch die Reichsbahn – den Grundstein für das deutsche Autobahnnetz legen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die dualistische Verkehrsmarktordnung bestehen. Auto- und straßenbauaffine Verbände erlangten immer größeren Einfluss auf die deutsche Verkehrspolitik. Die Behörde „Bundesbahn“ verhielt sich vergleichsweise passiv und setzte fast keine eigenen offensiven Akzente in wichtigen verkehrspolitischen Prozessen. Die Auto- und Straßenbaulobbyarbeit war sehr erfolgreich (Beispiel: Einführung der Kilometerpauschale). Verkehrspolitik gab es im Bereich des Güterverkehrs immer noch eine Schutzpolitik für die Schiene, die sich in zahlreichen Behinderungen für den gewerblichen Straßengüterverkehr ausdrückte. Erst mit den Arbeiten der Regierungskommission Bundesbahn gelang es Interessenvertretern der Eisenbahn, offensiv und aktiv an einem wichtigen verkehrspolitischen Prozess mitzuwirken. Kennzeichen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit von modernen Großunternehmen ist ihr dialogorientierter Charakter. Auf Seiten vieler Mitarbeiter der DB AG aber auch bei vielen politischen Entscheidern herrscht auch im Jahr 2001 noch „Bundesbahndenken“ vor.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1:
- 1 Titel und Inhalt
- 2 Einleitung und Methodik
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Untersuchungsbereich und Zielsetzung der Arbeit
- 2.3 Methodik der Arbeit
- 3 Teil II - Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
- 3.1 Teil III – Lobbyarbeit im politischen Prozess
- 3.2 Teil IV - Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Politikfeld Raumordnung
- 3.3 Charakter dieser Arbeit
- 4 Hintergrund der durchgeführten Expertenbefragungen
- 4.1 Auswahl und Herleitung der Vorgehensweise
- 4.2 Strategie der Datenerhebung und -gewinnung
- 4.2.1 Literaturrecherche und qualitative Befragungen
- 4.2.2 Problemzentrierte Interviews als Spezialfall qualitativer Befragungen
- 4.2.3 Arbeitsthesen für den Gesprächsleitfaden zu Beginn der Befragungen
- 4.2.4 Entwicklung der Arbeitsthesen in der Interviewphase
- 4.2.5 Auswahl der Interviewpartner – Das Interviewsample
- 4.2.6 Praktische Erfahrungen während der Interviewführung
- 4.2.6.1 Kontaktaufnahme
- 4.2.6.2 Verlauf der Gespräche
- 4.2.6.3 Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse
- Teil 2: Historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
- 5 Epoche I (von den Anfängen bis 1840)
- 5.1 Vom Altertum bis zur Industriellen Revolution
- 5.2 Ausgangslage
- 5.2.1 Politische Situation in Deutschland
- 5.2.2 Erste Eisenbahnen und ihre Folgen für die Transporteffizienz
- 5.3 Die frühen deutschen Eisenbahnen
- 5.4 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb
- 5.4.1 Die ersten Betriebsformen
- 5.4.2 Die historischen Umwege
- 5.5 Die ersten,,Eisenbahnlobbyisten❞
- 5.5.1 Wegbereiter für die Eisenbahn in der Anfangszeit des Schienenverkehrs ...
- 5.5.2 und die Widerstände in der öffentlichen Meinung
- 6 Epoche II (1840 bis 1880)
- 6.1 Weiter fortschreitende Erschließung Deutschlands mit der Eisenbahn
- 6.1.1 Ursachen
- 6.1.2 Auswirkungen
- 6.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung des Eisenbahnbaus
- 6.2.1 Wirtschaftsfaktor Eisenbahn
- 6.2.2 Missstände im Eisenbahnwesen
- 6.3 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb der Eisenbahn
- 6.3.1 Konkurrenzfähigkeit gegenüber den anderen Verkehrsträgern
- 6.3.2 Weiterentwicklung von Technik und Betriebsformen
- 6.4 Zunehmende Unterschiede zwischen Staatsinteresse und Interesse der privaten Eisenbahnbetreiber – Die Reichseisenbahnfrage
- 6.4.1 Eisenbahnpolitik Bismarcks
- 6.4.1.1 Bestrebungen hin zu einer einheitlichen Eisenbahn in Deutschland
- 6.4.1.2 Das Reichseisenbahnamt
- 6.4.2 Bedeutung militärischer Aspekte
- 6.4.3 Die ersten Schritte auf dem Weg zur verstaatlichten Eisenbahn
- 6.4.3.1 Reichseisenbahngesetzentwurf vom März 1874
- 6.4.3.2 Der,,Vorläufige Entwurf eines Reichseisenbahngesetzes“ vom April 1875
- 6.4.3.3 Das Gesetz, die Übertragung der Eigentums- und sonstigen Rechte des Staates an das Deutsche Reich vom Juni 1876
- 6.4.3.4 Der Reichseisenbahngesetzentwurf vom Mai 1879
- 6.4.4 Bestimmende Faktoren, Hintergründe, Motivation und Interessenkonstellationen der Eisenbahnpolitik Bismarcks
- 6.4.4.1 Auswirkungen des Eisenbahnbooms auf das Systembild und die Kundenqualität
- 6.4.4.2 Interessengruppen und ihr Einfluss auf das Eisenbahnwesen
- 6.4.4.3 Interessenkonstellationen bei Verstaatlichung der preußischen Privatbahnen
- 6.4.1 Eisenbahnpolitik Bismarcks
- 7 Epoche III (Glanzzeit der Länderbahnen - Anfänge des motorisierten Straßenverkehrs 1880 bis 1920)
- 7.1 Fortführung der Verstaatlichung der Eisenbahnen
- 7.1.1 Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen privaten Eisenbahngesellschaften
- 7.1.1.1 Versuche, den Wettbewerb im Eisenbahnwesen zu fördern
- 7.1.1.2 Verlauf und Folgen der Verstaatlichung der preußischen Privatbahnen
- 7.1.2 Das Prinzip der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung und die ersten Versuche seiner Umsetzung im Eisenbahnwesen
- 7.1.3 Lobbying von Wirtschaftsverbänden im Kaiserreich
- 7.1.3.1 Einfluss von Interessengruppen auf das Tarifsystem der Reichsbahn
- 7.1.3.2 Ausnahmetarife
- 7.1.1 Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen privaten Eisenbahngesellschaften
- 7.2 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb der Eisenbahn
- 7.2.1 Fernbahnbau und Zweigleisigkeit
- 7.2.2 Weiterentwicklung von Technik und Betrieb
- 7.2.3 Nebenbahnen
- 7.2.4 Gesetzliche Grundlagen für den Bau und den Betrieb von Kleinbahnen
- 7.2.4.1 Eisenbahnbetrieb in der Zeit vor dem Preußischen Kleinbahngesetz
- 7.2.4.2 Das Preußische Kleinbahngesetz von 1892
- 7.2.4.3 Betrieb der Kleinbahnen
- 7.3 Volkswirtschaftliche Bedeutung und gesellschaftliches Ansehen der Eisenbahn
- 7.3.1 Wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn
- 7.3.2 Erschließungsfunktion der Eisenbahn
- 7.3.3 Bedeutung der Eisenbahn für den Staatshaushalt
- 7.4 Die Anfänge des motorisierten Straßenverkehrs
- 7.4.1 Die ersten Kraftfahrzeuge
- 7.4.2 Straßenbau im 18. Jahrhundert
- 7.4.3 Entwicklung des motorisierten Straßenverkehrs
- 7.4.3.1 Ausgangslage zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 7.4.3.2 Das Ansehen des Automobils in der öffentlichen Meinung
- 7.4.3.3 Erste Versuche, den Straßenbau anzukurbeln
- 7.4.4 Entwicklung der Kfz-Besteuerung
- 7.4.4.1 Anfänge und erste Formen der Besteuerung
- 7.4.4.2 Luxusumsatzsteuer
- 7.4.4.3 Einfluss von Interessengruppen auf die Besteuerung von Kraftfahrzeugen
- 7.4.5 Exkurs: Bedeutung des Automobils in den Vereinigten Staaten um 1920
- 8 Epoche IV (1920 bis 1933)
- 8.1 Bedeutende Entwicklungen im Verkehrswesen
- 8.1.1 Verreichlichung der Eisenbahnen
- 8.1.2 Aufkommende Konkurrenz durch den Kraftwagen und Trennung in Nah- und Fernverkehr
- 8.1.2.1 Entwicklung der Verkehrsverhältnisse im Personenverkehr
- 8.1.2.2 Wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
- 8.1.3 Entwicklung der Verkehrspolitik - Verkehrsträger im Wettbewerb
- 8.1.3.1 Die Anfänge des Straßengüterverkehrs
- 8.1.3.2 Beginnender Strukturwandel im Verkehrsbereich
- 8.1.4 Reaktionen der DRG auf die Konkurrenz im Güterverkehr
- 8.1.4.1 1924 Der Deutschland-Vertrag
- 8.1.4.2 1931 - 3. Brüningsche Notverordnung
- 8.1.4.3 1931 - Der Schenker-Vertrag
- 8.2 Die DRG
- 8.2.1 Die Gründung des Unternehmens
- 8.2.2 Rechtsstellung und Grundsätze der Geschäftsführung
- 8.2.3 Die Deutsche Reichsbahn als Reparationsobjekt
- 8.3 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Verkehrsträger
- 8.3.1 Dualistische Verkehrsmarktordnung
- 8.3.2 Eisenbahn
- 8.3.2.1 Systembild, Leistungsangebot und Betrieb
- 8.3.2.2 Politische Behandlung der Eisenbahn
- 8.3.3 Der Kraftwagen setzt sich allmählich durch
- 8.3.3.1 Güterverkehr
- 8.3.3.2 Personenverkehr
- 8.1 Bedeutende Entwicklungen im Verkehrswesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation von Michael Hölzinger untersucht die strategische Bedeutung von Lobbyarbeit im Verkehrssektor. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland und beleuchtet dabei die Rolle des Lobbying im Unternehmensininteresse der DB AG im Politikfeld Raumordnung.
- Die historische Entwicklung des Lobbyings im Verkehrssektor in Deutschland
- Die Bedeutung von Lobbyarbeit für Unternehmen wie die DB AG
- Die Auswirkungen von Lobbying auf die verkehrspolitische Rahmenbedingungen
- Die Herausforderungen und Chancen des Lobbyings im Politikfeld Raumordnung
- Die Entwicklung von Strategien für effektives Lobbying im Unternehmensininteresse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Teil 1 beleuchtet die Methodik der Arbeit und stellt die Zielsetzung der Untersuchung vor. Außerdem werden die historischen Entwicklungen der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland sowie die Bedeutung des Lobbying im politischen Prozess und im Politikfeld Raumordnung erläutert.
Teil 2 konzentriert sich auf die historische Entwicklung des Lobbyings im Verkehrssektor in Deutschland. Die Arbeit betrachtet die Epochen I (von den Anfängen bis 1840), II (1840 bis 1880), III (1880 bis 1920) und IV (1920 bis 1933) und analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Verkehrswesens, die Rolle des Lobbyings und die Bedeutung der Eisenbahn im Kontext der jeweiligen Epoche.
Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung des Eisenbahnwesens, der Verstaatlichung der Eisenbahnen, dem Aufstieg des motorisierten Straßenverkehrs und den Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsträgern. Außerdem werden die Volkswirtschaftliche Bedeutung und das gesellschaftliche Ansehen der Eisenbahn im Laufe der Zeit beleuchtet.
Die Arbeit konzentriert sich auf die historische Entwicklung des Lobbyings im Verkehrssektor. Die Untersuchung von aktuellen Entwicklungen und den Einfluss der DB AG im Politikfeld Raumordnung wird in den späteren Kapiteln der Dissertation behandelt, die in diesem Preview nicht enthalten sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit von Michael Hölzinger beschäftigt sich mit den Themen Lobbying, Verkehrspolitik, Raumordnung, Eisenbahn, Deutsche Bahn AG, Geschichte des Verkehrswesens, Interessenkonflikte, Politikfeldanalyse, strategisches Management.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich das Lobbying im Verkehrssektor historisch?
Im 19. Jahrhundert dominierten Eisenbahnlobbyisten. Später nutzten Kfz-Interessenten offensives Lobbying, um das Autobahnnetz voranzubringen, während die Bahn oft defensiv agierte.
Was versteht man unter dem Begriff „Bundesbahndenken“?
Es beschreibt eine passive, behördenähnliche Einstellung bei Mitarbeitern und Entscheidern, die eher auf Besitzstandswahrung als auf moderne, dialogorientierte Lobbyarbeit setzt.
Welche Rolle spielten die Naziregierung und die Reichsbahn beim Autobahnbau?
Die Naziregierung priorisierte das Auto, wobei die Reichsbahn paradoxerweise maßgeblich am Bau des Grundsteins für das Autobahnnetz mitwirkte.
Wie beeinflussten Interessengruppen die Besteuerung von Kraftfahrzeugen?
Bereits in der frühen Phase des motorisierten Verkehrs nahmen Verbände massiv Einfluss auf Steuerformen wie die Luxusumsatzsteuer, um die Verbreitung des Automobils zu fördern.
Welche Methodik wurde für diese Forschungsarbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche sowie qualitativen, problemzentrierten Experteninterviews mit einem spezifischen Interviewsample.
- 7.1 Fortführung der Verstaatlichung der Eisenbahnen
- 6.1 Weiter fortschreitende Erschließung Deutschlands mit der Eisenbahn
- 5 Epoche I (von den Anfängen bis 1840)
- Arbeit zitieren
- Michael Hölzinger (Autor:in), 2002, Strategische Bedeutung von Lobbyarbeit im Spiegel der historischen Entwicklung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93363