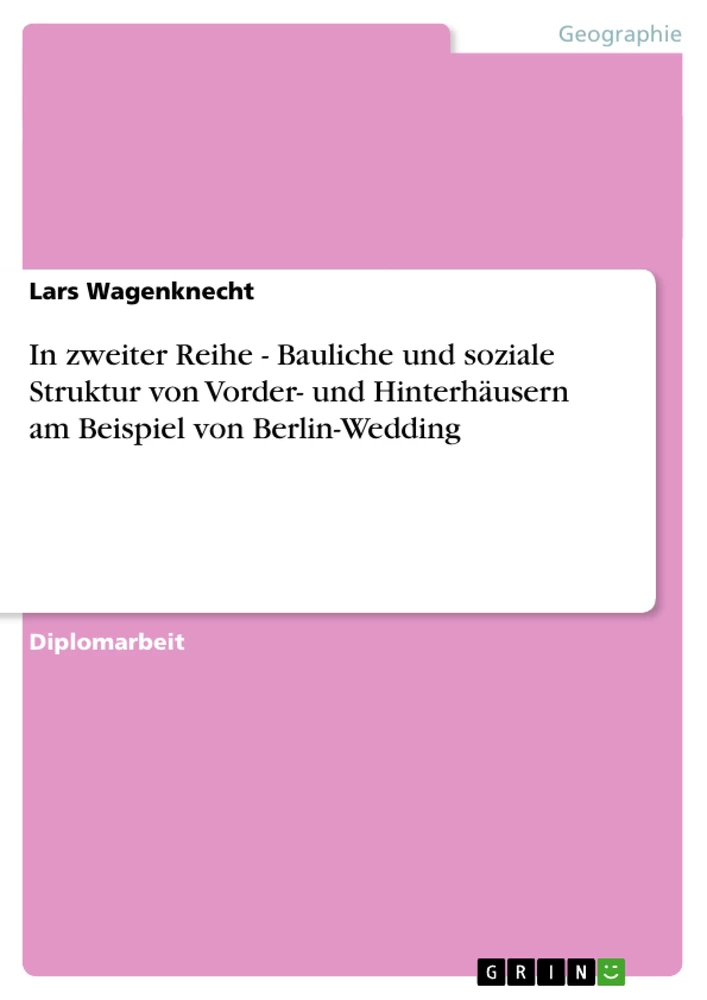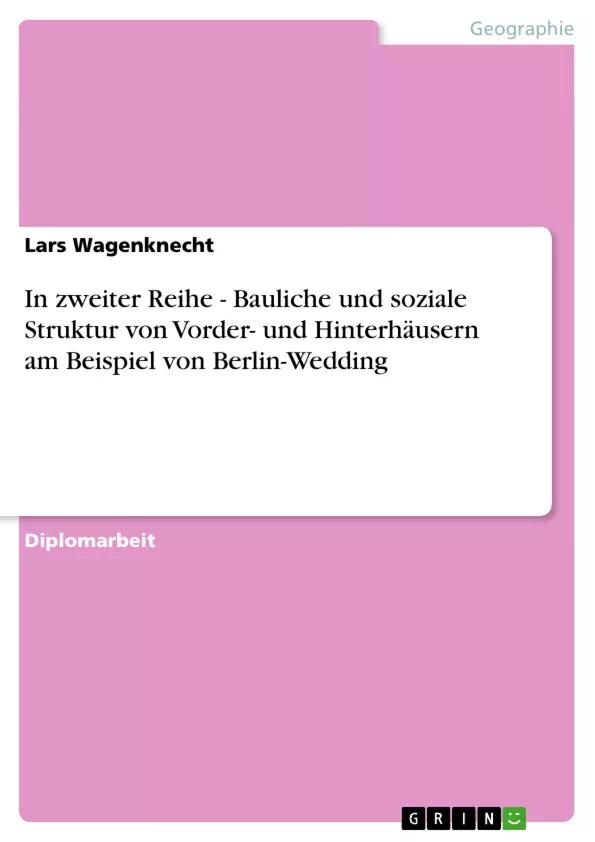In keiner anderen deutschen Großstadt wohnt nach wie vor ein derartig hoher Anteil der Bevölkerung in Häusern, die vom Straßenraum meist nicht sichtbar sind. Gemeint sind die hinteren Gebäudeteile der gründerzeitlichen Mietshausbebauung Berlins. Kriegszerstörung und „Kahlschlagsanierung“ sorgten zwar auch hier für eine grundlegende Umformung ganzer Stadtteile. Und auch die in einigen Fällen erfolgte Entkernung der Blockinnenbereiche trug mancherorts zur Veränderung der ursprünglichen Baustruktur bei. Dennoch existiert auch heute noch ein imposanter städtischer Raum geschlossener und dichter Hinterhofbebauung, die zahlreiche Quartiere Berlins maßgeblich prägt.
Der Bautyp des Berliner Mietshauses sorgte in der wilhelminischen Epoche für eine klare Trennung der Bewohner nach sozialen Klassen innerhalb eines Gebäudes. Hinter der prunkvoll anmutenden Fassade des Vorderhauses mit seinen meist wohlhabenden Bewohnern der oberen und mittleren Schicht versteckten sich oft mehrere Hinterhäuser, in denen die Arbeiterklasse in kleinen 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen Unterkunft fand. Diese Wohnkonstellation beschrieb James Hobrecht seinerzeit als äußerst vorteilhafte Mischung, von der beide Seiten profitieren und die der Entstehung nach Klassen getrennter Viertel entgegenwirken sollte. Diese viel diskutierte Sichtweise verweist auf den Kernpunkt der aktuellen Untersuchung, auf die Frage nach der integrativen Funktion des Berliner Mietshauses. Lässt sich die relative Mischung der Bevölkerung in den gründerzeitlichen Stadtgebieten Berlins durch diesen Gebäudetyp mit seinen unterschiedlichen Wohnqualitäten und einer dadurch existierenden kleinräumlichen Segregation zwischen den Bewohnern im Vorder- und Hinterhaus erklären?
Ein weiteres Erkenntnisinteresse der Untersuchung besteht in der Frage, welche individuell unterschiedlich bewerteten Faktoren einer Wohnung bei der Wohnstandortwahl hinsichtlich der Lage im Vorder- oder Hinterhaus eine Rolle spielen. Zudem gilt es die Qualität der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Bewohnern eines aus getrennten Gebäudeteilen bestehenden Hauses zu analysieren. Dies ist insofern wichtig, weil erst dadurch die Relevanz einer möglichen Segregation auf der Ebene von Häusern nachweisbar ist.
Das praxisrelevante Ziel der Untersuchung ist darauf ausgerichtet, Aussagen über den gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf des vorhandenen Wohnraumes in Hinterhäusern für den Berliner Wohnungsmarkt zu treffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Das Berliner Mietshaus: Entstehung, Bautyp und Sozialstruktur
- Entstehungsbedingungen des Berliner Mietshauses
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Industrialisierung und Zuwanderung
- Wohntradition und Bauweise in der „alten Kernstadt“
- Grundlage der Bebauung: der Bebauungsplan von 1862 (BP 1862)
- Der Einfluss der Bauordnungen und der kommunalen Steuern
- Der spekulative Mietshausbau
- Der Gebäudetyp Mietskaserne: Baustruktur und regionale Verbreitung
- Die Gebäudestruktur des Berliner Mietshauses
- Die Ausdehnung des wilhelminischen Mietskasernengürtels in Berlin
- Die regionale Verbreitung der Mietskaserne außerhalb Berlins
- Soziale Mischung in einem Haus – Idee oder Realität?
- Entstehungsbedingungen des Berliner Mietshauses
- Segregation - Theorie der Gesellschaftsverteilung im Raum
- Gegenstand und Problemstellung der Segregationsforschung
- Begriffsbestimmung und Messung
- Die Dimensionen residentieller Segregation und deren Bestimmung
- Bestimmung sozialer Unterschiede
- Bestimmung demografischer Unterschiede
- Bestimmung ethnischer Unterschiede
- Bewertung und Folgen von Segregation
- Segregationsforschung auf Mikroebene
- Vertikale Segregation
- Die sozialtopografische Untersuchung von Frieling
- Sozialräumliche Distanz und nachbarschaftliche Kontakte
- Arbeitshypothesen
- Allgemeine Grundhypothesen
- Einfluss des Bauzustandes der Gebäude
- Motive bei der Wohnstandortwahl nach Vorder- und Hinterhaus
- Vorgehensweise und Methodik der Untersuchung
- Sekundäranalyse
- Primärerhebung
- Sekundärstatistische Analyse
- Charakterisierung des Untersuchungsraumes
- Bau- und Sozialgeschichte des Stadtteils Wedding
- Behutsame Stadterneuerung in Berlin - Wedding
- Bevölkerungsstruktur und Wohnungsleerstand in Berlin - Wedding
- Einwohnerentwicklung, Wohnungsleerstand und Ausländeranteil
- Altersstruktur und Haushaltsgröße
- Merkmale zur sozialen Situation der Bewohner
- Bevölkerungsstruktur und Wohnungsausstattung im Vorder- und Hinterhaus in fünf ehemaligen Sanierungsgebieten in Berlin - Wedding
- Demografische Struktur der Bewohner im Vorder- und Hinterhaus
- Wohnungs- und Haushaltsgrößen
- Alter der Bewohner
- Haushaltstypen
- Wohnmobilität im Vorder- und Hinterhaus
- Soziale Struktur der Bewohner im Vorder- und Hinterhaus
- Wohnungsmieten
- Einkommensverhältnisse
- Bildung und Qualifikation der Bewohner
- Erwerbstätigkeit und sozialer Status der Bewohner
- Ethnische Struktur der Bewohner im Vorder- und Hinterhaus
- Ausstattung und Zustand der Wohnungen im Vorder- und Hinterhaus
- Zwischenfazit
- Demografische Struktur der Bewohner im Vorder- und Hinterhaus
- Ergebnisse der Kartierung und Bewohnerbefragung im Untersuchungsgebiet Malplaquetstraße
- Methodische Vorgehensweise der Erhebung
- Das Untersuchungsgebiet Malplaquetstraße
- Gebäudezustand und Wohnungsleerstand der Vorder- und Hinterhäuser
- Baulicher Zustand der Gebäude
- Wohnungsleerstand
- Wohnungswahl, Wohnzufriedenheit und Nachbarschaft hinsichtlich der Lage der Wohnung im Vorder- oder Hinterhaus
- Motive bei der Wohnungswahl und Wohnzufriedenheit
- Nachbarschaftliche Beziehungen im Haus
- Meinungsbild zu Unterschieden zwischen Vorderhaus und Hinterhaus
- Zwischenfazit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob innerhalb des Berliner Mietshauses, einem prägenden Element der Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert, heute noch kleinräumige soziale, demografische oder ethnische Unterschiede zwischen den Bewohnern von Vorder- und Hinterhäusern auftreten. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, welche Faktoren die Bewohnerverteilung innerhalb der Gebäude beeinflussen und welche Folgen diese für die soziale und demografische Entwicklung der Stadtgebiete haben.
- Die Untersuchung analysiert die aktuelle Bevölkerungsstruktur in verschiedenen ehemaligen Sanierungsgebieten im Berliner Stadtteil Wedding.
- Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des baulichen Zustandes der Gebäude auf die Bewohnerverteilung.
- Die Untersuchung analysiert die Motive der Bewohner bei der Wohnstandortwahl und deren Bewertung verschiedener Wohnungsfaktoren.
- Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Nachbarschaft für verschiedene Bewohnergruppen und die Intensität sozialer Beziehungen innerhalb eines Hauses.
- Die Untersuchung zielt darauf ab, Erkenntnisse über die gegenwärtige und zukünftige Nutzung von Hinterhauswohnungen im Berliner Wohnungsmarkt zu gewinnen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: In diesem Kapitel wird die Fragestellung der Diplomarbeit eingeführt und die Bedeutung der Untersuchung des Berliner Mietshauses im Kontext der Segregationsforschung erläutert.
- Kapitel 2: Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des Berliner Mietshauses. Es werden die wichtigsten Faktoren und Rahmenbedingungen, die zur Entstehung dieses Gebäudetyps beigetragen haben, aufgezeigt. Weiterhin wird die charakteristische Baustruktur des Berliner Mietshauses und seine regionale Verbreitung beschrieben.
- Kapitel 3: In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen der Segregationsforschung vorgestellt. Es erfolgt eine Erläuterung des Forschungsgegenstandes und eine Bestimmung des Begriffes Segregation. Weiterhin werden die verschiedenen Dimensionen der Segregation und ihre Messung sowie die Folgen von Segregation erläutert.
- Kapitel 4: Kapitel 4 leitet die Grundhypothesen und weiterführenden Annahmen der Untersuchung ab, die sich auf die Frage nach einer kleinräumlichen, horizontalen Segregation innerhalb des Berliner Mietshauses beziehen.
- Kapitel 5: In Kapitel 5 wird die Vorgehensweise und Methodik der empirischen Untersuchung dargestellt. Es werden die Sekundäranalyse von Daten aus fünf ehemaligen Sanierungsgebieten im Stadtteil Wedding und die ergänzende Primärerhebung in Form einer Kartierung und schriftlichen Bewohnerbefragung in zwei Blöcken der Malplaquetstraße beschrieben.
- Kapitel 6: Kapitel 6 widmet sich der Charakterisierung des Untersuchungsraumes, dem Berliner Stadtteil Wedding. Es werden die historische Entwicklung des Stadtteils, die Stadterneuerungspraxis in den ausgewählten Gebieten und die aktuelle Bevölkerungsstruktur dargestellt.
- Kapitel 7: Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Sekundäranalyse von Daten einer vom BfsS durchgeführten Haushaltsbefragung in den fünf ehemaligen Sanierungsgebieten. Es werden die Unterschiede zwischen den Bewohnern von Vorder- und Hinterhäusern hinsichtlich demografischer, sozialer und ethnischer Merkmale untersucht.
- Kapitel 8: Kapitel 8 widmet sich den Ergebnissen der Kartierung und schriftlichen Bewohnerbefragung im Untersuchungsgebiet Malplaquetstraße. Es werden die Unterschiede zwischen den Bewohnern von Vorder- und Hinterhäusern hinsichtlich des baulichen Zustandes der Gebäude, des Wohnungsleerstandes, der Motive bei der Wohnstandortwahl und der nachbarschaftlichen Beziehungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung der kleinräumlichen Unterschiede zwischen den Bewohnern von Vorder- und Hinterhäusern innerhalb des Berliner Mietshauses. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Segregation, Sozialraum, Sozialstruktur, Bevölkerungsstruktur, Baustruktur, Demografie, Wohnungsgröße, Wohnmobilität, Ausstattungsmerkmale, Mietpreis, Wohnstandortwahl, Nachbarschaft, Kontaktintensität, Wohnzufriedenheit, Wohnungsleerstand, Stadterneuerung.
- Citation du texte
- Dipl.-Geograph Lars Wagenknecht (Auteur), 2007, In zweiter Reihe - Bauliche und soziale Struktur von Vorder- und Hinterhäusern am Beispiel von Berlin-Wedding, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93365