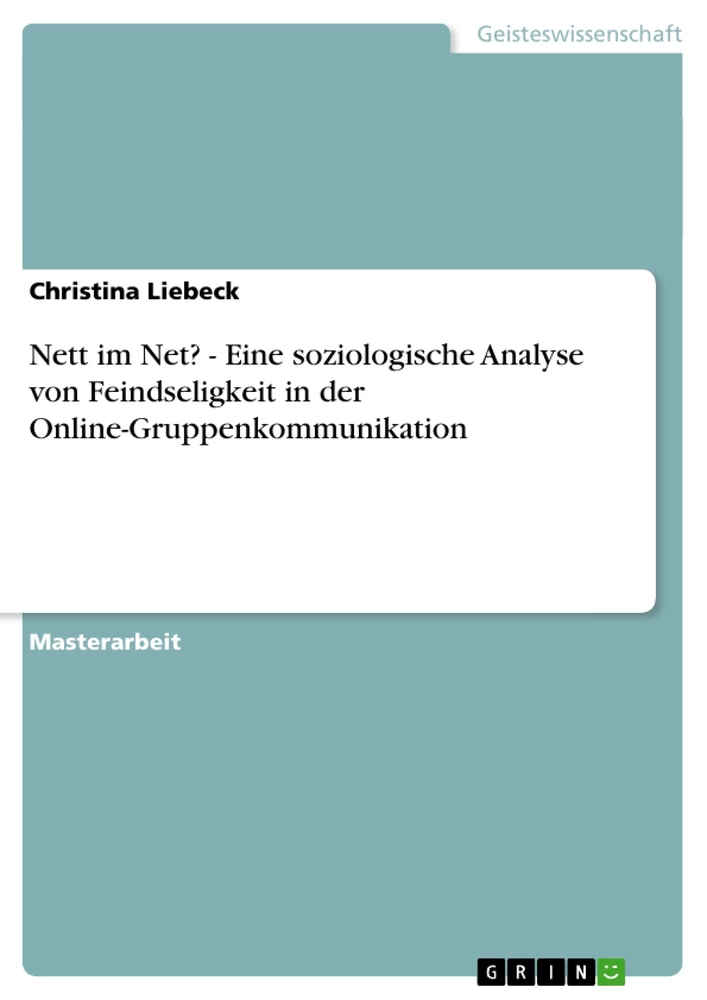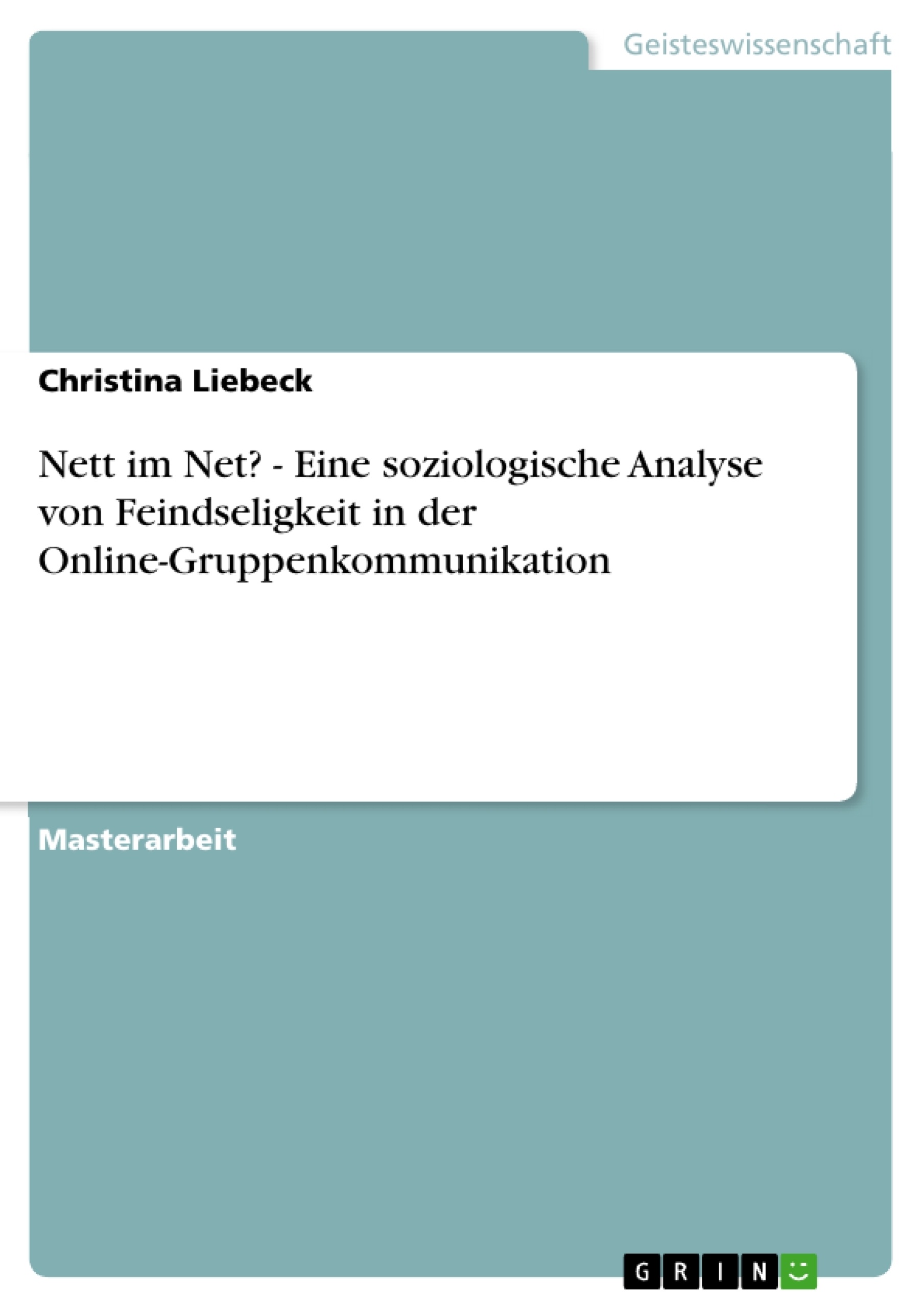Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Feindseligkeit in der Internet-Gruppenkommunikation. Schon in den 1980er Jahren wurde die Frage, ob das Internet als Mittler sozialer Kommunikation nützt oder ob es schadet, ob es Beziehungen fördert oder diese zerstört, ausführlich und kritisch diskutiert. Zahlreiche Forschungsarbeiten der 90er Jahre beschäftigen sich mit den „netten“ Seiten des Internet und untersuchen Freundschaften, Hilfsbereitschaft, soziale und emotionale Unterstützung (zum Beispiel bei Parks und Floyd 1996, Rheingold 1994, Turkle 1998, Döring 1999).
Andere Ansätze kritisieren gegenläufige Phänomene wie die befürchtete Zerstörung zwischenmenschlicher Beziehungen, Anonymität und Entfremdung oder das hohe Konfliktpotential von rein textbasierter Kommunikation (zum Beispiel bei Kraut et al. 1998, Müllert 1984, Mettler-Meibom 1990). Online-Gemeinschaften können ihren Mitgliedern materielle und emotionale Gratifikationen bieten (Matzat 2000: 11ff); sie bewegen sich zwischen Extremen von Netz-Anonymität und gesteigerter Intimität. Zugleich führen sie einen ständigen Kampf gegen „Spammer“, „Trolle“, streitlustige Verfasser von so genannten „Flames“ und andere virtuelle Unruhestifter.
Dass Feindseligkeit im Internet eine ernstzunehmende Bedrohung für virtuelle Gemeinschaften und soziale Prozesse sein kann, zeigen die Beispiele von einzelnen feindseligen Konflikten, die zum Ende einer ganzen virtuellen Gruppe führten (vgl. hierzu Kapitel 3.2.4). In welchem Zusammenhang und unter welchen Umständen feindseliges Verhalten in Online-Communities auftritt, wurde bisher noch nicht erschöpfend diskutiert.
Diese Arbeit konzentriert sich in ihrem empirischen Teil in Anlehnung an eine Studie zum Thema Empathie und Feindseligkeit von Jennifer Preece und Kambiz Ghozati (2001) auf vier Fragen:
- Wirkt sich eine Einbettung von Online-Gemeinschaften in Offline-Strukturen positiv gegen das Auftreten von Feindseligkeit aus?
- Spielt es eine Rolle, ob den Mitgliedern einer Online-Gruppe die Möglichkeit zum Ausdruck ihrer virtuellen Identität gegeben ist?
- Kann eine moderierende Struktur mit mehreren Hierarchie-Ebenen Feindseligkeit wirkungsvoller verhindern als ein einziges moderierendes Amt in einer Online-Gruppe?
- Kann ein expliziter Hinweis auf die Netiquette oder ähnliche Regeln innerhalb eines Internet-Diskussionsforums feindseliges Verhalten verhindern helfen?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1 Einleitung und Fragestellung
- 0.2 Aufbau der Arbeit
- 1. Einführung in das Thema Feindseligkeit
- 1.1 Definition von Feindseligkeit
- 1.2 Emotionen in der Soziologie
- 1.3 Feindseligkeit als soziologisches Phänomen
- 2. Theorie der Online-Gruppenkommunikation
- 2.1 Formen der Online-Kommunikation
- 2.2 Exkurs: Diskussionsforen - Die Schwarzen Bretter des WWW
- 2.3 Konzepte virtueller Gruppen und Gemeinschaften
- 2.4 Spezielle Eigenschaften des Mediums Internet und ihre Auswirkungen auf Kommunikationsprozesse
- 2.4.1 Anonymität
- 2.4.2 Reduzierung von Sinneseindrücken und Statusmerkmalen
- 2.4.3 Enthemmung
- 3. Feindseligkeit in der computervermittelten Kommunikation
- 3.1 Was ist Feindseligkeit im Netz?
- 3.2 Unterschiedliche Erscheinungsformen von Feindseligkeit im Internet
- 3.2.1 Flaming
- 3.2.2 Hacking
- 3.2.3 Spamming
- 3.2.4 Virtuelle Gewalt
- 3.3 Gegenstrategien des World Wide Web
- 3.3.1 Moderatoren und andere Ämter im Netz
- 3.3.2 Die Netiquette - Verhaltenskodex mit Empfehlungscharakter
- 3.3.3 Sanktionsmöglichkeiten
- 3.4 Exkurs: Warum es Sinn macht, Feindseligkeit im Web zu untersuchen
- 3.4.1 Service und Beratung - Gesundheitsplattformen
- 3.4.2 Wirtschaft und Handel – Kommerzielle Plattformen
- 3.4.3 Politik und Partizipation – Virtuelle Gemeinschaften als Partizipationsmöglichkeit
- 4. Forschungsstand zum Thema Feindseligkeit online
- 4.1 Genereller Überblick
- 4.2 Preece und Ghozati: "Observations and Explorations of Empathy online"
- 4.2.1 Begriffliche Definitionen bei Preece
- 4.2.2 Zusammenfassung der Studie
- 5. Eigene Forschungsfragen und ihre theoretischen Grundlagen
- 5.1 Einbettung in Offline-Strukturen
- 5.2 Ausdruck virtueller Identität
- 5.3 Vielschichtige Hierarchiestrukturen
- 5.4 Verweis auf eine Netiquette
- 6. Empirische Untersuchung
- 6.1 Anspruch und Ziel dieser Untersuchung
- 6.2 Methodisches Vorgehen
- 6.3 Die Anbieter der untersuchten Diskussionsforen
- 6.4 Grundgesamtheit und Stichprobenziehung
- 6.5 Kategorisierung der Beiträge
- 6.6 Durchführung der Erhebung und Auswertung
- 6.6.1 Einbettung
- 6.6.2 Mehrschichtige Moderation
- 6.6.3 Netiquette
- 6.6.4 Ausdruck virtueller Persönlichkeit
- 6.6.5 Gesamt
- 6.7 Probleme im Verlauf der empirischen Untersuchung
- 7. Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht soziologisch die Feindseligkeit in der Online-Gruppenkommunikation. Ziel ist es, die Erscheinungsformen, Ursachen und Gegenstrategien von Online-Feindseligkeit zu analysieren und den Forschungsstand zum Thema zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung von Diskussionsforen.
- Definition und Erscheinungsformen von Feindseligkeit im Internet
- Einfluss von Anonymität, Enthemmung und reduzierten Sinneseindrücken auf die Kommunikation
- Analyse von Gegenstrategien wie Moderation und Netiquette
- Empirische Untersuchung der Feindseligkeit in ausgewählten Online-Foren
- Einbettung der Online-Kommunikation in Offline-Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Online-Feindseligkeit ein und formuliert die Forschungsfrage der Arbeit. Es beschreibt den Aufbau und die Struktur der gesamten Masterarbeit und gibt einen Überblick über die folgenden Kapitel.
1. Einführung in das Thema Feindseligkeit: Dieses Kapitel liefert eine fundierte Definition von Feindseligkeit und betrachtet sie im Kontext soziologischer Emotionstheorien. Es legt die Grundlage für das Verständnis von Feindseligkeit als soziales Phänomen und bereitet den Boden für die Analyse von Feindseligkeit in der Online-Kommunikation. Es differenziert Feindseligkeit von verwandten Konzepten, wie z.B. Ärger und Aggression.
2. Theorie der Online-Gruppenkommunikation: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Formen der Online-Kommunikation und spezifische Eigenschaften des Mediums Internet (wie Anonymität und Enthemmung), die einen Einfluss auf Kommunikationsprozesse haben. Der Fokus liegt auf der Beschreibung virtueller Gruppen und Gemeinschaften und wie diese die Entstehung und Ausprägung von Feindseligkeit beeinflussen können. Der Exkurs zu Diskussionsforen als "Schwarzen Bretter des WWW" liefert einen wichtigen Kontext für die spätere empirische Untersuchung.
3. Feindseligkeit in der computervermittelten Kommunikation: Dieses Kapitel definiert Feindseligkeit im Kontext des Internets und beschreibt verschiedene Erscheinungsformen wie Flaming, Hacking, Spamming und virtuelle Gewalt. Es analysiert Gegenstrategien wie Moderation, Netiquette und Sanktionsmöglichkeiten, die zur Reduktion von Feindseligkeit im Netz eingesetzt werden können. Der Exkurs zu den Anwendungsbereichen im Web (Gesundheit, Wirtschaft, Politik) unterstreicht die Relevanz des Themas.
4. Forschungsstand zum Thema Feindseligkeit online: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zum Thema Online-Feindseligkeit. Es präsentiert und analysiert ausgewählte Studien, beispielsweise die Arbeit von Preece und Ghozati, um den Kontext der eigenen Forschung zu verdeutlichen und die Forschungslücke zu definieren. Hier werden wichtige theoretische Grundlagen und bereits existierende Konzepte kritisch beleuchtet.
5. Eigene Forschungsfragen und ihre theoretischen Grundlagen: Dieses Kapitel formuliert die konkreten Forschungsfragen der Arbeit und erläutert die theoretischen Grundlagen, auf denen die empirische Untersuchung aufbaut. Es definiert die zentralen Konzepte wie die Einbettung in Offline-Strukturen, den Ausdruck virtueller Identität und die Bedeutung von Hierarchien und Netiquette im Kontext der Online-Feindseligkeit.
6. Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erklärt die Auswahl der Diskussionsforen, die Stichprobenziehung, die Kategorisierung der Beiträge und die Auswertungsmethode. Es legt detailliert dar, wie die Daten erhoben und analysiert wurden, inklusive der Herausforderungen und Probleme, die während des Forschungsprozesses auftraten. Die einzelnen Aspekte der Untersuchung (Einbettung, Moderation, Netiquette, Ausdruck virtueller Persönlichkeit) werden in ihren methodischen Aspekten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Feindseligkeit, Online-Kommunikation, Online-Gruppenkommunikation, Computervermittelte Kommunikation, Internet, Anonymität, Enthemmung, Netiquette, Moderation, Virtuelle Gemeinschaften, Empirische Untersuchung, Diskussionsforen, Flaming, Hacking, Spamming, Virtuelle Gewalt.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Feindseligkeit in der Online-Gruppenkommunikation
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht soziologisch die Feindseligkeit in der Online-Gruppenkommunikation. Sie analysiert Erscheinungsformen, Ursachen und Gegenstrategien von Online-Feindseligkeit und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung von Diskussionsforen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie sich Feindseligkeit in Online-Gruppen manifestiert, wie Anonymität, Enthemmung und reduzierte Sinneseindrücke die Kommunikation beeinflussen, welche Gegenstrategien (Moderation, Netiquette) eingesetzt werden und wie die Online-Kommunikation in Offline-Strukturen eingebettet ist. Konkrete Forschungsfragen werden im Kapitel 5 detailliert dargelegt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Es wurden ausgewählte Diskussionsforen untersucht, die Beiträge kategorisiert und ausgewertet. Die Methodik, inklusive Stichprobenziehung und Datenanalyse, wird im Kapitel 6 ausführlich beschrieben. Die Auswertung betrachtet Aspekte wie Einbettung in Offline-Strukturen, Mehrschichtige Moderation, Netiquette und den Ausdruck virtueller Persönlichkeit.
Welche Erscheinungsformen von Online-Feindseligkeit werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Erscheinungsformen von Online-Feindseligkeit, darunter Flaming, Hacking, Spamming und virtuelle Gewalt (Kapitel 3). Diese werden im Kontext der spezifischen Eigenschaften der Online-Kommunikation analysiert.
Welche Rolle spielen Anonymität und Enthemmung?
Anonymität und Enthemmung werden als wesentliche Faktoren betrachtet, die die Entstehung und Ausprägung von Feindseligkeit in der Online-Kommunikation beeinflussen (Kapitel 2 und 3). Die Arbeit untersucht, wie diese Faktoren die Kommunikationsprozesse verändern.
Welche Gegenstrategien gegen Online-Feindseligkeit werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gegenstrategien, darunter Moderation, Netiquette und Sanktionsmöglichkeiten (Kapitel 3). Der Einfluss dieser Strategien auf die Reduktion von Feindseligkeit wird untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Einführung in das Thema Feindseligkeit, Theorie der Online-Gruppenkommunikation, Feindseligkeit in der computervermittelten Kommunikation, Forschungsstand, eigene Forschungsfragen und empirische Untersuchung, sowie Ergebnisse und Ausblick. Ein detaillierter Überblick findet sich im Inhaltsverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Feindseligkeit, Online-Kommunikation, Online-Gruppenkommunikation, Computervermittelte Kommunikation, Internet, Anonymität, Enthemmung, Netiquette, Moderation, Virtuelle Gemeinschaften, Empirische Untersuchung, Diskussionsforen, Flaming, Hacking, Spamming und Virtuelle Gewalt.
Welche Studien wurden berücksichtigt?
Kapitel 4 bietet einen Überblick über den Forschungsstand. Die Arbeit von Preece und Ghozati ("Observations and Explorations of Empathy online") wird als Beispiel für relevante Studien genannt und analysiert.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen befinden sich im HTML-Dokument. Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse der Thematik und bietet einen detaillierten Einblick in die Forschungsmethodik und Ergebnisse.
- Citation du texte
- Christina Liebeck (Auteur), 2004, Nett im Net? - Eine soziologische Analyse von Feindseligkeit in der Online-Gruppenkommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93367