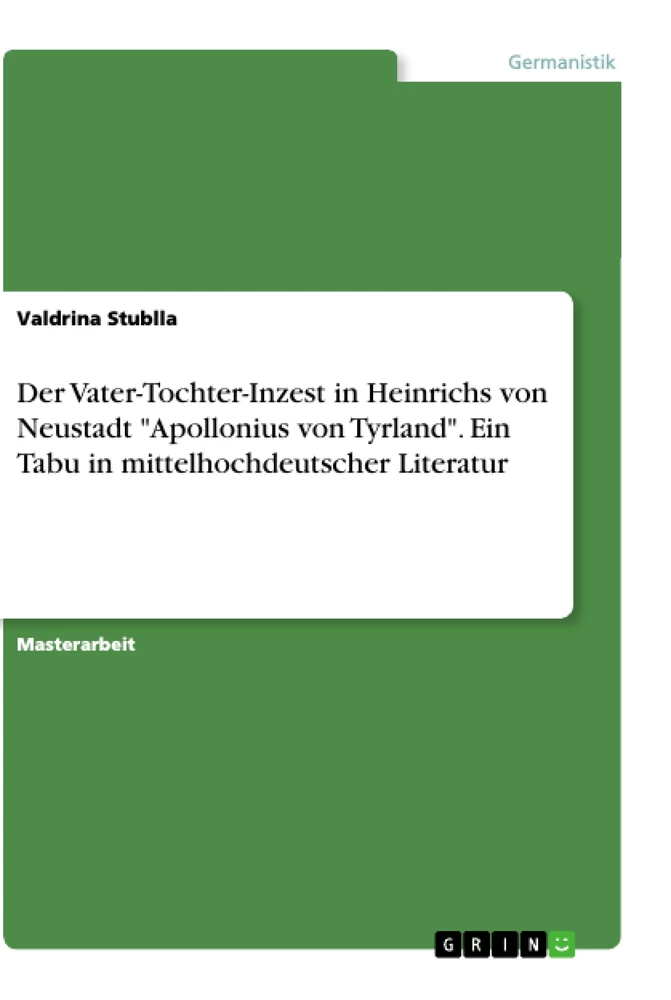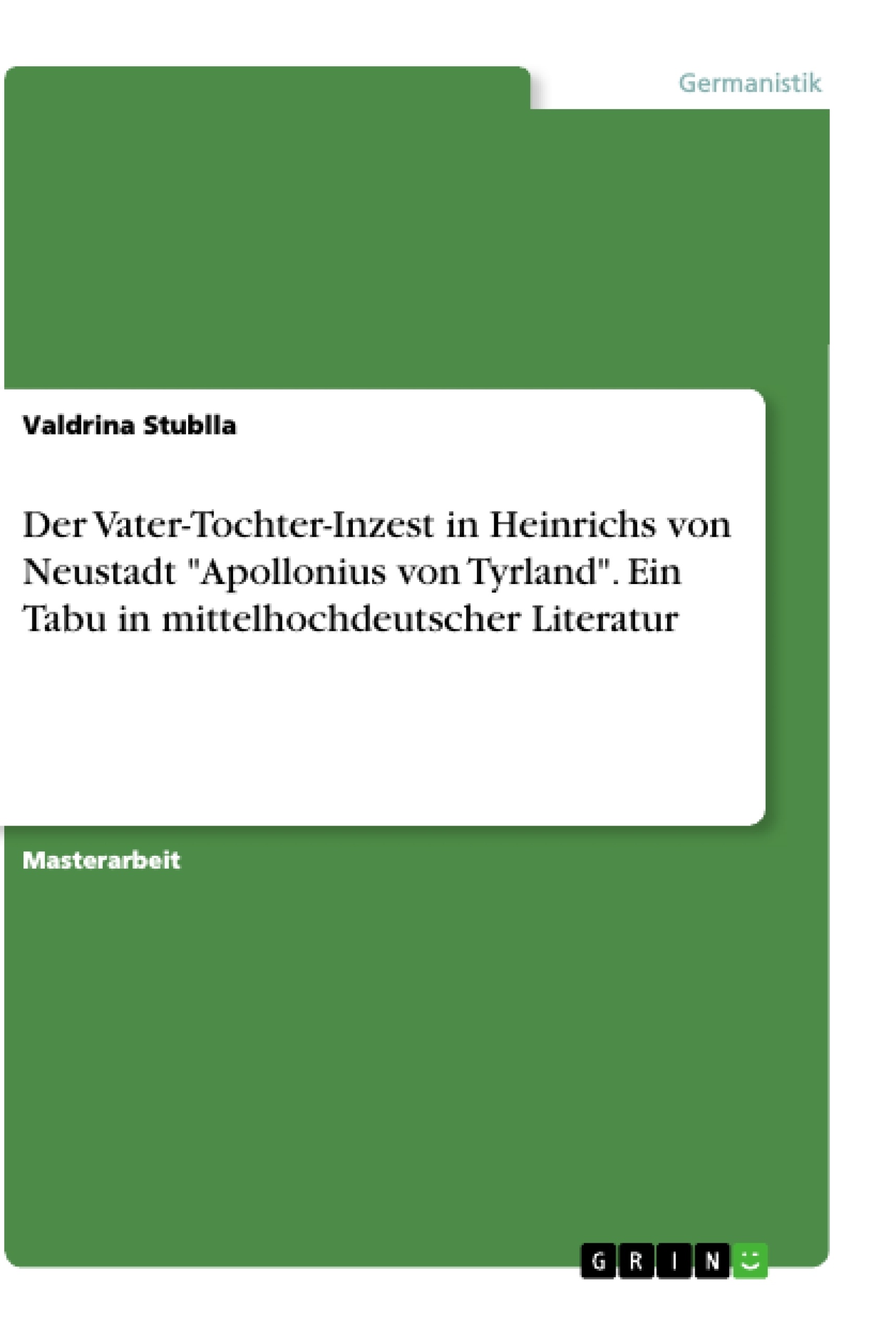Familie, Verwandtschaft, Genealogie – wichtige Themen, die in der mittelalterlichen Kultur und Literatur eine zentrale Rolle spielen. Allerdings dominieren häufig die Konflikte: Väter fehlen, Mütter sterben, Geschwister kommen sich zu nahe und Töchter
werden missbraucht. Die Missbrauchsthematik ist in mittelalterlicher Literatur häufig mit dem Inzest verbunden. Er gehört zu den dunklen Seiten der Mediävistik und regt dazu an, sich mit "etwas Abseitigem, ja vielleicht sogar Abgründigem, […] Rätselhaften, etwas bislang unentdeckt oder unbeachtet Gebliebenem auf dem Gebiet der Mediävistik, der Mittelalter-Forschung und angrenzenden Feldern" zu beschäftigen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit einer theoretischen Aufarbeitung dieser Thematik, um so eine Grundlage zu schaffen, um sich im zweiten Schritt mit einer genauen Untersuchung der Inzestepisode in Heinrich von Neustadts " Apollonius von Tyrland "zu beschäftigen.
Die heute "vielfach soziobiologisch begründete Ablehnung des Inzests war im Bewusstsein der Menschen des 15. Jahrhunderts tief verankert. Alte Erzählungen warnten zwar stets vor inzestuösem Verhalten, dennoch waren Inzestgeschichten Forschungsgegenstand der Gebildeten zu jener Zeit. Der Humanist und Bamberger Domherr ALBRECHT VON EYB erzählt am Ende seines 1472 geschriebenen Traktats eine abschreckende Geschichte, welche vom Vater-Tochter-Inzest handelt. Dabei zeugt ein mächtiger Kaiser mit seiner Tochter einen Sohn, namens Albanus, der wiederum Jahre später seine eigene Mutter zur Frau nimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Methodische Überlegungen
- Inzest
- Geschichtlicher Überblick über den Inzest
- Historische Inzestverbote
- Der Inzest als Forschungsproblem
- Inzest und Ehebruch
- Inzest und Tabu
- Tabu-Begriff
- Der ethnologische Tabu-Begriff
- Tabu-Verständnis im 20. Jahrhundert
- Inzesttabu und Emotionen
- Vater-Tochter-Inzest als Tabu
- Vater-Tochter-Inzest und Emotion
- Der Inzest im Kontext von Ehe und Verwandtschaft des frühen Mittelalters
- Begründung des Inzestvergehens im frühen Mittelalter
- Töchter als Bräute
- Töchter ohne Mutter
- Ent-schuldigte Väter, verurteilte Mütter
- Der tabuisierte Personenkreis
- Illegitime Beziehungen
- Der Geschwisterinzest
- Der Mutter-Sohn-Inzest
- Der Vater-Tochter-Inzest
- Begründung des Inzestvergehens im frühen Mittelalter
- Heinrich von Neustadt: Apollonius von Tyrland
- Vorlage: Historia Apollonii regis Tyri
- Heinrichs von Neustadt Apollonius von Tyrland
- Prolog und Exposition
- Verstorbene Mütter, teuflische Liebe und Frau Minne
- Der Inzest als Sieg und Niederlage
- Das Rätsel
- Das Vergessen von Differenzen
- Apollonius Bearbeitungen
- Leipziger Apollonius
- Heinrich Steinhöwels Apollonius
- Zwischenfazit: Apollonius-Fassungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Vater-Tochter-Inzest im Kontext von Heinrichs von Neustadts Apollonius von Tyrland. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung und Funktion des Inzestmotivs in dieser mittelalterlichen Erzählung zu beleuchten. Dazu werden sowohl der geschichtliche Hintergrund des Inzests als auch dessen literarische Rezeption im Mittelalter analysiert.
- Die Rolle des Inzesttabus in der mittelalterlichen Kultur und Literatur
- Der Vater-Tochter-Inzest als literarisches Motiv in Heinrichs von Neustadts Apollonius von Tyrland
- Die Bedeutung des Inzestmotivs für die Charakterentwicklung und die Handlung der Geschichte
- Die Rezeption des Apollonius von Tyrland im Mittelalter
- Die Bedeutung des Werkes für das Verständnis der mittelalterlichen Gesellschaft und Mentalität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den Forschungsstand zum Thema Inzest in der mittelalterlichen Literatur dar. Außerdem werden die methodischen Überlegungen für die Analyse des Inzestmotivs im Apollonius von Tyrland dargelegt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Inzest als historischem Phänomen und beleuchtet dessen Bedeutung in verschiedenen historischen Kontexten. Dabei wird auch auf die Entwicklung des Inzestverbotes im Laufe der Zeit eingegangen.
Das dritte Kapitel analysiert den Begriff des Tabus im Allgemeinen und das Inzesttabu im Speziellen. Dabei werden die verschiedenen Theorien zum Tabuverständnis diskutiert.
Das vierte Kapitel untersucht den Inzest im Kontext von Ehe und Verwandtschaft im frühen Mittelalter. Dabei werden die verschiedenen Formen des Inzests sowie deren rechtliche und soziale Folgen analysiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Analyse von Heinrichs von Neustadts Apollonius von Tyrland. Dabei werden die Vorlage, der Handlungsverlauf und die Rolle des Inzestmotivs in der Geschichte untersucht.
Schlüsselwörter
Inzest, Tabu, Vater-Tochter-Inzest, mittelalterliche Literatur, Heinrich von Neustadt, Apollonius von Tyrland, Historia Apollonii regis Tyri, Familie, Verwandtschaft, Genealogie, Kultur, Geschichte.
- Arbeit zitieren
- Valdrina Stublla (Autor:in), 2020, Der Vater-Tochter-Inzest in Heinrichs von Neustadt "Apollonius von Tyrland". Ein Tabu in mittelhochdeutscher Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934132