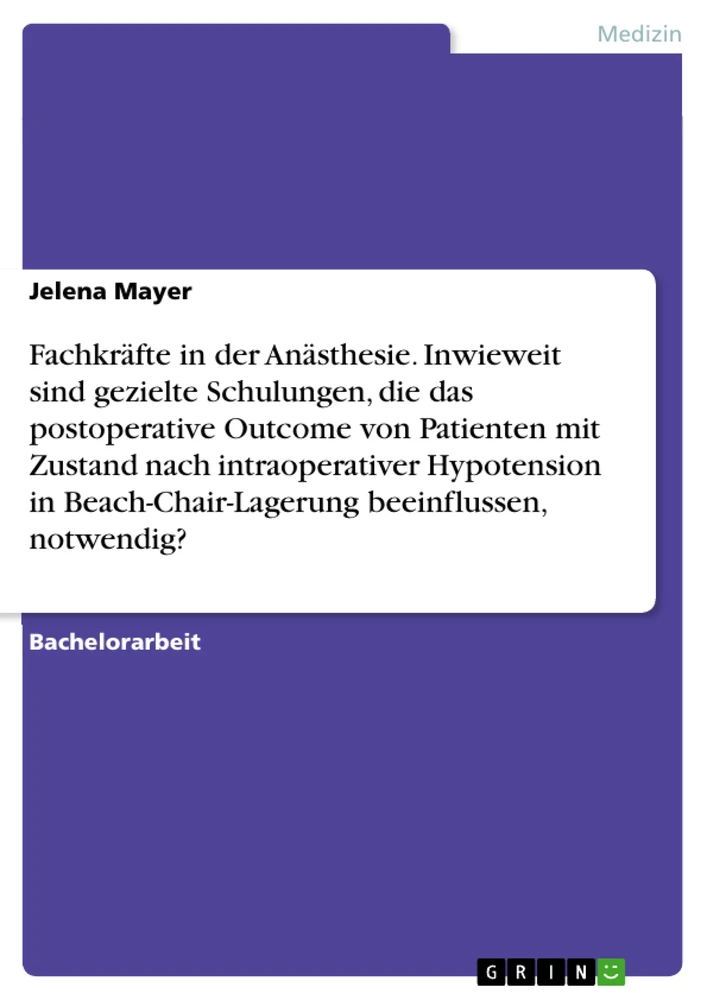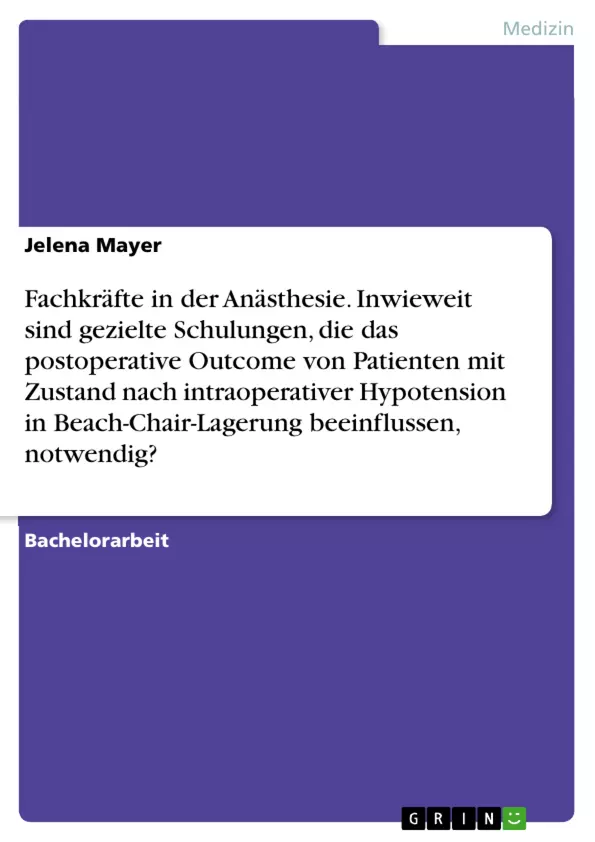Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob die Mitarbeiter der Anästhesie Risiken, Therapiemöglichkeiten und Folgen der intraoperativen Hypotension in Beach-Chair-Lagerung kennen oder ob es gravierende Wissenslücken gibt, welche Auswirkungen auf das Patientenoutcome haben könnten. Dazu wurde folgende Forschungsfrage gestellt: Inwieweit sind gezielte Schulungen, der in der Anästhesie tätigen Fachkräfte, die das postoperative Outcome von Patienten mit Zustand nach intraoperativer Hypotension in Beach-Chair-Lagerung, beeinflussen, notwendig?
Dies ist der Grund, weshalb diese Arbeit auf den Fachkenntnisstand des anästhesiologischen Teams fokussiert ist und anhand eines Fragebogens der Schulungsbedarf ermittelt sowie Chancen und Risiken aufgedeckt als auch erläutert werden. Zu Beginn der Bachelorarbeit wird die Beach-Chair-Lagerung beschrieben, die den Vorgang der Lagerung und die präventiven Maßnahmen von Lagerungsschäden betreffen. Relevante physiologische Grundlagen werden aufgeführt, welche generell die Hämodynamik in den Blutgefäßen von der Abhängigkeit der verantwortlichen Kräfte beschreibt. Zudem wird auf die Definition der Hypotonie, der Hypotension und deren Bedeutung bezüglich des arteriellen Drucks näher eingegangen. Messtechniken des Blutdrucks und der Sauerstoffmessung sowie mögliche Unterschreitungen der Blutdruckgrenzen als auch dessen Folgen für Gehirn, Nieren und Herz werden beschrieben. Darauffolgend wird auf nicht-pharmakologische und pharmakologische Vorgehensweisen der Therapieformen und Besonderheiten bei der Wahl der Narkoseform bei Patienten in Beach-Chair-Lagerung eingegangen. Abschließend wird die Effizienz und Notwendigkeit der Mitarbeiterschulung für Personal und Unternehmen dargestellt.
Im Methodenteil wird die Relevanz der empirischen Untersuchung der Forschungsmethode Fragebogen vorgestellt. Zusätzlich wird auf die Zielgruppe Mitarbeiter der Anästhesie eingegangen. Ein weiterer Aspekt bietet zudem die Erstellung und der Aufbau des Fragebogens sowie eine Aufzählung der inhaltlichen Schwerpunkte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Die Beach-Chair-Lagerung
- 1.2 Lagerungsbedingte Schäden und präventive Maßnahmen
- 1.3 Die Physiologie der Hämodynamik
- 1.4 Die intraoperative Hypotension und die Bedeutung des arteriellen Drucks für die Organperfusion
- 1.5 Die Therapie der Hypotension
- 1.6 Effizienz und Notwendigkeit der Mitarbeiterschulung
- 2 Ziel der Arbeit
- 3 Methoden
- 3.1 Erhebungsmethode: Quantitative Forschung
- 3.2 Zielgruppe
- 3.3 Aufbau und Erstellung des Fragebogens
- 3.4 Inhaltliche Schwerpunkte des Fragebogens
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Allgemeine Daten zu Charakteristika der Studienteilnehmer
- 4.2 Abfrage spezieller Meinungen und Einstellungen
- 4.3 (De)motivation und Überforderung in der Anästhesie
- 4.4 Wissenserwerb in der Anästhesie
- 4.5 Symptome einer Hypotension
- 4.6 Begünstigende Risikofaktoren einer Hypotension
- 4.7 Kenntnisse über die prophylaktischen Maßnahmen einer Hypotension
- 4.8 Kenntnisse über die Folgen einer Hypotension
- 4.9 Fortbildungen in der Anästhesie
- 5 Diskussion
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Interpretation der Ergebnisse
- 5.3 Limitierung der Untersuchung
- 5.4 Implikation für weitere Forschung
- 5.5 Handlungsempfehlungen an anästhesiologische Abteilungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit gezielter Schulungen für Anästhesiepersonal im Umgang mit postoperativen Outcomes von Patienten nach intraoperativer Hypotension in Beach-Chair-Lagerung. Ziel ist es, den Wissensstand des Personals zu erfassen und den Zusammenhang zwischen Schulungsdefiziten und patientenbezogenen Ergebnissen aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf einer quantitativen Erhebung mittels Fragebogen.
- Wissensstand des Anästhesiepersonals bezüglich Hypotension in Beach-Chair-Lagerung
- Zusammenhang zwischen Schulungsdefiziten und postoperativen Outcomes
- Identifizierung von Risikofaktoren und präventiven Maßnahmen
- Bewertung der Effektivität von Fortbildungsmaßnahmen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für anästhesiologische Abteilungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der intraoperativen Hypotension in Beach-Chair-Lagerung ein. Sie beschreibt die Beach-Chair-Lagerung selbst, mögliche lagerungsbedingte Schäden und präventive Maßnahmen. Die physiologischen Grundlagen der Hämodynamik werden erläutert, ebenso wie die Bedeutung des arteriellen Drucks für die Organperfusion. Die Therapie der Hypotension und die Notwendigkeit von Mitarbeiterschulungen werden diskutiert, um den Kontext der Forschungsfrage zu etablieren und die Relevanz der Arbeit zu unterstreichen. Die Einleitung dient als umfassende Grundlage für die spätere Darstellung der Forschungsmethodik und der Ergebnisse.
3 Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird detailliert auf die quantitative Forschungsmethode, die Auswahl der Zielgruppe (Anästhesiepersonal), den Aufbau und die Erstellung des Fragebogens sowie die inhaltlichen Schwerpunkte eingegangen. Die Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und die wissenschaftliche Validität der Studie gewährleisten, indem sie Transparenz über den Forschungsprozess schafft und potenzielle Limitationen im Vorfeld anspricht.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Fragebogenstudie. Es werden sowohl allgemeine Daten zu den Studienteilnehmern als auch spezifische Meinungen und Einstellungen zu Hypotensionen in Beach-Chair-Lagerung dargestellt. Die Ergebnisse umfassen Aspekte wie (De)motivation und Überforderung im Arbeitsalltag, Wissenserwerb, Symptomeerkennung, Kenntnis von Risikofaktoren und präventiven Maßnahmen, sowie die Auswirkungen und die Fortbildungskultur im Bereich der Anästhesie. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse bildet die Grundlage für die spätere Diskussion und Interpretation.
5 Diskussion: Die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen, interpretiert diese im Kontext des Forschungsstandes und beleuchtet Limitationen der Studie. Sie leitet daraus Implikationen für die zukünftige Forschung ab und formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für anästhesiologische Abteilungen. Dieses Kapitel bewertet die Ergebnisse kritisch und stellt sie in einen breiteren wissenschaftlichen Kontext, um die Bedeutung der Studie und ihre praktischen Implikationen hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Intraoperative Hypotension, Beach-Chair-Lagerung, Anästhesie, postoperative Outcomes, Mitarbeiterschulung, quantitative Forschung, Risikofaktoren, präventive Maßnahmen, Fortbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Intraoperative Hypotension in Beach-Chair-Lagerung
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit gezielter Schulungen für Anästhesiepersonal im Umgang mit postoperativen Outcomes von Patienten nach intraoperativer Hypotension in Beach-Chair-Lagerung. Ziel ist die Erfassung des Wissensstands des Personals und die Aufdeckung des Zusammenhangs zwischen Schulungsdefiziten und patientenbezogenen Ergebnissen mittels quantitativer Forschung (Fragebogenstudie).
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wissensstand des Anästhesiepersonals bezüglich Hypotension in Beach-Chair-Lagerung, den Zusammenhang zwischen Schulungsdefiziten und postoperativen Outcomes, Risikofaktoren und präventive Maßnahmen, die Effektivität von Fortbildungsmaßnahmen und leitet daraus Handlungsempfehlungen für anästhesiologische Abteilungen ab.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine quantitative Forschungsmethode mit einem eigens entwickelten Fragebogen eingesetzt. Die Zielgruppe umfasste Anästhesiepersonal. Der Fragebogen erfasste allgemeine Daten der Teilnehmer, Meinungen und Einstellungen zu Hypotension, (De)motivation, Wissenserwerb, Symptomerkennung, Kenntnis von Risikofaktoren und präventiven Maßnahmen sowie Fortbildungen im Bereich Anästhesie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Beschreibung der Beach-Chair-Lagerung, Hämodynamik, Hypotension und Mitarbeiterschulung), Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Methoden (detaillierte Beschreibung der quantitativen Erhebung), Ergebnisse (Darstellung der Fragebogenergebnisse) und Diskussion (Zusammenfassung, Interpretation der Ergebnisse, Limitationen, Implikationen für weitere Forschung und Handlungsempfehlungen).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Ergebnisse der Fragebogenstudie zeigen den Wissensstand des Anästhesiepersonals zu Hypotension in Beach-Chair-Lagerung, den Zusammenhang zwischen Wissenslücken und postoperativen Outcomes auf und identifizieren Risikofaktoren und präventive Maßnahmen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Diskussion leitet aus den Ergebnissen konkrete Handlungsempfehlungen für anästhesiologische Abteilungen ab, um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und Komplikationen durch intraoperative Hypotension zu reduzieren. Diese Empfehlungen basieren auf der Interpretation der Ergebnisse und der kritischen Auseinandersetzung mit den Limitationen der Studie.
Welche Limitationen der Studie werden genannt?
Die Diskussion beleuchtet die Limitationen der Studie, um die Ergebnisse kritisch einzuordnen und die Validität der Schlussfolgerungen zu bewerten. Diese Limitationen könnten die Stichprobengröße, die spezifische Zusammensetzung der Befragten oder die Methode der Datenerhebung betreffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Intraoperative Hypotension, Beach-Chair-Lagerung, Anästhesie, postoperative Outcomes, Mitarbeiterschulung, quantitative Forschung, Risikofaktoren, präventive Maßnahmen, Fortbildung.
- Quote paper
- Jelena Mayer (Author), 2020, Fachkräfte in der Anästhesie. Inwieweit sind gezielte Schulungen, die das postoperative Outcome von Patienten mit Zustand nach intraoperativer Hypotension in Beach-Chair-Lagerung beeinflussen, notwendig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934345