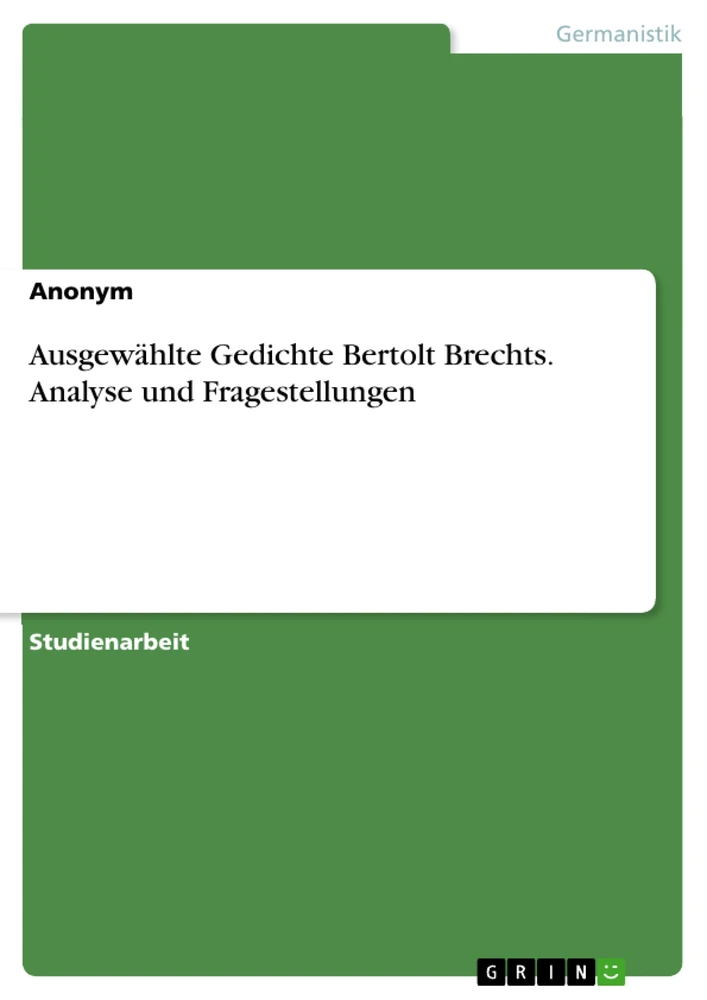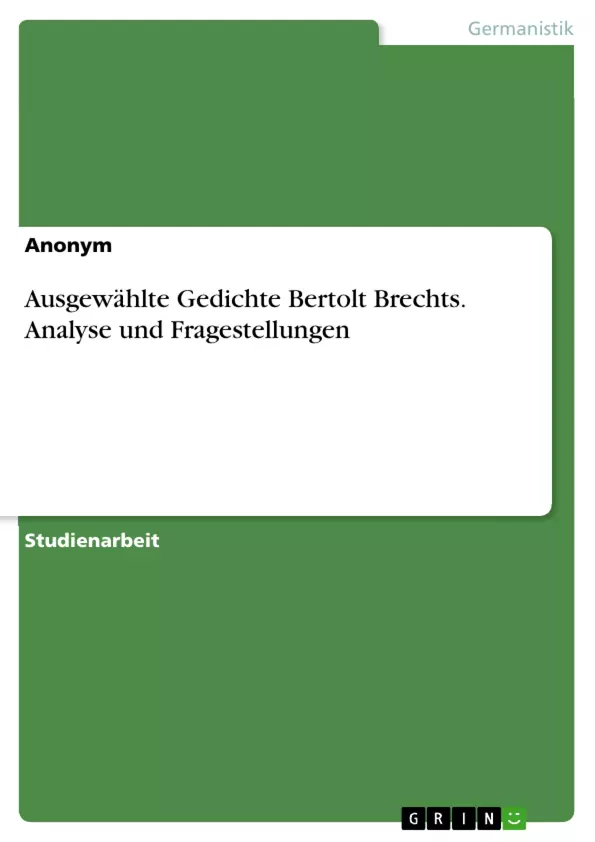Im Rahmen dieser Hausarbeit werden fünf verschiedene Gedicht Bertolt Brechts mit Hinblick auf jeweils unterschiedliche Fragestellungen untersucht.
Im ersten Gedicht "Die Legende vom toten Soldaten" geht die Autorin der Frage nach, inwieweit das Gedicht vor dem Hintergrund von Brecht´s Pazifismus als Satire gelesen werden kann. Im zweiten Gedicht "Erinnerung an Marie" fragt die Autorin, ob das Gedicht als Liebesgedicht oder als Parodie von Liebeslyrik gelesen werden kann. Das dritte Gedicht "Aus dem Lesebuch für Städtebewohner" wird als Beispiels für Brechts "Großstadtlyrik" gelesen. Das vierte Gedicht "Terzinen über die Liebe" wird vor dem Hintergrund der Intertextualität besonders mit Werken Dantes verglichen. Das letzte Gedicht schließlich" Verschollener Ruhm der Riesenstadt New York", wird auf seine Kapitalismuskritik hin untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Gedicht 1: Die Legende vom Toten Soldaten
- Brechts Weg zum Pazifismus: Die Legende vom toten Soldaten als Satire
- Gedicht 2: Erinnerung an Marie A...
- Brechts Erinnerung an die Marie A. - Liebesgedicht oder Parodie von Liebeslyrik?
- Gedicht 3: Aus dem Lesebuch für Städtebewohner.
- Brechts Großstadtlyrik: Aus dem Lesebuch für Städtebewohner..
- Gedicht 4: Terzinen über die Liebe.....
- Brechts Terzinen über die Liebe- Einheit, Auflösung und Trennung – Dreiteilung des Gedichtes auf mehreren Ebenen.......
- Brechts Terzinen über die Liebe und Dantes Hölle - Intertextualität .........
- Gedicht 5: Verschollener Ruhm der Riesenstadt New York
- Kapitalismus-Kritik in Verschollener Ruhm der Riesenstadt New York - Brechts politische Lyrik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die satirischen Elemente in Bertolt Brechts Gedicht „Die Legende vom Toten Soldaten“ und analysiert dessen Bedeutung im Kontext von Brechts Pazifismus und seiner Kritik am Militarismus und Krieg. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Verwendung satirischer Stilmittel in dem Gedicht und deren Wirkung auf den Leser.
- Brechts Pazifismus und Kritik am Krieg
- Satire in Brechts Gedichten
- Die Verwendung von satirischen Stilmitteln
- Die Interpretation und Wirkung des Gedichts
- Brechts literarische Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel 1 analysiert Brechts Gedicht „Die Legende vom Toten Soldaten“ als Satire auf den Krieg und den Militarismus. Es untersucht die Verwendung von satirischen Stilmitteln wie Übertreibung, Ironie und Parodie und erläutert, wie diese Mittel eingesetzt werden, um die Absurdität des Krieges und die Instrumentalisierung von Menschenleben zu kritisieren.
Schlüsselwörter
Satire, Pazifismus, Krieg, Militarismus, Bertold Brecht, „Die Legende vom Toten Soldaten“, Ironie, Parodie, Übertreibung, Intertextualität, Großstadtlyrik, Liebeslyrik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Ausgewählte Gedichte Bertolt Brechts. Analyse und Fragestellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934497