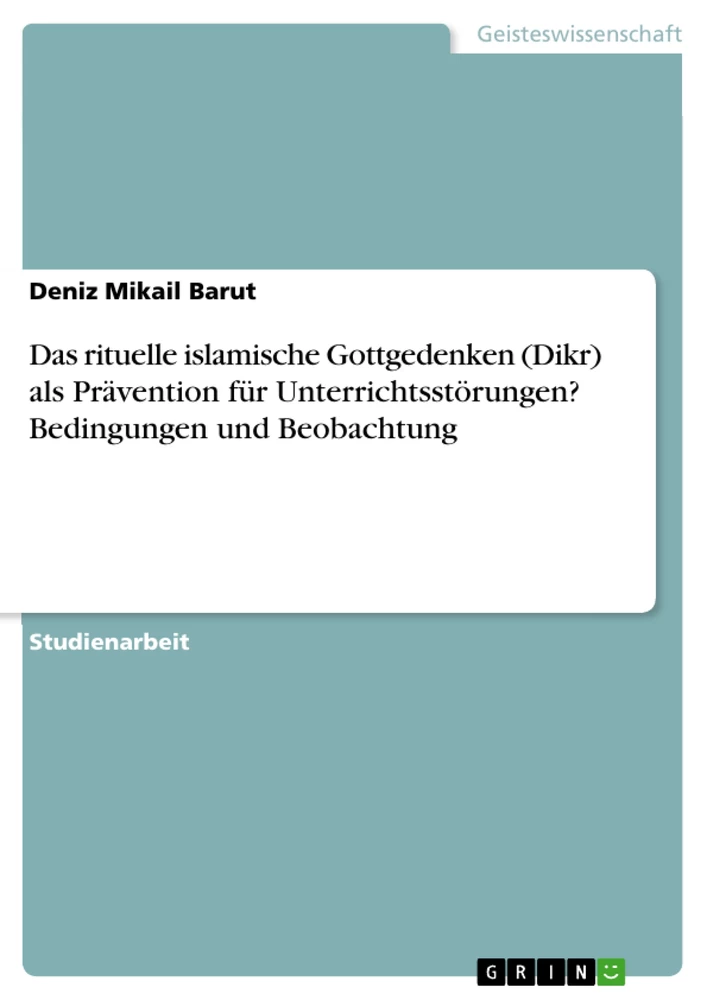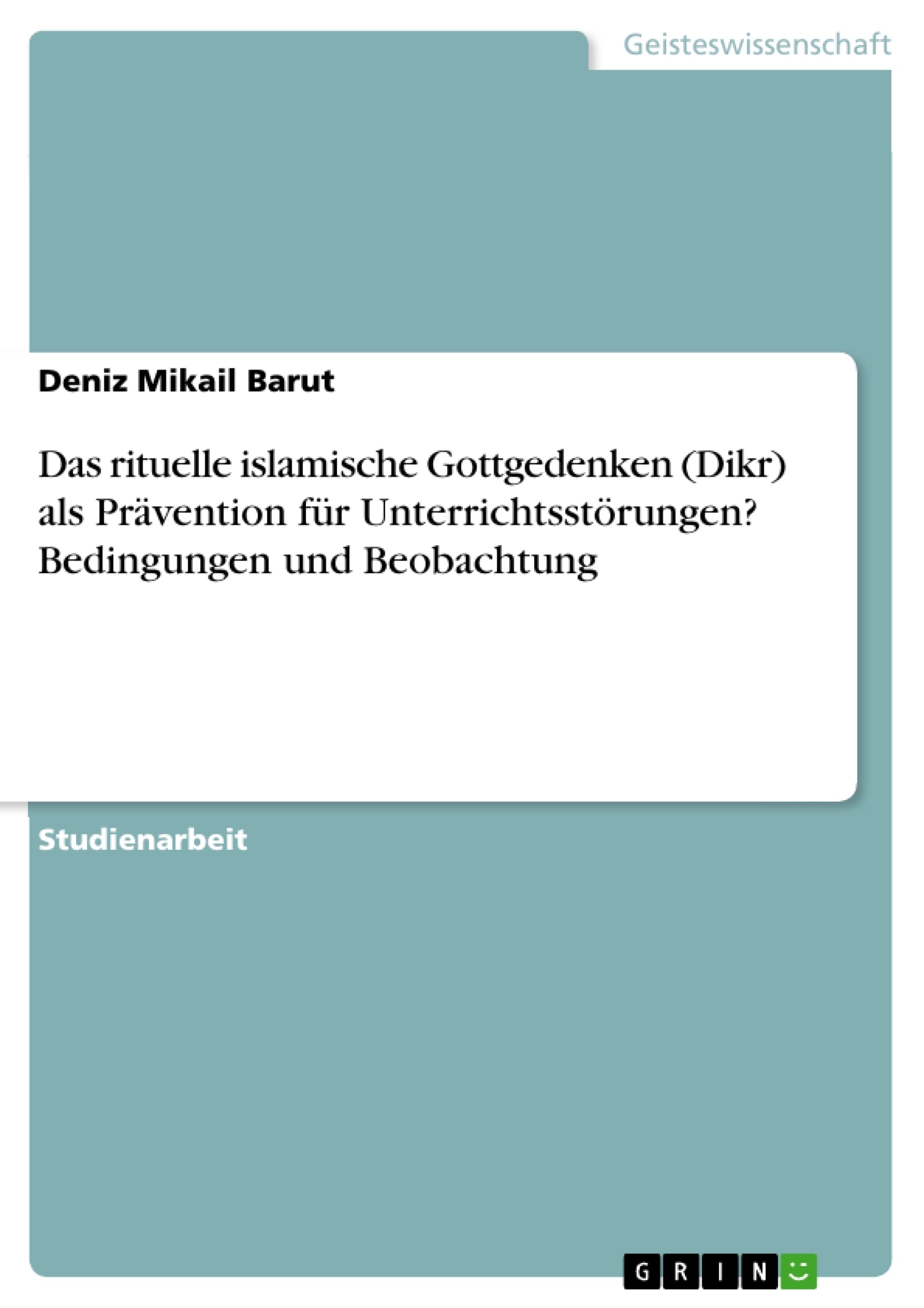Diese Arbeit geht der Frage nach, ob das rituelle islamische Gottgedenken (Dikr) am Beginn einer Schulstunde eine geeignete Prävention gegen Unterrichtsstörungen darstellt.
Es ist allgemein bekannt, dass Rituale im Schulunterricht, im Alltag, auf der Arbeit et cetera für Struktur, Ordnung und einen Rhythmus sorgen. Besonders Kinder und Jugendliche sind im schulischen Kontext auf klare Grenzen, Ordnung und einen strukturierten Unterricht angewiesen. Jeder Lehrende wird täglich mit Herausforderungen im Berufsleben konfrontiert. Häufig stehen Lehrer vor der Frage, wie sie mit Unterrichtsstörungen am besten umgehen sollten. Auch in den Bildungswissenschaften und der Pädagogik ist das Thema Unterrichtsstörungen von großer Bedeutung. Es gibt in der Wissenschaft viele Ansätze, die vorgeben, wie man mit Schülerinnen und Schülern am besten umgehen sollte, um Unterrichtsstörungen auf ein Geringes zu dezimieren. Nicht immer finden die Ansätze aus der Theorie in der Praxis den gewünschten Anklang.
In der islamischen Religionslehre ist es sehr wichtig, den SuS ein einleitendes Verständnis der Religion zu vermitteln und sie dahingehend in ihrer Religion zu bilden, dass sie autonome Individuen werden, die Verantwortung für ihren Glauben übernehmen können. Um diesem Ziel gerecht zu werden, ist es unabdingbar, den Unterricht so zu gestalten, dass Respekt und Erkenntnisinteresse von allen Beteiligten als wichtige Güter anerkannt werden. Deshalb habe ich die Absicht gefasst, zu erforschen, inwieweit mithilfe von religiösen Praktiken der Respekt, das Erkenntnisinteresse und weitere Tugenden ihren Platz im islamischen Religionsunterricht finden. Der Autor ist sich sicher, dass die Erforschung der Frage einen nachhaltigen Mehrwert für ihn in seinem Professionalisierungsprozess haben wird, da er, genau wie alle anderen Lehrenden auch, mit Herausforderungen konfrontiert wird und einen Weg finden muss, diesen Herausforderungen erfolgreich entgegenzustehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bedingungsanalyse
- 2.1 Institutionelle Bedingungen
- 2.2 Anthropologische Bedingungen
- 3. Der Begriff „Unterrichtsstörung“
- 4. Das theoretische Vorhaben
- 5. Das praktische Vorhaben
- 6. Auswertung des Fragebogens zum Dikr
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwieweit das rituelle Gottgedenken (Dikr) zu Beginn des Unterrichts eine Prävention für Unterrichtsstörungen im islamischen Religionsunterricht darstellt. Die Studie basiert auf einer empirischen Untersuchung an zwei siebten Klassen einer Gesamtschule, wobei eine Klasse als Experimentalgruppe (mit Dikr) und die andere als Kontrollgruppe (ohne Dikr) fungiert.
- Prävention von Unterrichtsstörungen im islamischen Religionsunterricht
- Wirkung des rituellen Gottgedenkens (Dikr)
- Institutionelle und anthropologische Bedingungen im Unterricht
- Definition und Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen
- Empirische Untersuchung mit Experimental- und Kontrollgruppe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt die Forschungsfrage ein: Inwieweit kann das rituelle Gottgedenken (Dikr) zu Beginn des Unterrichts Unterrichtsstörungen im islamischen Religionsunterricht vorbeugen? Es wird der allgemeine Kontext von Ritualen und Ordnung im Schulunterricht, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, beleuchtet und die Herausforderungen für Lehrkräfte im Umgang mit Unterrichtsstörungen hervorgehoben. Die Arbeit argumentiert für die Bedeutung eines einleitenden Verständnisses der Religion und die Förderung autonomer Individuen im islamischen Religionsunterricht, wobei Respekt und Erkenntnisinteresse im Vordergrund stehen. Die Autorin beschreibt ihre Motivation, religiöse Praktiken im Unterricht zu erforschen, um Herausforderungen im Unterricht zu begegnen, insbesondere die Unruhe im islamischen Religionsunterricht bei jüngeren Schülern, die durch Meinungsverschiedenheiten und den Wunsch nach Austausch von Vorwissen entsteht. Die Einleitung legt den Grundstein für die empirische Untersuchung, die die Frage nach der präventiven Wirkung des Dikr auf Unterrichtsstörungen klären soll.
2. Bedingungsanalyse: Dieses Kapitel analysiert die institutionellen und anthropologischen Bedingungen, die die Untersuchung beeinflussen. Der institutionelle Teil beschreibt die ähnlichen Voraussetzungen der Experimental- und Kontrollgruppe (zwei siebte Klassen), betont die Ähnlichkeiten in der Ausbildung der Lehrkräfte und den Ausstattung der Klassenräume. Es wird darauf hingewiesen, dass das Fach Islamischer Religionsunterricht an der Schule neu ist, keine einheitlichen Lehrbücher verwendet werden und die Zusammensetzung der Klassen hinsichtlich Geschlecht und Schülerzahl beschrieben wird. Der anthropologische Teil beleuchtet die religiöse Sozialisation der Schüler, ihr Vorwissen, ihr Arbeits- und Sozialverhalten, ihre Sprachkenntnisse und ihren Migrationshintergrund. Die Heterogenität der Schülergruppe (einschließlich Kriegsflüchtlinge und Kinder mit besonderem Förderbedarf) wird als wichtiger Aspekt für die Interpretation der Ergebnisse betont.
3. Der Begriff „Unterrichtsstörung“: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des vielschichtigen Begriffs „Unterrichtsstörung“. Es wird betont, dass die Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen subjektiv und lehrerabhängig ist. Unter Bezugnahme auf Literatur wird die Problematik der unterschiedlichen Definitionen und Interpretationen des Begriffs in der Fachliteratur diskutiert. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren Definition für die vorliegende Untersuchung, um eine objektive Bewertung der Wirkung des Dikr zu ermöglichen. Im Kontext der Studie soll das rituelle Gottgedenken durch die Schaffung einer besseren Atmosphäre Unterrichtsstörungen vorbeugen.
Schlüsselwörter
Dikr, rituelles Gottgedenken, Unterrichtsstörungen, islamischer Religionsunterricht, Prävention, empirische Untersuchung, Experimentalgruppe, Kontrollgruppe, institutionelle Bedingungen, anthropologische Bedingungen, Schülerverhalten, Migrationshintergrund, religiöse Praxis.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Prävention von Unterrichtsstörungen durch rituelles Gottgedenken (Dikr) im islamischen Religionsunterricht
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht die präventive Wirkung des rituellen Gottgedenkens (Dikr) zu Beginn des Unterrichts auf Unterrichtsstörungen im islamischen Religionsunterricht. Es wird untersucht, ob das Dikr dazu beitragen kann, die Unterrichtsqualität zu verbessern und Störungen zu reduzieren.
Welche Methode wurde verwendet?
Es wurde eine empirische Untersuchung an zwei siebten Klassen einer Gesamtschule durchgeführt. Eine Klasse diente als Experimentalgruppe (mit Dikr), die andere als Kontrollgruppe (ohne Dikr). Die Ergebnisse wurden verglichen, um die Wirkung des Dikr zu evaluieren.
Welche Aspekte wurden in der Bedingungsanalyse berücksichtigt?
Die Bedingungsanalyse umfasste sowohl institutionelle als auch anthropologische Faktoren. Institutionell wurden die Ähnlichkeiten der beiden Klassen (z.B. Lehrerqualifikation, Ausstattung) betrachtet. Anthropologisch wurden die religiöse Sozialisation der Schüler, ihr Vorwissen, ihr Sozialverhalten, ihre Sprachkenntnisse und ihr Migrationshintergrund analysiert. Die Heterogenität der Schülerschaft wurde als wichtiger Aspekt für die Interpretation der Ergebnisse hervorgehoben.
Wie wurde der Begriff „Unterrichtsstörung“ definiert?
Die Studie diskutiert die Problematik der subjektiven und lehrerabhängigen Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen. Es wird auf die unterschiedlichen Definitionen in der Fachliteratur eingegangen und eine klare Definition für die Zwecke der Untersuchung festgelegt. Im Kontext der Studie sollen Unterrichtsstörungen als Verhaltensweisen verstanden werden, die den ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf behindern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Bedingungsanalyse (institutionelle und anthropologische Bedingungen), Der Begriff „Unterrichtsstörung“, Das theoretische Vorhaben, Das praktische Vorhaben, Auswertung des Fragebogens zum Dikr und Fazit.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die konkreten Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens und der Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe werden im Kapitel "Auswertung des Fragebogens zum Dikr" detailliert dargestellt. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammen und bewertet die Wirksamkeit des Dikr als präventive Maßnahme gegen Unterrichtsstörungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Dikr, rituelles Gottgedenken, Unterrichtsstörungen, islamischer Religionsunterricht, Prävention, empirische Untersuchung, Experimentalgruppe, Kontrollgruppe, institutionelle Bedingungen, anthropologische Bedingungen, Schülerverhalten, Migrationshintergrund, religiöse Praxis.
Für wen ist diese Studie relevant?
Die Studie ist relevant für Lehrer im islamischen Religionsunterricht, Religionswissenschaftler, Pädagogen und alle, die sich mit der Prävention von Unterrichtsstörungen und der Integration religiöser Praktiken im Unterricht auseinandersetzen.
Wo finde ich die vollständige Studie?
Die vollständige Studie ist (hier den Ort einfügen, wo die Studie zugänglich ist, z.B. "bei der entsprechenden Hochschule einsehbar" oder "in der Universitätsbibliothek verfügbar").
- Quote paper
- Deniz Mikail Barut (Author), 2020, Das rituelle islamische Gottgedenken (Dikr) als Prävention für Unterrichtsstörungen? Bedingungen und Beobachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934529