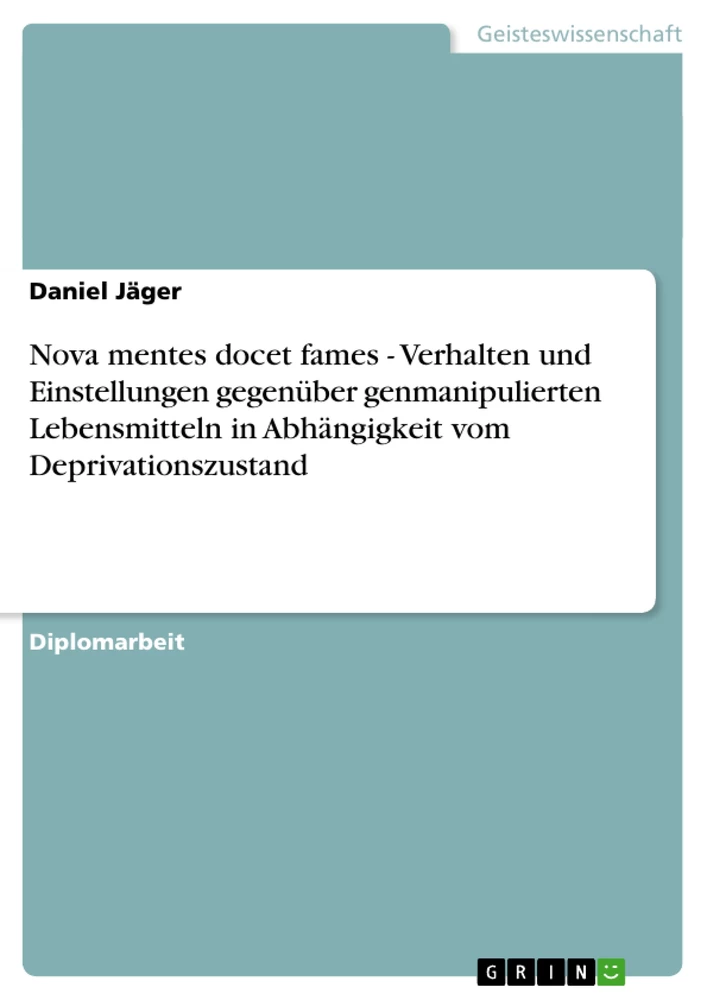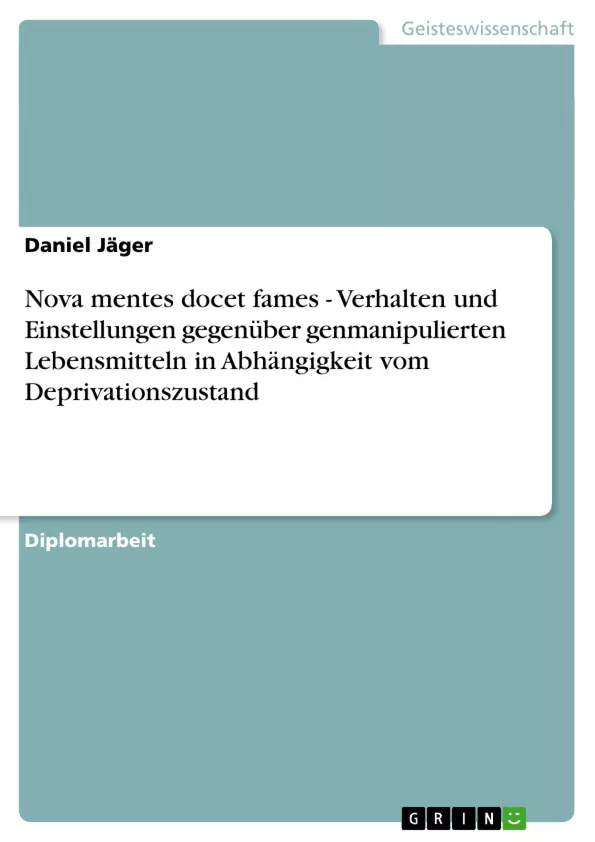Die vorliegende empirische Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema, wie genmanipulierte Lebensmittel im reflektiven System und auf Ebene der automatischen Informationsverarbeitung bewertet werden. Zusätzlich war von Interesse, ob Personen tatsächlich bereit sind, Genfood essen würden und wie viel sie davon konsumieren. Sowohl die Einstellungen als auch das beobachtete Verhalten wurden zusätzlich unter dem Einfluss des subjektiv erlebten Hungers untersucht und anhand des Reflective-Impulsive-Models (Strack & Deutsch, 2004) erörtert.
Es konnte gezeigt werden, dass ungeachtet des Hungerzustandes sowohl die automatischen als auch die expliziten Bewertungen gegenüber Genfood negativer ausfallen, als für Ökofood. Kontra-intuitiv differenzierten hungrige Personen stärker zwischen Gen- und Öko-food, wohingegen satte Probanden diese Unterscheidung nicht vornahmen. Ein nahrungsaufwertender Effekt des Deprivationszustandes, wie er exemplarisch von Hoefling & Strack (2007) im Kontext der Emotion Ekel berichtet wurde, konnte lediglich auf expliziter Ebene als deskriptive Tendenz ermittelt werden. Trotz der negativen Einstellungen gegenüber Genfood lehnte nur eine Person den Konsum des angeblichen Gen-Apfels ab. Unabhängig vom Hungerzustand präferierten die Teilnehmer den Bioapfel mehr, wohingegen hungrige Testpersonen deutlich mehr vom Gen-Apfel gegessen haben, als es vergleichsweise die satten Probanden taten. Auf Verhaltensebene konnte demzufolge ein aufwertender Einfluss der Deprivation auf Genfood bestätigt werden.
Die Studie stellt einen umfassenden Versuch dar, erstmalig Einstellungen und Verhalten gegenüber Genfood unter Berücksichtigung homöstatischer Dysregulation experimentell zu erfassen. Ferner werden die gesammelten Erkenntnisse mit bisherigen Literaturbefunden in Beziehung gesetzt und in das „Reflective-Impulsive-Model“ übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- Theorie
- Einleitung
- Gentechnik: Begriffe, Definitionen und Anwendungen
- Bisheriger Stand der psychologischen Forschung zu Genfood
- Moderierende Variablen auf die Einstellungen gegenüber Genfood
- Akzeptanz und habituelle Ablehnung von Genfood
- Implizite Einstellungen gegenüber Genfood
- Implizite und explizite Einstellungen gegenüber Genfood aus Perspektive des RIMS (Strack & Deutsch, 2004)
- Überblick über das RIM (Strack & Deutsch, 2004)
- Erklärungsansatz zur Dissoziation zwischen impulsivem und reflektivem System gegenüber Genfood
- Modulation der Ekel- und Ablehnungsreaktionen gegenüber Genfood durch Nahrungsdeprivation
- Hypothesen
- Methoden
- Versuchspersonen
- Versuchsaufbau
- Versuchsdesign
- Versuchsablauf
- Unabhängige Variablen
- Manipulation der Variable “Deprivation”
- Manipulation der Variable “Bezeichnung”
- Abhängige Variablen
- Implizite Einstellungen
- Explizite Einstellungen
- Essverhalten
- Kontrollvariablen
- Variable Stimmung
- Erfassung der Akzeptanz und habituellen Ablehnung von Genfood
- Ergebnisse
- Analysestichprobe
- Vorbereitende Analysen
- Überprüfung der Manipulationen
- Ergebnisse zu den impliziten Einstellungen
- Datenaggregation
- Einfluss von Bezeichnung und Deprivation auf implizite Einstellungen
- Ergebnisse zu den expliziten Einstellungen
- Bewertung der Appetitlichkeit von Genfood vs. Ökofood
- Bewertung der Konsumtendenz von Genfood vs. Ökofood
- Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten Einstellungen
- Ergebnisse zum Verhaltensmaβ
- Gegessene Menge in Abhängigkeit von Deprivation & Bezeichnung
- Vorhersage des Essverhaltens
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Diskussion und Fazit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Bewertung von genmanipulierten Lebensmitteln im reflektiven System und auf der Ebene der automatischen Informationsverarbeitung. Zudem wird untersucht, ob Personen tatsächlich bereit sind, Genfood zu konsumieren, und in welchem Ausmaß. Sowohl Einstellungen als auch Verhalten werden im Kontext des subjektiv erlebten Hungers analysiert, wobei das Reflective-Impulsive-Model (RIM) von Strack & Deutsch (2004) als theoretischer Rahmen dient.
- Bewertung von genmanipulierten Lebensmitteln im reflektiven System und auf der Ebene der automatischen Informationsverarbeitung
- Bereitschaft zum Konsum von Genfood und Einfluss des subjektiv erlebten Hungers
- Anwendung des Reflective-Impulsive-Model (RIM) zur Erklärung von Einstellungen und Verhalten gegenüber Genfood
- Untersuchung der Rolle des Deprivationszustandes in Bezug auf die Bewertung von Genfood
- Zusammenhang zwischen impliziten und expliziten Einstellungen gegenüber Genfood
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die theoretischen Grundlagen dar. Es werden zunächst Begriffe, Definitionen und Anwendungen der Gentechnik erläutert. Anschließend wird der Stand der psychologischen Forschung zu Genfood beleuchtet, wobei insbesondere moderierende Variablen auf die Einstellungen gegenüber Genfood, die Akzeptanz und habituelle Ablehnung von Genfood sowie implizite Einstellungen gegenüber Genfood im Fokus stehen. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Diskussion des Reflective-Impulsive-Model (RIM) und seiner Anwendung im Kontext von Einstellungen und Verhalten gegenüber Genfood. Dabei wird auch auf die Rolle der Nahrungsdeprivation bei der Modulation der Ekel- und Ablehnungsreaktionen gegenüber Genfood eingegangen.
Kapitel Zwei beschreibt die Methodik der Studie. Es werden die Versuchspersonen, der Versuchsaufbau, das Versuchsdesign und der Versuchsablauf detailliert dargestellt. Die unabhängigen Variablen „Deprivation“ und „Bezeichnung“ sowie die abhängigen Variablen „implizite Einstellungen“, „explizite Einstellungen“ und „Essverhalten“ werden definiert und erläutert. Zusätzlich werden die Kontrollvariablen „Stimmung“ und „Erfassung der Akzeptanz und habituellen Ablehnung von Genfood“ vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Zunächst wird die Analysestichprobe beschrieben und die vorbereitenden Analysen sowie die Überprüfung der Manipulationen dargestellt. Im Anschluss werden die Ergebnisse zu den impliziten Einstellungen, den expliziten Einstellungen und dem Essverhalten detailliert analysiert. Schließlich werden die Zusammenhänge zwischen impliziten und expliziten Einstellungen sowie die Vorhersage des Essverhaltens diskutiert.
Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und diskutiert deren Bedeutung im Kontext der bestehenden Literatur. Darüber hinaus werden die Limitationen der Studie aufgezeigt und zukünftige Forschungsansätze vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Genmanipulierte Lebensmittel, Genfood, Einstellungen, Verhalten, Deprivation, Hunger, Reflective-Impulsive-Model (RIM), implizite Einstellungen, explizite Einstellungen, automatische Informationsverarbeitung, reflektives System.
Häufig gestellte Fragen zu genmanipulierten Lebensmitteln und Hunger
Wie beeinflusst Hunger die Akzeptanz von Genfood?
Die Studie zeigt, dass hungrige Personen deutlich mehr von angeblichen genmanipulierten Lebensmitteln essen als satte Probanden, was auf einen nahrungsaufwertenden Effekt von Hunger hinweist.
Was ist das Reflective-Impulsive-Model (RIM)?
Das RIM unterscheidet zwischen einem reflektiven System (bewusste Bewertung) und einem impulsiven System (automatische Verarbeitung). Die Arbeit nutzt dieses Modell, um Widersprüche zwischen Einstellung und Essverhalten zu erklären.
Werden genmanipulierte Lebensmittel negativer bewertet als Bio-Produkte?
Ja, sowohl die automatischen (impliziten) als auch die bewussten (expliziten) Bewertungen fallen gegenüber Genfood deutlich negativer aus als gegenüber Ökofood.
Gibt es eine Dissoziation zwischen Einstellung und Verhalten bei Genfood?
Ja. Trotz starker negativer Einstellungen lehnten im Experiment fast alle Teilnehmer den Konsum eines „Gen-Apfels“ nicht ab, besonders wenn sie hungrig waren.
Welche Rolle spielt Ekel bei der Ablehnung von Genfood?
Nahrungsdeprivation (Hunger) kann Ekel- und Ablehnungsreaktionen modulieren, was dazu führt, dass moralische oder gesundheitliche Bedenken hinter das Bedürfnis der Sättigung zurücktreten.
- Quote paper
- Daniel Jäger (Author), 2008, Nova mentes docet fames - Verhalten und Einstellungen gegenüber genmanipulierten Lebensmitteln in Abhängigkeit vom Deprivationszustand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93489