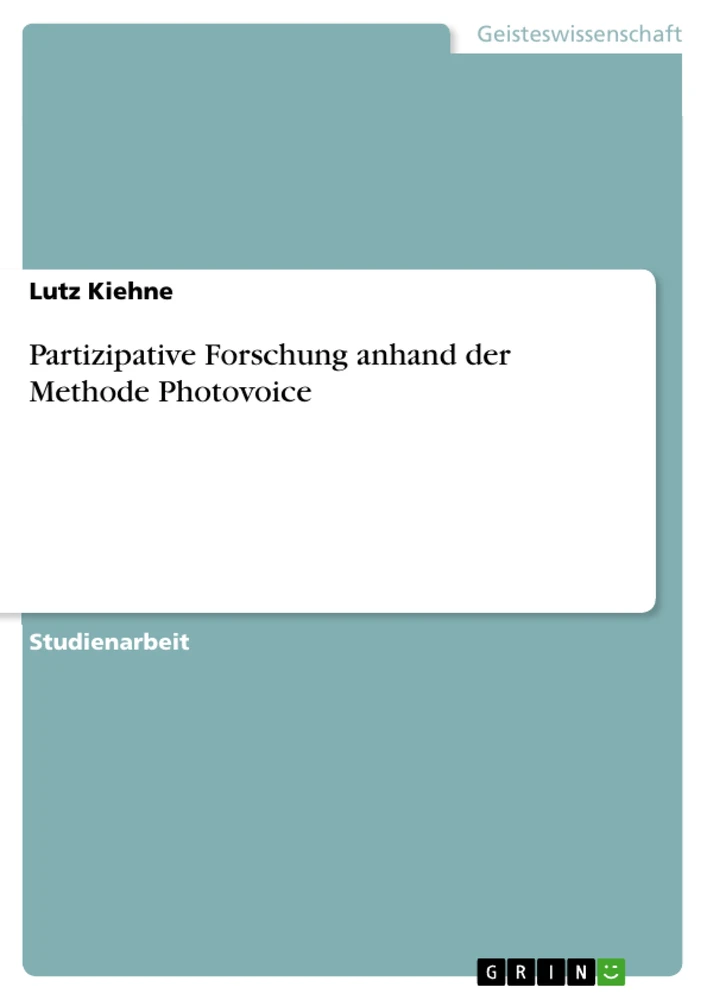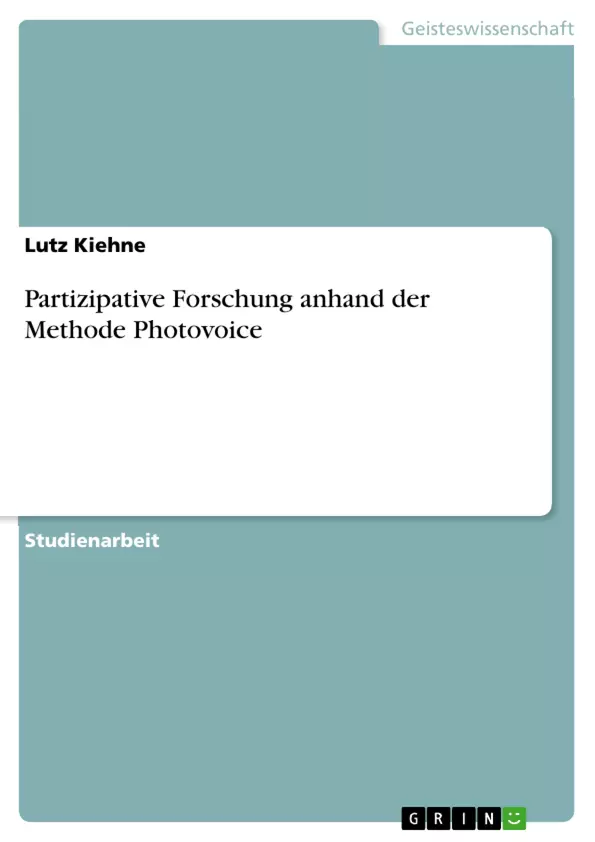In dieser Arbeit wird die Methode Photovoice im Kontext Partizipativer Forschung betrachtet.
In diesem Portfolio werde ich im ersten Abschnitt kurz die Idee eines partizipativen Projektes mit Schülerinnen und Schülern einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung vorstellen und begründen, warum die Wahl der Methode auf Photovoice fiel. Darüber hinaus stelle ich in diesem Teil die Methode grob umrissen vor.
In den folgenden Teilen rekapituliere ich ausgewählte Texte zu dem Thema Partizipatorische Forschung, wobei mein Augenmerk aus den genannten Gründen auf der Methode Photovoice liegt. Um mir den Inhalt der Texte besser und dauerhafter aneignen zu können, las ich sie im ersten Schritt, filterte in einem zweiten Schritt die für mich relevant erscheinenden Inhalte anhand von Exzerpten heraus und formulierte diese Exzerpte in einem dritten Schritt der besseren Lesbarkeit halber mit eigenen Worten neu. Die Auswahl gerade dieser Texte liegt in ihren inhaltlichen Grundaussagen begründet, die ich für die weitere Entwicklung des angedachten Projektes als sehr wichtig erachte. So löst z.B. Bergolds Text unter anderem das oft verbreitete Vorurteil auf, Forschung könne nicht partizipativ sein, was mir in Zukunft die Argumentation gegenüber ablehnenden Entscheidungsträgern vereinfacht. Der Text von Zander war für mich sehr erhellend, weil er anhand einiger Beispiele noch einmal klar den emanzipatorischen Charakter partizipativer Forschung aufzeigt und mich so in meinem Entschluss bestärkte, dieses Projekt umsetzen zu wollen und auch zu können. Hackls Text erscheint mir für die Umsetzung meines Projektes als wichtig, da er durch die komprimierten Erkenntnisse aus internationaler Literatur zum Thema partizipative Forschung Vorbedingungen, Vorteile, Umsetzungsschwierigkeiten etc. aufzeigt, die auf mich innerhalb des Schulprojektes zukommen können. Darüber hinaus werden weitere Methoden beschrieben, die ich eventuell unterstützend zur Methode Photovoice im Rahmen des geplanten Projektes anwenden kann, sofern sich die Schülerinnen und Schüler darauf einlassen.
Nach diesen Rekapitulationen für mich in Bezug auf das geplante Projekt relevant erscheinender Texte beschäftige ich mich kurz mit der Anfertigung von Transkripten und dem Umgang mit sensiblen Daten, bevor ich ein Fazit ziehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Idee eines eigenen Photovoice-Projektes
- Rekapitulation: Bergold, Jarg B. (2013): Partizipative Forschung und Forschungsstrategien.
- Rekapitulation: Zander, Michael (2008): Und Action! Aktionsforschung: Die grosse Schwester der Militanten Untersuchung
- Rekapitulation: Hackl, Marion (2014): Methoden partizipativer Forschungsprojekte mit Jugendlichen. Eine Aufarbeitung ausgewählter wissenschaftlicher Artikel in englischsprachigen Fachjournalen
- Das Transkript
- Sensible Daten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Portfolios ist die Vorstellung eines partizipativen Forschungsprojektes mit Schülerinnen und Schülern einer Förderschule, unter Verwendung der Photovoice-Methode. Es wird untersucht, wie die Methode dazu beitragen kann, dass Jugendliche sich ihrer Rechte bewusster werden und gesellschaftliche Barrieren in Bezug auf Teilhabe benennen und überwinden können. Die Rekapitulation ausgewählter Texte dient der theoretischen Fundierung des Projekts.
- Partizipative Forschung und ihre Bedeutung für die soziale Arbeit
- Die Photovoice-Methode als Instrument der partizipativen Forschung
- Inklusion und die Bewusstmachung von Rechten behinderter Menschen
- Herausforderungen und Möglichkeiten partizipativer Forschungsprojekte mit Jugendlichen
- Umgang mit sensiblen Daten in partizipativen Forschungsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation des Autors, ein partizipatives Forschungsprojekt mit Jugendlichen an einer Förderschule durchzuführen. Der Fokus liegt auf der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Förderschwerpunkten und dem Wunsch, diese durch partizipative Forschung zu thematisieren und zu überwinden. Die Methode Photovoice wird als geeigneter Ansatz vorgestellt, um die Perspektiven der Jugendlichen zu erfassen und ihre Stimme zu stärken. Der Autor erläutert seinen Vorgehensweise, die aus der Lektüre und Zusammenfassung relevanter Texte besteht, um das Projekt zu fundieren. Diese Texte bieten eine theoretische Grundlage und argumentative Unterstützung.
Idee eines eigenen Photovoice-Projektes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das geplante Photovoice-Projekt an einer Förderschule für geistig behinderte Jugendliche. Es wird der Kontext der Schule, die pädagogische Philosophie und die Zusammensetzung der Lerngruppen erläutert. Der Autor betont die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der UN-BRK und der Realität der Teilhabe behinderter Menschen. Die Wahl von Photovoice als Methode wird mit der niedrigschwelligen Anwendbarkeit und dem großen Interesse der Jugendlichen an Fotografie begründet. Das Kapitel endet mit der Beschreibung des ersten Schrittes des Projekts: einem gemeinsamen Gespräch mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung.
Rekapitulation: Bergold, Jarg B. (2013): Partizipative Forschung und Forschungsstrategien.: Diese Zusammenfassung fokussiert auf die Kernaussagen von Bergolds Werk, welches Vorurteile gegen partizipative Forschung entkräftet. Es wird herausgearbeitet, wie Bergolds Argumentation den Autor in seiner Projektidee bestärkt und ihm in Zukunft die Argumentation gegenüber potenziellen Kritikern erleichtert. Der Fokus liegt auf der Klärung grundlegender Konzepte und der Nutzbarkeit dieser Erkenntnisse für die eigene Arbeit.
Rekapitulation: Zander, Michael (2008): Und Action! Aktionsforschung: Die grosse Schwester der Militanten Untersuchung: Die Zusammenfassung beleuchtet Zandars Ausführungen zum emanzipatorischen Charakter partizipativer Forschung. Es werden Beispiele aus Zandars Werk aufgezeigt, die den Autor in seinem Entschluss, das Projekt umzusetzen, bestärkt haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Bestätigung des emanzipatorischen Ansatzes und der Stärkung der eigenen Motivation für das Projekt.
Rekapitulation: Hackl, Marion (2014): Methoden partizipativer Forschungsprojekte mit Jugendlichen. Eine Aufarbeitung ausgewählter wissenschaftlicher Artikel in englischsprachigen Fachjournalen: Hackls Text wird als wichtig für die praktische Umsetzung des Projektes hervorgehoben, da er Vorbedingungen, Vorteile und Schwierigkeiten partizipativer Forschung mit Jugendlichen aufzeigt. Die Zusammenfassung konzentriert sich auf die Erkenntnisse aus internationaler Literatur, die für das Projekt relevant sind. Zusätzlich werden andere Methoden erwähnt, die potenziell unterstützend eingesetzt werden könnten.
Schlüsselwörter
Partizipative Forschung, Photovoice, Inklusion, Soziale Arbeit, Behinderung, Jugendliche, Emanzipation, Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe, Methoden der Sozialforschung, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zum Portfolio: Partizipative Forschung mit Jugendlichen mittels Photovoice
Was ist das Thema des Portfolios?
Das Portfolio beschreibt ein partizipatives Forschungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern einer Förderschule, das die Photovoice-Methode verwendet. Es untersucht, wie Photovoice Jugendlichen hilft, sich ihrer Rechte bewusster zu werden und gesellschaftliche Barrieren bezüglich Teilhabe zu benennen und zu überwinden.
Welche Methode wird im Projekt eingesetzt?
Die Hauptmethode ist Photovoice. Diese Methode ermöglicht es den Jugendlichen, ihre Perspektiven und Erfahrungen durch Fotografie auszudrücken und ihre Stimme zu stärken. Die niedrigschwellige Anwendbarkeit und das große Interesse der Jugendlichen an Fotografie waren ausschlaggebend für die Wahl dieser Methode.
Welche Zielsetzung verfolgt das Portfolio?
Das Portfolio präsentiert das partizipative Forschungsprojekt und seine theoretische Fundierung. Es zeigt, wie die Photovoice-Methode dazu beitragen kann, die Rechte und die Teilhabe behinderter Jugendlicher zu fördern. Die Rekapitulationen ausgewählter Texte dienen der theoretischen Untermauerung des Projekts.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf partizipativer Forschung, der Photovoice-Methode, Inklusion, der Bewusstmachung von Rechten behinderter Menschen, den Herausforderungen und Möglichkeiten partizipativer Forschung mit Jugendlichen und dem Umgang mit sensiblen Daten.
Welche Texte wurden rekapituliert?
Das Portfolio enthält Zusammenfassungen folgender Texte: Bergold, Jarg B. (2013): Partizipative Forschung und Forschungsstrategien; Zander, Michael (2008): Und Action! Aktionsforschung: Die grosse Schwester der Militanten Untersuchung; und Hackl, Marion (2014): Methoden partizipativer Forschungsprojekte mit Jugendlichen. Diese Texte liefern die theoretische Grundlage für das Projekt.
Was wird in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Das Portfolio beinhaltet eine Einleitung, die Beschreibung des Photovoice-Projekts, Zusammenfassungen der drei oben genannten Texte, ein Kapitel zum Umgang mit sensiblen Daten und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Projekts oder der theoretischen Fundierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Portfolio?
Schlüsselwörter sind: Partizipative Forschung, Photovoice, Inklusion, Soziale Arbeit, Behinderung, Jugendliche, Emanzipation, Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe, Methoden der Sozialforschung und qualitative Forschung.
Warum wurde Photovoice gewählt?
Photovoice wurde aufgrund seiner niedrigschwelligen Anwendbarkeit und dem großen Interesse der Jugendlichen an Fotografie gewählt. Es ermöglicht eine partizipative und selbstbestimmte Erfassung der Perspektiven der Jugendlichen.
Welche Zielgruppe wird im Projekt angesprochen?
Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler einer Förderschule für geistig behinderte Jugendliche. Der Fokus liegt auf der Förderung ihrer Rechte und der Verbesserung ihrer Teilhabe an der Gesellschaft.
Wie werden sensible Daten im Projekt behandelt?
Das Portfolio widmet ein eigenes Kapitel dem Umgang mit sensiblen Daten. Es wird detailliert beschrieben, wie der Datenschutz im Rahmen des Projekts gewährleistet wird.
- Quote paper
- Sozialarbeiter B.A. Lutz Kiehne (Author), 2018, Partizipative Forschung anhand der Methode Photovoice, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935279