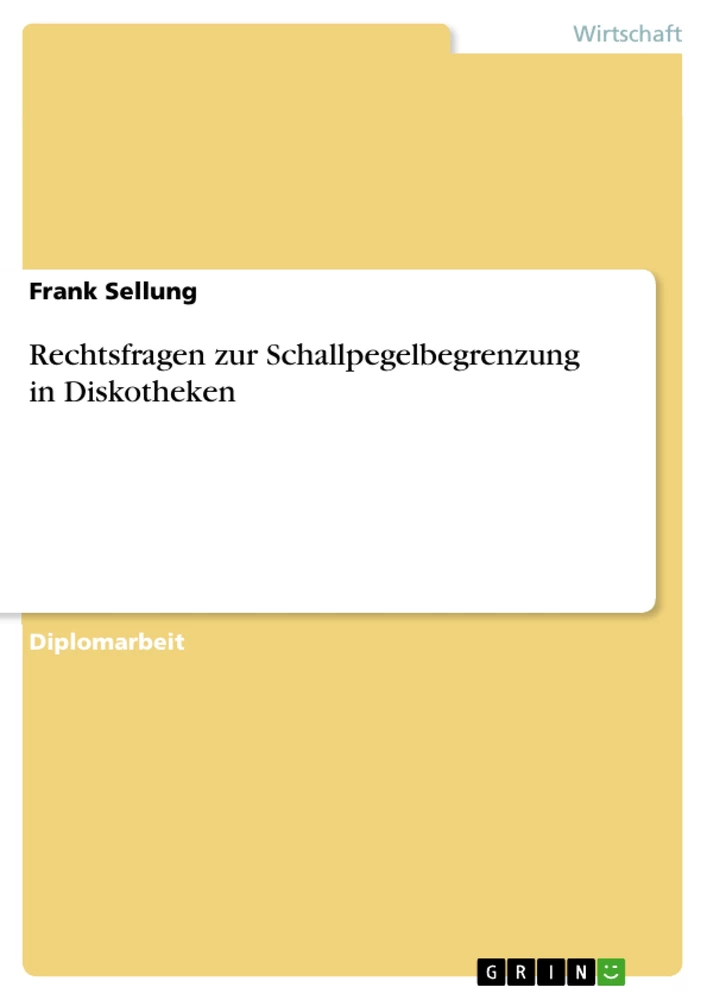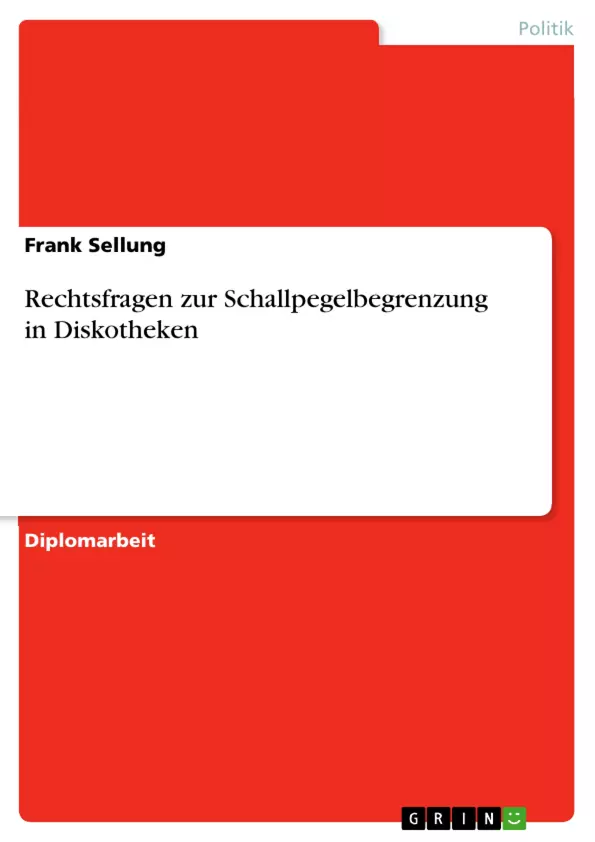Die Gesundheit ist dem Menschen ein hohes, vielleicht sogar das höchste Gut. Sie zu fördern und zu schützen ist essentieller Bestandteil des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und damit auch Verpflichtung des Staates. Alarmierende Berichte sowohl in der Fach- als auch der Tagespresse weisen darauf hin, dass die Menschen aufgrund wachsender Industrialisierung und technischer Ausdehnung einem höheren gesundheitlichen Gefährdungspotential gegenüberstehen. Neben bedeutenden sozialpolitischen Problemen wie Lärm am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr, rückt seit einigen Jahren die Relevanz von Gesundheitsrisiken durch Freizeitlärm in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Epidemiologische Untersuchungen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die noch keiner beruflichen Lärmbelastung ausgesetzt waren, lassen steigende Zahlen mit nachweisbaren, irreversiblen Innenohrschäden erkennen.
Neben dem Problem der massiven Gefährdung von Kindern und Jugendlichen beim Benutzen von tragbaren Musikabspielgeräten mit Kopfhörern (z. B. Walkman) bei denen anhand von Untersuchungen Einstellungen mit einem mittleren Hörpegel von 100 Dezibel (dB(A)) festgestellt wurden, sieht der Bundesverband der HNO-Ärzte sowie die Bundesärztekammer ebenfalls die Verfügbarkeit der elektroakustischen Verstärkung von Musik in Diskotheken und bei Musikgroßveranstaltungen als wesentliche Ursache.4 Nach einer Projektstudie zu Diskothekenveranstaltungen durch die TU Dresden, Institut für Arbeitsingenieurwesen, sind Mittlungspegel zwischen 102 dB(A) und 112 dB(A) ermittelt wurden. Vergleichsweise ist somit die Schallbelastung deutlich höher, als die durch eine mit Lastkraftwagen stark befahrene Autobahn oder die durch eine Bohrmaschine verursachten Geräusche.5 Während im Berufsleben harte Grenzwerte für Schallbelastungen existieren, wird dem hochintensiven Schall im Musikkonsum weder umfassend auf EU-Ebene noch einheitlich durch das deutsche Rechtssystem entgegen gewirkt.
Inhalt dieser Diplomarbeit soll deshalb vordergründig die generelle Bewältigung der Problematik einer Vereinheitlichung des Gesetzesvollzugs sein und nicht die Möglichkeit von Maßnahmen im Einzelfall, z. B. durch entsprechende Auflagen an die Betreiber von Gaststätten. Ebenfalls soll nur der Bezug zu den Besuchern von Diskotheken hergestellt werden. Somit bleiben Rückschlüsse u. a. auf Angestellte und folglich Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung unberücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK
- 1.1 EINLEITUNG
- 1.2 GESUNDHEITLICHE ASPEKTE
- 1.3 MUSIKSCHALLPEGEL IN DISKOTHEKEN
- 1.4 RECHTSLAGE
- 2. LÄRM
- 2.1 IMMISSIONSSCHUTZ
- 2.2 GEWERBE- UND GASTSTÄTTENRECHT
- 2.3 POLIZEIRECHT
- 3. ZUSTÄNDIGKEIT
- 4. RECHTMÄBIGKEIT EINER POLIZEIVERORDNUNG
- 5. REGELUNGSINHALT
- 6. WEG ZUR VERORDNUNG
- 7. ERGEBNIS
- THESEN
- LITERATURVERZEICHNIS
- NORMEN UND RICHTLINIEN
- RECHTSPRECHUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der rechtlichen Problematik der Schallpegelbegrenzung in Diskotheken. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen für die Regulierung von Lärm in diesen Einrichtungen zu analysieren und die Möglichkeiten zur effektiven Umsetzung eines Schallpegelschutzkonzepts aufzuzeigen.
- Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm
- Rechtliche Grundlagen des Immissionsschutzes
- Zuständigkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen im Gewerberecht und Polizeirecht
- Regulierung von Schallpegeln in Diskotheken
- Rechtmäßigkeit von Polizeiverordnungen zur Lärmbegrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Schallpegelbegrenzung in Diskotheken ein und behandelt die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm sowie die rechtlichen Grundlagen des Immissionsschutzes.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Lärm im Allgemeinen, insbesondere mit den rechtlichen Aspekten des Immissionsschutzes, den Vorschriften des Gewerbe- und Gaststättenrechts sowie den Kompetenzen der Polizei.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel behandelt die Zuständigkeiten für die Regulierung von Lärm in Diskotheken.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die Rechtmäßigkeit von Polizeiverordnungen zur Lärmbegrenzung in Diskotheken.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt von Verordnungen, die sich mit der Regulierung des Schallpegels in Diskotheken befassen.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel beleuchtet die notwendigen Schritte zur Erarbeitung einer Polizeiverordnung.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse der rechtlichen Grundlagen und der Regulierungsmöglichkeiten von Schallpegeln in Diskotheken zusammen.
Schlüsselwörter
Schallpegelbegrenzung, Diskotheken, Lärm, Immissionsschutz, Gewerberecht, Polizeirecht, Polizeiverordnung, Rechtmäßigkeit, Gesundheitsschutz, rechtliche Grundlagen, Regulierung, Zuständigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Lärmbelastung in Diskotheken üblicherweise?
Untersuchungen zeigen Mittlungspegel zwischen 102 dB(A) und 112 dB(A), was deutlich lauter ist als eine stark befahrene Autobahn oder eine Bohrmaschine.
Welche gesundheitlichen Schäden drohen durch Freizeitlärm?
Es besteht das Risiko für irreversible Innenohrschäden, Tinnitus und langfristigen Hörverlust, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Gibt es gesetzliche Grenzwerte für Musikschallpegel?
Während im Arbeitsschutz klare Grenzwerte existieren, fehlt im deutschen Rechtssystem eine einheitliche, umfassende Regelung für den Freizeitbereich bzw. den Musikkonsum.
Kann die Polizei den Schallpegel in Diskotheken begrenzen?
Ja, über das Polizeirecht und entsprechende Polizeiverordnungen können Kommunen Regelungen zur Gefahrenabwehr und zum Gesundheitsschutz treffen.
Welche Rolle spielt das Gaststättenrecht beim Lärmschutz?
Das Gaststättenrecht ermöglicht es Behörden, Betreibern Auflagen zu erteilen, um schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm zu verhindern.
Was ist das Ziel einer Schallpegelbegrenzung?
Das Hauptziel ist der Gesundheitsschutz der Besucher, um Gehörschäden durch extrem hohe Lautstärken bei Musikveranstaltungen vorzubeugen.
- Arbeit zitieren
- Frank Sellung (Autor:in), 2002, Rechtsfragen zur Schallpegelbegrenzung in Diskotheken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9355