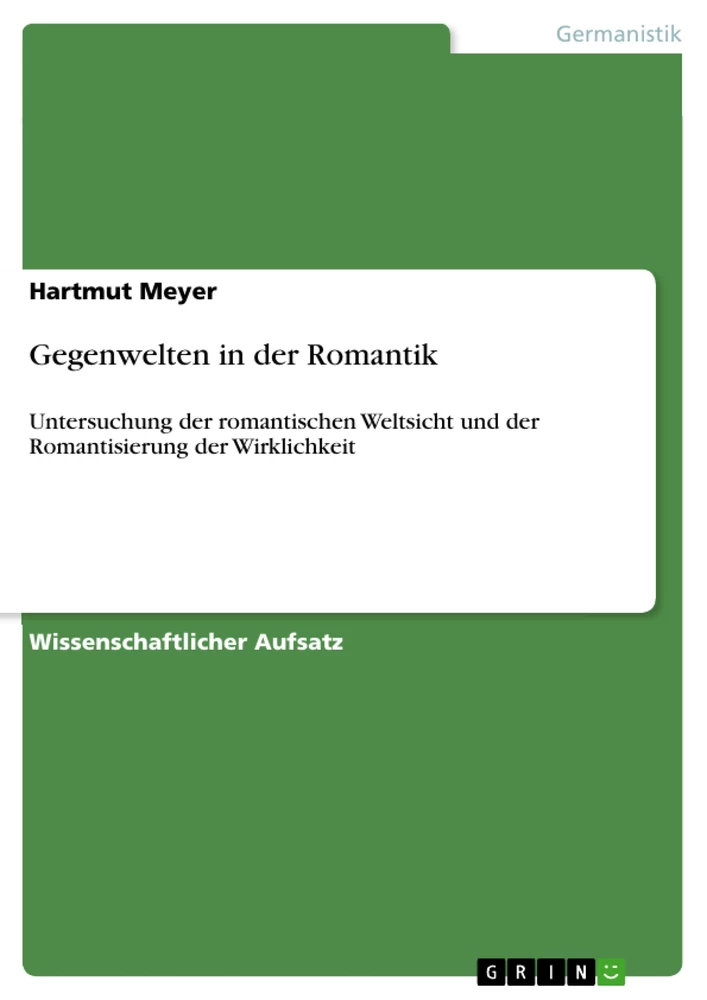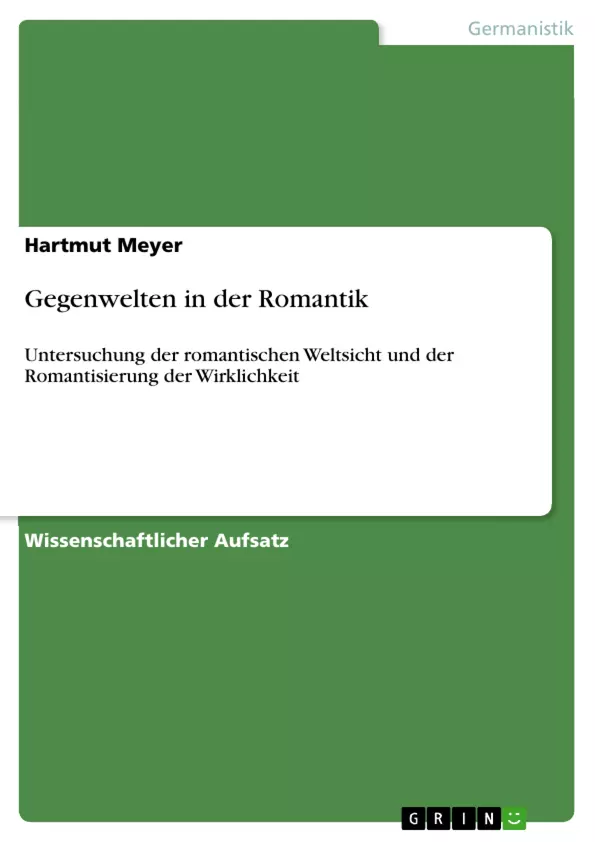Der Gegenstand der Arbeit soll sein, wie sich die Romantiker dazu alternative "Gegenwelten" geschaffen haben, und zwar "in der Romantik". Die Präposition "in" grenzt die Epoche der Romantik von den anderen literarischen Epochen – Aufklärung, Weimarer Klassik – von vornherein ab, die um 1800 literarisch wirksam waren.
Mit ihrer Literatur formulierten die Romantiker katexochen eine abweichende Rezeption von Wirklichkeit und Sicht auf ihre vorfindliche Welt, mit der sie nicht zufrieden waren und an der sie einiges auszusetzen hatten. Wie sich diese explizit antiaufklärerische Kritik artikulierte und welches ihr Zweck war, nämlich (nicht nur) literarisch ein "Rollback" des Mystizismus und des Aberglaubens zu bewerkstelligen, soll in dieser Arbeit aufgezeigt und erklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der bürgerliche Staat in statu nascendi
- II. Ein neuer ästhetischer Entwurf: Romantisierung der Wirklichkeit
- III. Sonderlinge und Außenseiter
- IV. Die Kritik an den Philistern
- V. Die schwarze Romantik
- VI. Kritik an den Romantikern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung alternativer „Gegenwelten“ in der Romantik als Reaktion auf die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie die Romantiker auf die aufkommende bürgerliche Gesellschaft reagierten und welche ästhetischen Entwürfe sie als Gegenposition entwickelten.
- Die polit-ökonomischen Bedingungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und der Aufstieg des Bürgertums
- Die romantische Weltsicht und der Versuch einer „Romantisierung der Wirklichkeit“
- Die Rolle der Romantiker als „Sonderlinge und Außenseiter“ im Literaturbetrieb
- Die romantische Kritik an der Philistergesellschaft
- Die „schwarze Romantik“ als Ausdruck oppositioneller Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Der bürgerliche Staat in statu nascendi: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Es beschreibt den Aufstieg des Bürgertums, seine ökonomische Dominanz und seinen konfliktreichen Umgang mit den bestehenden absolutistischen Strukturen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer neuen Arbeitsethik und der Entstehung einer bürgerlichen Kultur als Gegenpol zur feudalistischen Gesellschaft. Die Entstehung der „bürgerlichen Gesellschaft“ im frühen Stadium ihrer Entwicklung und die damit verbundenen Widersprüche werden ausführlich diskutiert, unter Einbezug von Fußnoten zur politischen Ökonomie und der frühkapitalistischen Entwicklung. Der Übergang von einer agrarisch geprägten Gesellschaft hin zu den Anfängen der Industrialisierung wird im Kontext der sich entwickelnden gesellschaftlichen Strukturen dargestellt. Besonders hervorgehoben wird die Rolle des aufstrebenden Bürgertums, das die Ideen der Aufklärung adaptierte und sich gleichzeitig eine „Gegenwelt“ schuf, die auf Arbeit, Pflichtbewusstsein und einer neuen Moral basierte, welche im Gegensatz zur als „üppig“ und „sinnlich“ empfundenen katholischen Frömmigkeit stand.
II. Ein neuer ästhetischer Entwurf: Romantisierung der Wirklichkeit: Dieses Kapitel (leider nicht im vorliegenden Text enthalten, nur im Inhaltsverzeichnis erwähnt) würde sich vermutlich mit dem romantischen ästhetischen Programm befassen und untersuchen, wie die Romantiker versuchten, die Wirklichkeit zu „romantisieren“. Es wäre zu erwarten, dass die zentralen Figuren Friedrich Schlegel und Novalis hier eine wichtige Rolle spielen und ihre programmatischen Entwürfe im Detail analysiert werden. Es könnte einen Vergleich zwischen der rationalen Sicht der Aufklärung und dem romantischen Gegenentwurf darstellen.
III. Sonderlinge und Außenseiter: Dieses Kapitel (leider nicht im vorliegenden Text enthalten, nur im Inhaltsverzeichnis erwähnt) würde die Position der Romantiker als „Sonderlinge und Außenseiter“ innerhalb des Literaturbetriebs ihrer Zeit erörtern. Es würde ihre bewusste Abgrenzung von der bürgerlichen Gesellschaft und deren Normen untersuchen und analysieren, wie diese Außenseiterposition in ihren Werken zum Ausdruck kam.
IV. Die Kritik an den Philistern: Dieses Kapitel (leider nicht im vorliegenden Text enthalten, nur im Inhaltsverzeichnis erwähnt) würde die Kritik der Romantiker an der bürgerlichen Gesellschaft, den sogenannten „Philistern“, detailliert untersuchen. Es würde die spezifischen Aspekte der Philistermoral analysieren, die von den Romantikern verachtet wurden, sowie die literarischen Strategien, mit denen diese Kritik artikuliert wurde. Clemens Brentano würde in diesem Kontext eine Rolle spielen.
V. Die schwarze Romantik: In diesem Kapitel werden zwei Beispiele der schwarzen Romantik, Hoffmanns „Goldner Topf“ und Chamissos „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“, als „praktische“ Beispiele für die romantischen Gegenwelten analysiert. Die Kapitel würde die spezifischen Merkmale der schwarzen Romantik erörtern und zeigen, wie diese Werke die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und die Sehnsucht nach einer anderen Wirklichkeit zum Ausdruck bringen.
Schlüsselwörter
Romantik, Gegenwelten, Aufklärung, Bürgertum, Philister, schwarze Romantik, Novalis, Friedrich Schlegel, Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann, Chamisso, Romantisierung der Wirklichkeit, politisch-ökonomische Bedingungen, ästhetischer Entwurf, Oppositionelle Dichtung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Entstehung alternativer „Gegenwelten“ in der Romantik
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die Entstehung alternativer „Gegenwelten“ in der deutschen Romantik als Reaktion auf die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen des frühen 19. Jahrhunderts. Er analysiert die Reaktion der Romantiker auf die aufkommende bürgerliche Gesellschaft und ihre ästhetischen Gegenentwürfe.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die polit-ökonomischen Bedingungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, den Aufstieg des Bürgertums, die romantische Weltsicht und den Versuch einer „Romantisierung der Wirklichkeit“, die Rolle der Romantiker als „Sonderlinge und Außenseiter“, die romantische Kritik an der Philistergesellschaft und die „schwarze Romantik“ als Ausdruck oppositioneller Dichtung.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst sechs Kapitel. Kapitel I beleuchtet die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts, den Aufstieg des Bürgertums und die Entstehung einer bürgerlichen Kultur. Kapitel II (nicht im vorliegenden Text enthalten) würde sich mit dem romantischen ästhetischen Programm und der „Romantisierung der Wirklichkeit“ befassen. Kapitel III (nicht im vorliegenden Text enthalten) würde die Position der Romantiker als Außenseiter erörtern. Kapitel IV (nicht im vorliegenden Text enthalten) würde die Kritik der Romantiker an den „Philistern“ analysieren. Kapitel V analysiert die „schwarze Romantik“ anhand von Hoffmanns „Goldner Topf“ und Chamissos „Peter Schlemihl“. Kapitel VI (nicht im vorliegenden Text enthalten) würde Kritik an den Romantikern behandeln.
Welche Autoren werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt Novalis, Friedrich Schlegel, Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann und Chamisso als wichtige Figuren der Romantik.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Romantik, Gegenwelten, Aufklärung, Bürgertum, Philister, schwarze Romantik, Romantisierung der Wirklichkeit, politisch-ökonomische Bedingungen und ästhetischer Entwurf.
Welche Beispiele der „schwarzen Romantik“ werden analysiert?
Der Text analysiert E.T.A. Hoffmanns „Goldner Topf“ und Chamissos „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ als Beispiele für die „schwarze Romantik“.
Wie reagiert der Text auf die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft?
Der Text analysiert die romantische Gegenbewegung zur aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft, indem er die ästhetischen und literarischen Strategien der Romantiker untersucht, um ihre Kritik an den etablierten Normen und Werten auszudrücken. Es wird die Entstehung von alternativen „Gegenwelten“ als Reaktion auf die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen untersucht.
Welche Art von Text ist dies?
Dies ist eine zusammenfassende Übersicht eines längeren Textes, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Thematische Schwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter beinhaltet.
- Quote paper
- Hartmut Meyer (Author), Gegenwelten in der Romantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935698