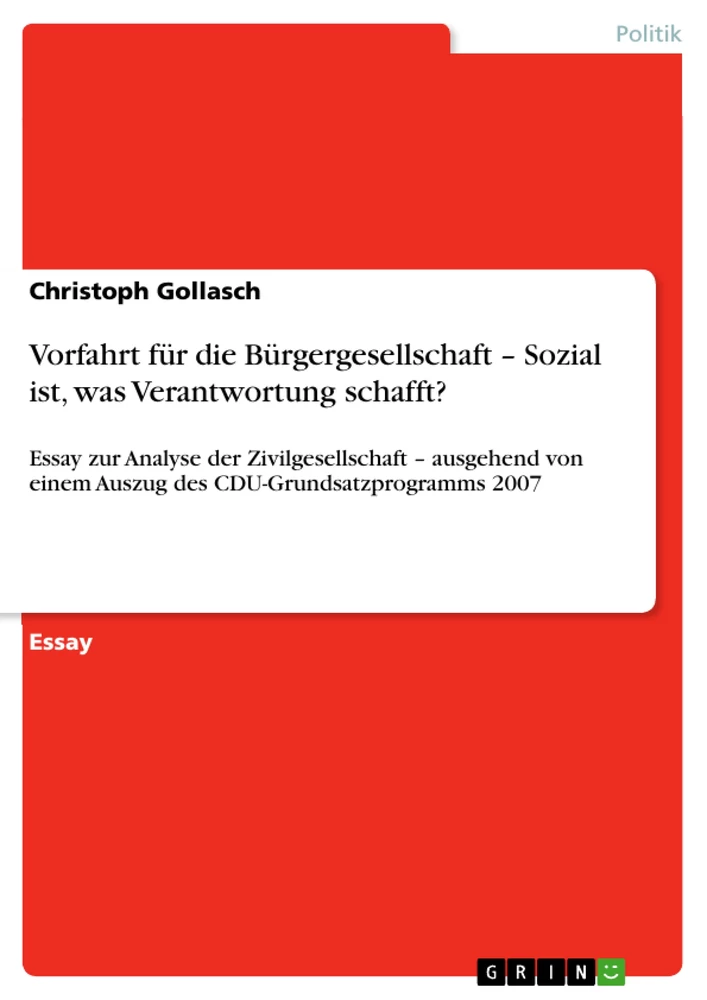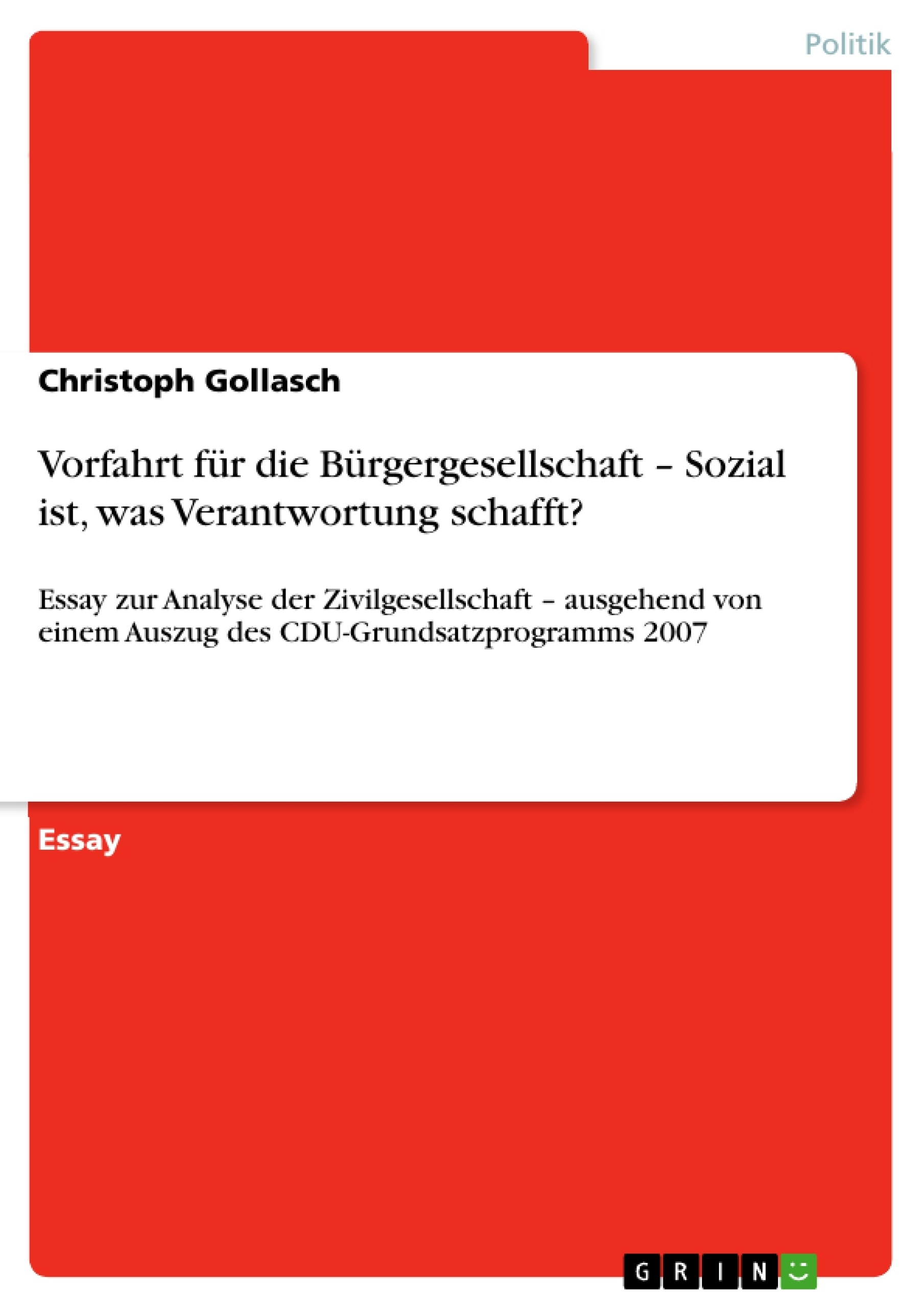Obgleich ein nicht unerheblicher Teil der Bürgerschaft die zivile Gesellschaft, und somit kollektiv sich selbst, wohl als in gleichem Maße unabhängige wie potente Kraft im Staate neben Politik und Wirtschaft versteht, gleicht diese Vorstellung von Demokratie einem Anachronismus. Längst hat sich eine hybride Gemengelage verschiedenster Interessen, Machtkonstellationen und Menschenführungstechniken generiert, in der Grenzen porös, staatliche, wirtschaftliche sowie zivile Aspirationen undifferenzierbar werden.
Unterm Kochdeckel der Globalisierung erwärmt sich nicht nur Mutter Erde, auch der zunehmende, traditional-familiäre Gesellschaftsbande zerstörende Individualismus erhitzt – befeuert durch einen beinahe unbegrenzten Pluralismus an Lebensmöglichkeiten – die Gemüter der politischen Elite Deutschlands. Soziale Sicherungssysteme verurteilt der demographische Wandel zum Scheitern. Der Umbau des Sozialstaats erscheint als unabwendbare Notwendigkeit, was dann Protest schafft, wenn der individuelle Wohlstand sinkt: „Wo die Sozialkassen in Schwierigkeiten geraten, soll das freiwillige soziale Engagement helfen.“ Doch ist die Intention zur, als Erfordernisses propagierten, Ausweitung einer selbstständigen Bürgergesellschaft nur jener ökonomischen Dimension geschuldet? Oder korrelieren nicht vielmehr Komponenten wie Politisierung, Identitätsstiftung oder Wertevermittlung als wichtige Bestandteile einer funktionierenden Zivilgesellschaft?
Ziel des Essays ist es folglich – vor dem Hintergrund der chronologischen Genese und Wandlung der ‚Zivilgesellschaft’ – oben stehenden Auszug aus dem CDU-Grundsatzprogramm kritisch zu analysieren, widersinnige Ambiguität zu eruieren und den Fokus schließlich auf neue Formen der modernen Menschenführung zu richten, welche sich des Potenzials der zivilgesellschaftlichen Komponenten bedient. Die auf den ersten Blick augenscheinliche Paradoxie der Förderung bzw. Forderung eines Milieus, welches eine derart gewaltige – man erinnere sich der polnischen Gewerkschaft Solidarność; generell der nach Freiheit strebenden BürgerInnen des ehemaligen Ostblocks – oppositionelle Kraft in sich birgt, wird sich somit relativieren. Und generell gilt es zu hinterfragen: „Immer dann, wenn Begriffe der politischen Philosophie [Anm.: Zivilgesellschaft] in den wohlfeilen Gebrauch der Alltagssprache übergehen, ist Vorsicht geboten. (…) Der umworbene Begriff droht, seine inhaltliche Substanz zu verlieren.“
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. VON DER MYKENISCHEN ZUR MITTELALTERLICHEN ZIVILGESELLSCHAFT
- 2. ZIVILGESELLSCHAFT ALS KIND DES POLITPHILOSO-PHISCHEN DISKURSES
- 3. ZIVILGESELLSCHAFT ZWISCHEN LIBERALISMUS UND HEGEMONIE
- 4. ZIVILGESELLSCHAFT ALS WOHLFEILES INSTRUMENT DER MODERNEN POLITIK
- 5. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Analyse der Zivilgesellschaft im Kontext des modernen deutschen Staatsverständnisses. Der Fokus liegt dabei auf der kritischen Auseinandersetzung mit einem Auszug aus dem CDU-Grundsatzprogramm von 2007, in dem die Stärkung der Bürgergesellschaft und die Förderung von Eigeninitiative betont werden. Das Ziel ist es, die Ambiguität dieses Konzepts zu beleuchten und neue Formen der modernen Menschenführung zu erforschen, die sich des Potenzials der zivilgesellschaftlichen Komponenten bedienen.
- Die historische Entwicklung der Zivilgesellschaft von der Antike bis zur Moderne
- Der Einfluss der politischen Philosophie auf das Verständnis der Zivilgesellschaft
- Die Ambivalenz des Zivilgesellschaft-Konzepts im Kontext von Liberalismus und Hegemonie
- Die Instrumentalisierung der Zivilgesellschaft durch die moderne Politik
- Neue Formen der Menschenführung, die das Potenzial der zivilgesellschaftlichen Komponenten nutzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel betrachtet die historische Entwicklung der Zivilgesellschaft, beginnend mit der antiken Polis und dem Aufstieg der politischen Kommunikation. Der Fokus liegt auf der Rolle der Sklaven und Frauen im politischen Leben sowie der Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Raum. Es wird argumentiert, dass es in der Antike keine Zivilgesellschaft im modernen Sinne gab.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der politischen Philosophie auf das Verständnis der Zivilgesellschaft. Es beleuchtet die Werke von Thomas Hobbes und John Locke und deren unterschiedliche Konzepte der politischen Macht und des Verhältnisses von Staat und Bürger.
Schlüsselwörter
Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, Eigeninitiative, politische Philosophie, Liberalismus, Hegemonie, Moderne, Menschenführung, Staat, Politik, Individuum, Grundsatzprogramm, CDU
- Quote paper
- Christoph Gollasch (Author), 2008, Vorfahrt für die Bürgergesellschaft – Sozial ist, was Verantwortung schafft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93571