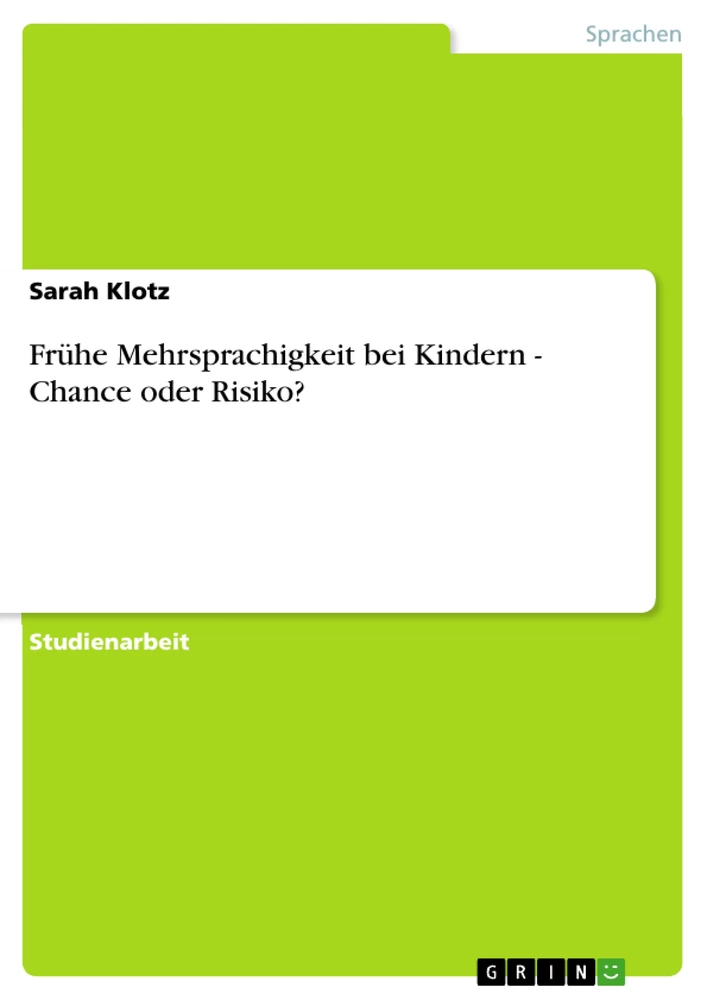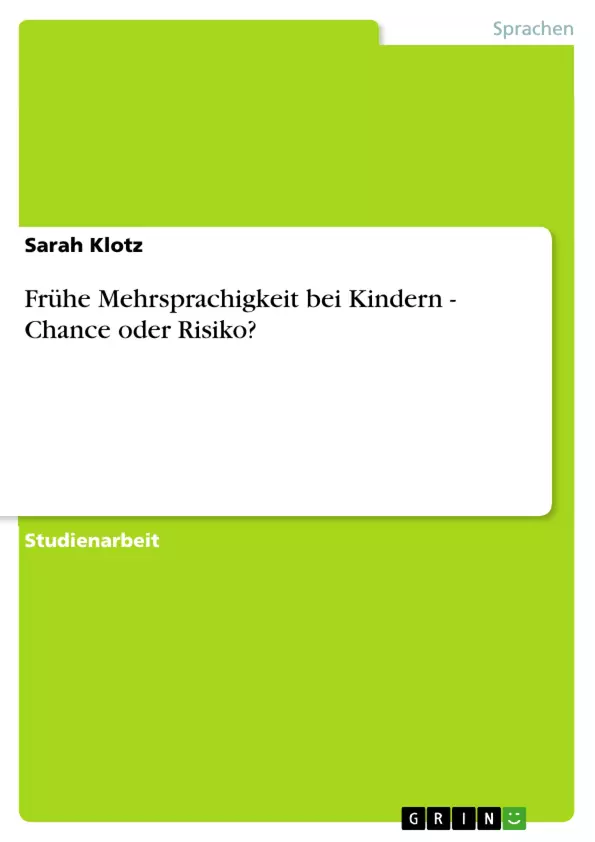In der vorliegenden Arbeit mit dem Titel „Frühe Mehrsprachigkeit bei Kindern – Chance oder Risiko“ sollen einleitend kurz die zwei Phasen des Spracherwerbs nach Oksaar dargestellt werden. Aufbauend auf die Definition von Mehrsprachigkeit wird dann eine Zusammenfassung von der Entwicklung Europas zur Einsprachigkeit sowie Ängsten, Befürchtungen und teilweise Vorurteilen bezüglich der frühen Mehrsprachigkeit zeigen, wie die Förderung dieser lange Zeit verhindert und unterdrückt wurde. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse belegen mittlerweile Gegenteiliges. Daran anschließend werden die verschiedenen Formen von Mehrsprachigkeit dargestellt und auch mögliche Schwierigkeiten und Probleme aufgezeigt. Mit internationalen Beispielen von Mehrsprachigkeitsförderung und einer Zusammenfassung schließt dann die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwei Phasen des Spracherwerbs
- Der Begriff Mehrsprachigkeit
- Die Entstehung und Verfechtung der Einsprachigkeit in Europa
- Die verschiedenen Formen und Eigenschaften von Mehrsprachigkeit
- Probleme und Schwierigkeiten der Mehrsprachigkeit
- Mehrsprachigkeit als Chance
- Beispiele der institutionellen Förderung von Mehrsprachigkeit
- Zusammenfassung
- Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Chancen und Risiken früher Mehrsprachigkeit bei Kindern. Sie analysiert die Entwicklung Europas zur Einsprachigkeit und beleuchtet die damit verbundenen Ängste, Befürchtungen und Vorurteile gegenüber der frühen Mehrsprachigkeit. Zudem werden die verschiedenen Formen von Mehrsprachigkeit dargestellt sowie mögliche Probleme und Schwierigkeiten beleuchtet. Abschließend werden Beispiele der institutionellen Förderung von Mehrsprachigkeit aufgezeigt.
- Die Entwicklung von der Mehrsprachigkeit zur Einsprachigkeit in Europa
- Die verschiedenen Formen und Eigenschaften von Mehrsprachigkeit
- Die Herausforderungen und Chancen früher Mehrsprachigkeit
- Die Bedeutung der Förderung von Mehrsprachigkeit
- Beispiele der institutionellen Mehrsprachigkeitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die beiden Phasen des Spracherwerbs nach Oksaar vor und definiert den Begriff Mehrsprachigkeit. Anschließend werden die Entwicklung Europas zur Einsprachigkeit sowie die damit verbundenen Ängste, Befürchtungen und Vorurteile gegenüber der frühen Mehrsprachigkeit beschrieben.
- Zwei Phasen des Spracherwerbs: Oksaar teilt den Spracherwerb in zwei Phasen ein: die sprachliche Ontogenese (bis vier Jahre) und die primäre Erweiterungsstufe (vier bis sechs/sieben Jahre). Während der ersten Phase festigen sich wichtige syntaktische Regeln, während in der zweiten Phase die Verwendung von lexikalischen und grammatikalischen Elementen verfeinert wird.
- Der Begriff Mehrsprachigkeit: Mehrsprachigkeit wird definiert als der Erwerb von zwei oder mehr sprachlichen Wissenssystemen, die es ermöglichen, mit monolingualen Sprechern in beiden Sprachen problemlos zu kommunizieren. Es wird zwischen individueller, territorialer und institutioneller Mehrsprachigkeit unterschieden.
- Die Entstehung und Verfechtung der Einsprachigkeit in Europa: Die Herausbildung von Nationalstaaten führte in Europa zur Verfestigung des Glaubens an die Einsprachigkeit als Normalität. Sprachen wurden zu Identitätsmerkmalen von Zugehörigkeit zu einem Staatswesen und Mehrsprachigkeit wurde mit Misstrauen und Vorurteilen begegnet.
- Die verschiedenen Formen und Eigenschaften von Mehrsprachigkeit: Es werden verschiedene Formen von Mehrsprachigkeit vorgestellt, wie beispielsweise simultaner und sukzessiver Spracherwerb. Die Arbeit beleuchtet auch die unterschiedlichen Kompetenzen, die Mehrsprachige in ihren verschiedenen Sprachen entwickeln können.
- Probleme und Schwierigkeiten der Mehrsprachigkeit: Die Arbeit thematisiert mögliche Probleme und Schwierigkeiten, die mit Mehrsprachigkeit einhergehen können, wie beispielsweise Sprachverwirrung, Sprachdefizite und die Herausforderung, in allen Sprachen gleichermaßen kompetent zu sein.
- Mehrsprachigkeit als Chance: Die Arbeit zeigt die Chancen, die Mehrsprachigkeit bietet, wie beispielsweise die Erweiterung kognitiver Fähigkeiten, die Förderung von Toleranz und interkulturellem Verständnis sowie die Verbesserung der beruflichen Chancen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Mehrsprachigkeit, Einsprachigkeit, Spracherwerb, Sprachentwicklung, frühe Mehrsprachigkeit, kognitive Entwicklung, Sprachförderung, institutionelle Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Ist frühe Mehrsprachigkeit eine Chance oder ein Risiko für Kinder?
Die Arbeit zeigt, dass Mehrsprachigkeit heute überwiegend als Chance gesehen wird, da sie kognitive Fähigkeiten, Toleranz und berufliche Möglichkeiten fördert, auch wenn früher oft Ängste vor Überforderung dominierten.
Was sind die Phasen des Spracherwerbs nach Oksaar?
Oksaar unterscheidet die sprachliche Ontogenese (bis ca. 4 Jahre), in der syntaktische Regeln gelernt werden, und die primäre Erweiterungsstufe (4 bis ca. 7 Jahre), in der Grammatik und Wortschatz verfeinert werden.
Warum herrscht in Europa oft der Glaube an die Einsprachigkeit vor?
Dies ist historisch bedingt durch die Entstehung von Nationalstaaten, in denen eine gemeinsame Sprache als zentrales Identitätsmerkmal und Zeichen staatlicher Zugehörigkeit galt.
Welche Probleme können bei mehrsprachiger Erziehung auftreten?
Mögliche Schwierigkeiten sind vorübergehende Sprachverwirrung, Sprachdefizite in einer der Sprachen oder die Herausforderung, in allen Systemen die gleiche Kompetenz zu erreichen.
Was ist der Unterschied zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb?
Simultaner Erwerb bedeutet, dass ein Kind zwei Sprachen gleichzeitig von Geburt an lernt. Sukzessiver Erwerb liegt vor, wenn die zweite Sprache zeitlich versetzt zur ersten gelernt wird.
Wie kann Mehrsprachigkeit institutionell gefördert werden?
Durch bilinguale Kindergärten, Schulen und spezifische Programme zur Sprachförderung, die die natürliche Neugier und Lernfähigkeit von Kindern nutzen.
- Quote paper
- Sarah Klotz (Author), 2008, Frühe Mehrsprachigkeit bei Kindern - Chance oder Risiko? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93610