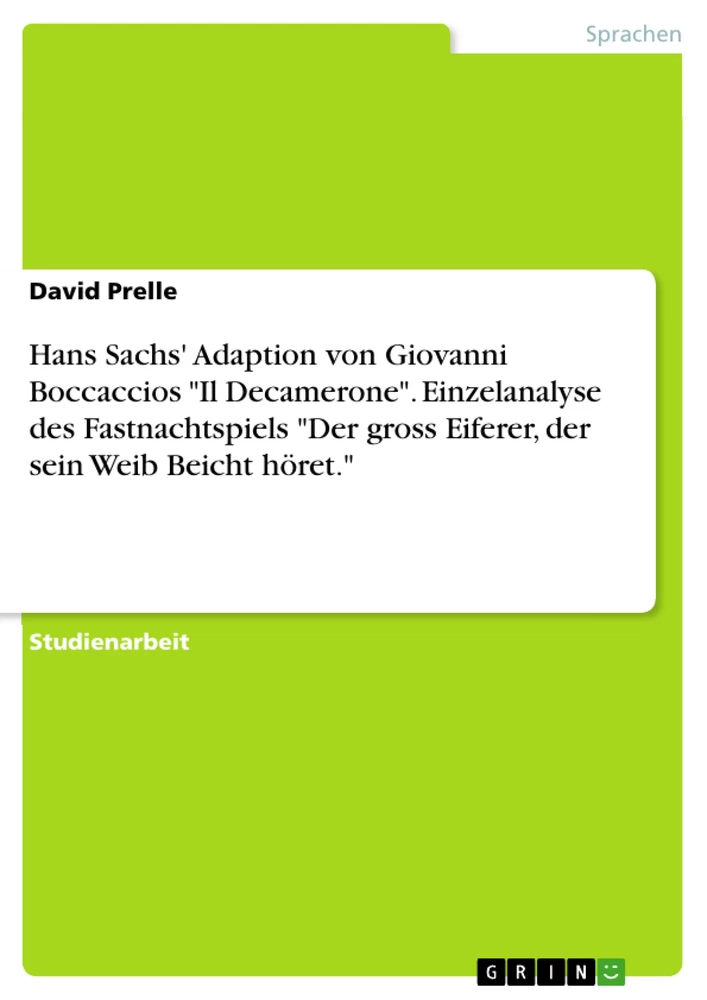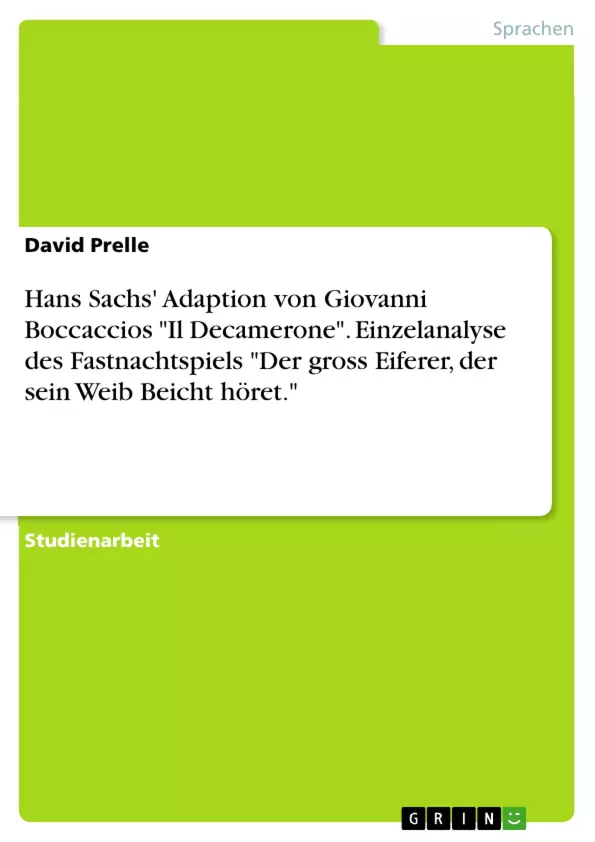Diese Arbeit analysiert die Adaption von Boccaccios fünfter Novelle des siebten Tages in Hans Sachs' "Der Eifersüchtige". Konkret soll die Frage beantwortet werden, wie die Adaption gelingt und was man durch diese über Sachs' Arbeitsprozess, seine Person und seine Moralvorstellungen erfahren kann. Diese Analyse ist von besonderem Interesse, da Sachs und seinen Inspirator nicht nur Ländergrenzen, sondern beinahe zwei Jahrhunderte trennen. Boccaccio schreibt Prosa und prägt die Novelle, während Sachs in Reimform schreibt und sowohl Dramen wie auch Lieder verfasst.
Die Unterschiede zwischen den beiden Schriftstellern sind groß. Was könnte unvereinbarer sein als der "Decamerone" und Hans Sachs' Moralvorstellung? Dennoch sind die beiden durch Sachs' Adaption miteinander verbunden. Auf welche Weise wirken sich diese Unterschiede jedoch auf die Adaption aus? Wie gelingt der Genrewechsel? Diesen Fragen sollen nach einem allgemeinen Überblick über das Verhältnis von Sachs und Boccaccio beispielhaft an einer bestimmten Novelle nachgegangen werden, indem der Adaptionsprozess dargestellt wird.
Das "Dekameron" von Giovanni Boccaccio inspirierte namhafte literarische Größen in ganz Europa: Shakespeare, Chaucer, Rabelais; in Deutschland allein unter anderem Goethe, Lessing und den Meistersänger Hans Sachs. Dabei ist die Relevanz von Boccaccio für Hans Sachs und seine Dichtung nicht zu unterschätzen. Kein anderer deutschsprachiger Autor hat sich in diesem Umfang an Boccaccios Werk auf Grundlage der deutschen Übersetzung abgearbeitet.
Seit 1894 wurde immer wieder die Verbindung zwischen Sachs und Boccaccio, sowie die Einflüsse von zweiterem auf ersteren und seine Werke untersucht, nachgeforscht, wie Sachs den Stoff bearbeitete und wo sich etwa Bearbeitungsdifferenzen zwischen verschiedenen Gattungen auftun. Grundsätzlich ist der Fokus der Untersuchungen aber meist allgemeinerer Natur. Diese Arbeit nimmt es sich deswegen zur Aufgabe, eine Einzelanalyse zu leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Adaptionen des Dekameron durch Hans Sachs
- Realisierung der Adaption
- Transformation
- Kondensation
- Selektion
- Deviation
- Assimilation
- Interpretation
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie Hans Sachs die Novellen Giovanni Boccaccios adaptiert. Dabei werden die Unterschiede zwischen den beiden Autoren, ihre unterschiedlichen literarischen Kontexte und die Besonderheiten der Adaptionsprozesse analysiert.
- Das Verhältnis von Sachs und Boccaccio
- Die Adaptionsstrategien Sachs' in Bezug auf Sprache, Form und Inhalt
- Die Relevanz von Boccaccios Dekameron für die deutsche Literatur
- Die Veränderungen, die Sachs an Boccaccios Novellen vornimmt
- Der Einfluss des Dekameron auf Sachs' Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Dekameron als Ursprungswerk der Novelle vor und beleuchtet den Einfluss von Boccaccios Werk auf namhafte Autoren in ganz Europa, darunter auch Hans Sachs.
- Das Kapitel "Adaptionen des Dekameron durch Hans Sachs" beleuchtet die herausragende Bedeutung Boccaccios für Sachs' Schaffen und zeigt die Vielzahl von Adaptionen auf, die Sachs von Boccaccios Werk geschaffen hat.
- Das Kapitel "Realisierung der Adaption" geht detailliert auf die Adaptionsstrategien Sachs' ein und analysiert die Prozesse der Transformation, Kondensation, Selektion, Deviation, Assimilation und Interpretation, die Sachs bei seinen Adaptionen anwendet.
Schlüsselwörter
Hans Sachs, Giovanni Boccaccio, Dekameron, Adaption, Novelle, Fastnachtspiel, Dramen, Meistergesang, Spruchgedicht, deutsche Literatur, Renaissance, Reformation, Moral, Genre
Häufig gestellte Fragen
Wie adaptierte Hans Sachs Boccaccios „Dekameron“?
Sachs transformierte die Prosa-Novellen Boccaccios in Reimform, insbesondere in Fastnachtspiele und Meisterlieder, wobei er die Stoffe an seine eigenen Moralvorstellungen anpasste.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Sachs und Boccaccio?
Boccaccio schrieb im 14. Jahrhundert italienische Prosa mit einem oft freizügigen Weltbild, während Sachs im 16. Jahrhundert als Meistersänger agierte und lutherische Moralvorstellungen vertrat.
Welche Strategien nutzte Sachs bei der Adaption?
Er nutzte Techniken wie Kondensation (Kürzung), Selektion (Auswahl von Szenen), Deviation (Abweichung vom Original) und Assimilation (Anpassung an das deutsche Milieu).
Warum ist Boccaccio für die deutsche Literatur relevant?
Das „Dekameron“ inspirierte zahlreiche deutsche Autoren wie Goethe, Lessing und Sachs und prägte die Entwicklung der Novelle als literarische Gattung in Europa.
Was erfährt man durch die Analyse über Hans Sachs' Arbeitsprozess?
Die Einzelanalyse zeigt, wie Sachs fremde Stoffe didaktisch umdeutete, um seinem Publikum moralische Lehren in unterhaltsamer Form zu vermitteln.
- Quote paper
- David Prelle (Author), 2020, Hans Sachs' Adaption von Giovanni Boccaccios "Il Decamerone". Einzelanalyse des Fastnachtspiels "Der gross Eiferer, der sein Weib Beicht höret.", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936374