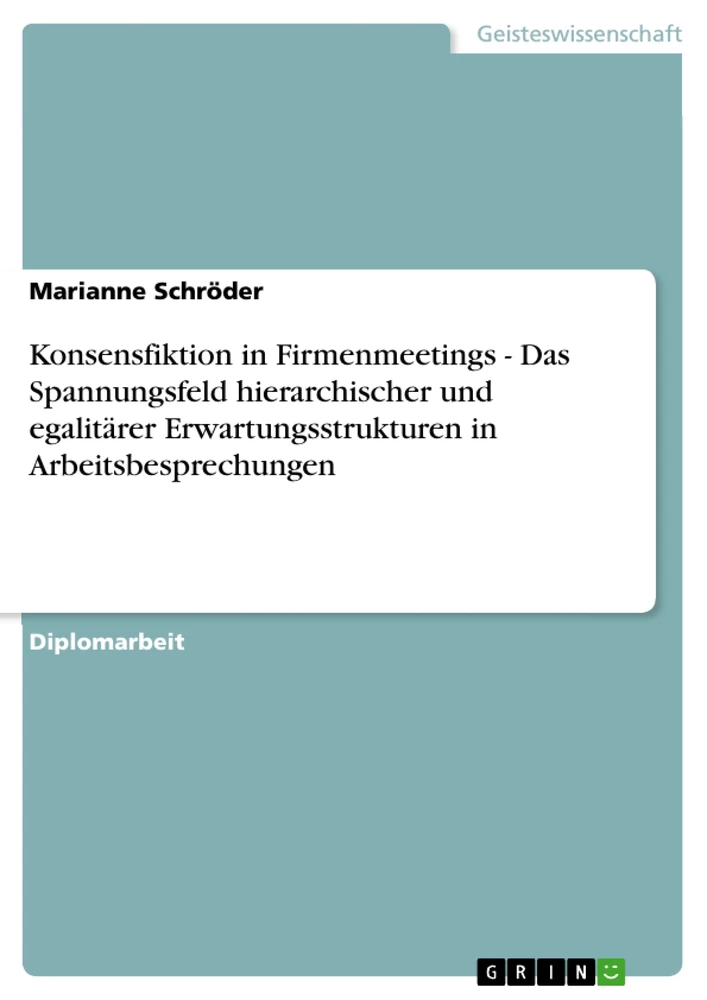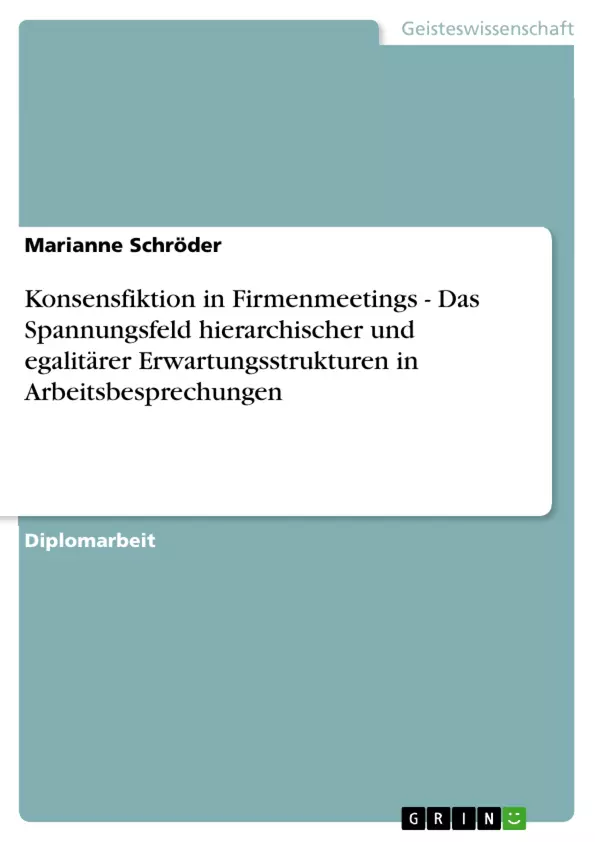Glaubt man Ratgeberbüchern über Meetings oder Sitzungsteilnehmern selbst, so sollen Besprechungen in erster Linie dazu dienen, Informationen über die eigenen Tätigkeiten und die der anderen auszutauschen, konstruktive Lösungen für aktuelle Arbeitsprobleme zu finden und gemeinsam zu besseren Entscheidungen zu kommen. Allerdings scheinen Besprechungen solchen Erwartungen nicht unbedingt gerecht zu werden. Viele Konferenzteilnehmer sehen die meisten Meetings inzwischen als reine Zeitverschwendung an. Trotz aller Klagen scheinen Meetings in Firmen nicht eben selten einberufen zu werden. Die Frage, warum dennoch so viele Meetings stattfinden, obwohl von allen Seiten fast ausschließlich der Nutzen solcher Treffen angezweifelt wird, scheint noch gar nicht bzw. noch nicht ausreichend beantwortet zu sein. Eine Erklärung, warum Meetings für Organisationen dennoch nützlich sein können, hat sich der vorliegende Text zur Aufgabe gemacht.
Besonders wichtig bei dieser theoretischen Analyse ist es, die Unterscheidung von Organisation und Interaktion stets im Auge zu behalten: Das Meeting verläuft als Interaktion nach eigenen Gesetzmäßigkeiten. Organisationsprogramme können deshalb nicht eins zu eins in der Besprechungsinteraktion umgesetzt werden. Meetingidealisten, wie zum Beispiel Autoren von Ratgeberbüchern, beklagen genau diesen Umstand: Anstatt sich in Besprechungen schlicht auf die Umsetzung von Zielen oder Problemlösungen zu konzentrieren, wimmle es von Selbstdarstellern, die im Meeting nichts anderes zu tun hätten als sich zu profilieren; es würde ständig vom Thema abgedriftet, um sich mit unwichtigen Kleinigkeiten oder auch Kleinlichkeiten aufzuhalten, und häufig kämen die Teilnehmer einfach nicht auf den Punkt, den sie eigentlich behandeln wollten, sondern redeten ständig um den heißen Brei herum. Anstatt nun aber mit in diesen Kanon einzustimmen, behauptet der Text, dass die Interaktionsdynamik eines Meetings, welches scheinbar nur Zeit und Geld verschlingt, sehr wohl eine nützliche Funktion für die Organisation hat: Durch die Eigengesetzmäßigkeit der Meetinginteraktion kann eine Konsensfiktion unter den rangungleichen Organisationsmitgliedern hergestellt werden. Die Darstellung von im Meeting konsensuell getroffenen Beschlüssen kommt den Anforderungen einer zunehmend wichtiger werdenden Egalitätsnorm in Organisationen entgegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hinführung zum Thema
- 1.1 Wozu Meetings?
- 1.2 Definition der Konsensfiktion
- 1.3 Hierarchie versus Egalität
- 1.4 Zu den Kapiteln
- 2 Vorgehensweise
- 2.1 Verwendung von wissenschaftlicher Literatur und von „Ratgeberliteratur“
- 2.2 Die Methode der funktionalen Analyse
- 2.2.1 Unterscheidung latenter und manifester Funktionen
- 2.2.2 Unterscheidung instrumenteller und expressiver Orientierung
- 2.2.3 Unterscheidung direkter und indirekter Kommunikation
- 2.2.4 Unterscheidung formaler und informaler Rollen
- 3 Zum verwendeten Begriff „Meeting“ und zu seiner soziologischen Verortung
- 3.1 Einschränkung der Untersuchungseinheit
- 3.2 Soziologische Verortung
- 4 Erwartungsstrukturen im Meeting
- 4.1 Definition der Erwartungsstrukturen
- 4.2 Die Entstehung von Erwartungsstrukturen im Meeting
- 4.2.1 Der Einfluss vorangegangener Sitzungen
- 4.2.2 Der Einfluss der jeweiligen Interaktionsvergangenheit
- 4.3 Hierarchische Erwartungsstrukturen
- 4.3.1 Formaler Rang
- 4.3.2 Informaler Rang
- 4.4 Egalitäre Erwartungsstrukturen
- 4.4.1 „Organisationsrationalität“
- 4.4.2 Taktregeln
- 5 Konsensfiktion im Meeting: Detailanalyse
- 5.1 Konsensfiktion durch expressive Orientierung
- 5.1.1 Vorauswahl der Teilnehmer
- 5.1.2 Konfliktvermeidung
- 5.1.3 Nebenengagement
- 5.1.4 Eingeworfene Scherze
- 5.1.5 Bereitschaft sich zu beteiligen
- 5.2 Konsensfiktion durch indirekte Kommunikation
- 5.2.1 Indirekt ausschließende Kommunikation
- 5.2.1.1 Kompetenz
- 5.2.1.2 Gemeinsamer Code
- 5.2.2 Ehrerbietungsrituale
- 5.2.3 Körpersprache
- 5.3 Konsensfiktion durch Inanspruchnahme formaler und informaler Rollen
- 5.3.1 Informale Vorabsprachen
- 5.3.1.1 Vorabsprache in Wartezeiten
- 5.3.1.2 Vorabsprache durch Netzwerke
- 5.3.2 Vorstrukturierte Themengeschichte
- 5.3.2.1 Themengeschichte mit Tagesordnung
- 5.3.2.2 Themengeschichte ohne Tagesordnung
- 6 Diskurs versus Diskussion
- 7 Die ungleichen Chancen der Beteiligten
- 8 Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Funktion von Firmenmeetings, insbesondere die Herstellung einer Konsensfiktion trotz hierarchischer Strukturen. Er analysiert, wie scheinbar ineffiziente Meetings dennoch eine nützliche Funktion für die Organisation erfüllen können.
- Die soziologische Verortung von Meetings und deren Funktion in Organisationen
- Die Analyse von hierarchischen und egalitären Erwartungsstrukturen in Meetings
- Die detaillierte Untersuchung der Mechanismen der Konsensfiktion
- Der Unterschied zwischen Diskurs und Diskussion im Kontext von Meetings
- Die ungleichen Chancen der Beteiligten in Meetings
Zusammenfassung der Kapitel
1 Hinführung zum Thema: Der einführende Abschnitt beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem idealisierten Bild von Meetings als effiziente Informations- und Entscheidungsfindungsforen und der weitverbreiteten Wahrnehmung als Zeitverschwendung. Er stellt die Forschungsfrage nach der organisationalen Nützlichkeit von Meetings, trotz ihres oft kritisierten Ineffizienzen, in den Mittelpunkt und hebt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Organisation und Interaktion hervor. Die These des Textes ist, dass die Interaktionsdynamik in Meetings zur Herstellung einer Konsensfiktion beiträgt, die den Anforderungen einer zunehmend egalitären Organisationsnorm entspricht, unabhängig davon, ob der Konsens tatsächlich besteht.
2 Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Untersuchung. Es erläutert die Verwendung von wissenschaftlicher und Ratgeberliteratur, sowie die Anwendung der funktionalen Analyse. Die funktionale Analyse wird detailliert aufgeschlüsselt, indem die Unterscheidung zwischen latenten und manifesten Funktionen, instrumenteller und expressiver Orientierung, direkter und indirekter Kommunikation sowie formaler und informaler Rollen erklärt werden. Diese methodischen Grundlagen bilden die Basis für die nachfolgende Analyse der Meetings.
3 Zum verwendeten Begriff „Meeting“ und zu seiner soziologischen Verortung: Dieses Kapitel präzisiert den Begriff „Meeting“ im Kontext der Untersuchung und verortet ihn soziologisch. Es definiert die Grenzen der Untersuchung und beleuchtet die soziologischen Aspekte von Meetings als Interaktionsformen innerhalb von Organisationen. Dieser Abschnitt legt den theoretischen Rahmen für das Verständnis von Meetings als soziale Praktiken fest, die über die reine Umsetzung von Organisationsprogrammen hinausgehen.
4 Erwartungsstrukturen im Meeting: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erwartungsstrukturen, die in Meetings herrschen. Es definiert den Begriff „Erwartungsstruktur“ und untersucht deren Entstehung durch den Einfluss vorangegangener Sitzungen und der Interaktionsvergangenheit der Teilnehmer. Es differenziert zwischen hierarchischen Erwartungsstrukturen, basierend auf formalem und informellem Rang, und egalitären Erwartungsstrukturen, die auf „Organisationsrationalität“ und Taktregeln beruhen. Diese unterschiedlichen Erwartungsstrukturen bilden den Kontext für die spätere Analyse der Konsensfiktion.
5 Konsensfiktion im Meeting: Detailanalyse: Das Kernstück der Arbeit analysiert verschiedene Mechanismen, die zur Konsensfiktion in Meetings beitragen. Es untersucht die Konsensfiktion durch expressive Orientierung (Konfliktvermeidung, Nebenengagement etc.), indirekte Kommunikation (ausschließende Kommunikation, Ehrerbietungsrituale, Körpersprache) und die Inanspruchnahme formaler und informaler Rollen. Dieser Abschnitt dekonstruiert die verschiedenen Strategien, die zur Herstellung des Eindrucks eines Konsenses beitragen, auch wenn dieser faktisch nicht existiert.
6 Diskurs versus Diskussion: Dieses Kapitel vergleicht die Konzepte „Diskurs“ und „Diskussion“ im Kontext der Meeting-Analyse. Es differenziert zwischen den beiden Begriffen, um den Charakter der Kommunikation in Meetings zu beleuchten und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Meinungsbildung und Konsensfindung zu untersuchen.
7 Die ungleichen Chancen der Beteiligten: Dieser Abschnitt befasst sich mit den ungleichen Chancen der Teilnehmer in Meetings, die durch die hierarchischen Strukturen und die Mechanismen der Konsensfiktion entstehen.
Schlüsselwörter
Konsensfiktion, Firmenmeetings, Hierarchie, Egalität, Erwartungsstrukturen, funktionale Analyse, Organisationsrationalität, indirekte Kommunikation, expressive Orientierung, formale und informelle Rollen, Diskurs, Diskussion, ungleiche Chancen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Firmenmeetings und Konsensfiktion
Was ist das Thema des Textes?
Der Text analysiert die Funktion von Firmenmeetings, insbesondere die Herstellung einer Konsensfiktion trotz hierarchischer Strukturen. Es untersucht, wie scheinbar ineffiziente Meetings dennoch eine nützliche Funktion für die Organisation erfüllen können.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Der Text untersucht die soziologische Verortung von Meetings, die Rolle hierarchischer und egalitärer Erwartungsstrukturen, die Mechanismen der Konsensfiktion, den Unterschied zwischen Diskurs und Diskussion im Kontext von Meetings und die ungleichen Chancen der Beteiligten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Untersuchung verwendet eine funktionale Analyse, die latente und manifeste Funktionen, instrumentelle und expressive Orientierungen, direkte und indirekte Kommunikation sowie formale und informelle Rollen unterscheidet. Es werden sowohl wissenschaftliche als auch Ratgeberliteratur herangezogen.
Wie wird der Begriff „Meeting“ definiert und soziologisch verortet?
Der Text präzisiert den Begriff „Meeting“ im Kontext der Untersuchung und verortet ihn soziologisch als Interaktionsform innerhalb von Organisationen. Meetings werden als soziale Praktiken verstanden, die über die reine Umsetzung von Organisationsprogrammen hinausgehen.
Welche Rolle spielen Erwartungsstrukturen in Meetings?
Der Text analysiert hierarchische Erwartungsstrukturen (basierend auf formalem und informellem Rang) und egalitäre Erwartungsstrukturen (basierend auf „Organisationsrationalität“ und Taktregeln). Diese beeinflussen die Interaktion und die Herstellung von Konsens.
Wie funktioniert die Konsensfiktion in Meetings?
Die detaillierte Analyse untersucht die Konsensfiktion durch expressive Orientierung (Konfliktvermeidung, Nebenengagement etc.), indirekte Kommunikation (ausschließende Kommunikation, Ehrerbietungsrituale, Körpersprache) und die Inanspruchnahme formaler und informaler Rollen (Vorabsprachen, vorstrukturierte Themengeschichte).
Was ist der Unterschied zwischen Diskurs und Diskussion im Kontext von Meetings?
Der Text vergleicht die Konzepte „Diskurs“ und „Diskussion“, um den Charakter der Kommunikation in Meetings zu beleuchten und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Meinungsbildung und Konsensfindung zu untersuchen.
Welche ungleichen Chancen haben die Beteiligten in Meetings?
Der Text beleuchtet die ungleichen Chancen der Teilnehmer, die durch hierarchische Strukturen und die Mechanismen der Konsensfiktion entstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Konsensfiktion, Firmenmeetings, Hierarchie, Egalität, Erwartungsstrukturen, funktionale Analyse, Organisationsrationalität, indirekte Kommunikation, expressive Orientierung, formale und informelle Rollen, Diskurs, Diskussion, ungleiche Chancen.
Welche Kapitel beinhaltet der Text?
Der Text umfasst Kapitel zur Hinführung zum Thema, zur Vorgehensweise, zum verwendeten Begriff „Meeting“ und seiner soziologischen Verortung, zu Erwartungsstrukturen im Meeting, zur detaillierten Analyse der Konsensfiktion, zum Vergleich von Diskurs und Diskussion, zu den ungleichen Chancen der Beteiligten und Schlussgedanken. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Marianne Schröder (Autor:in), 2004, Konsensfiktion in Firmenmeetings - Das Spannungsfeld hierarchischer und egalitärer Erwartungsstrukturen in Arbeitsbesprechungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93647