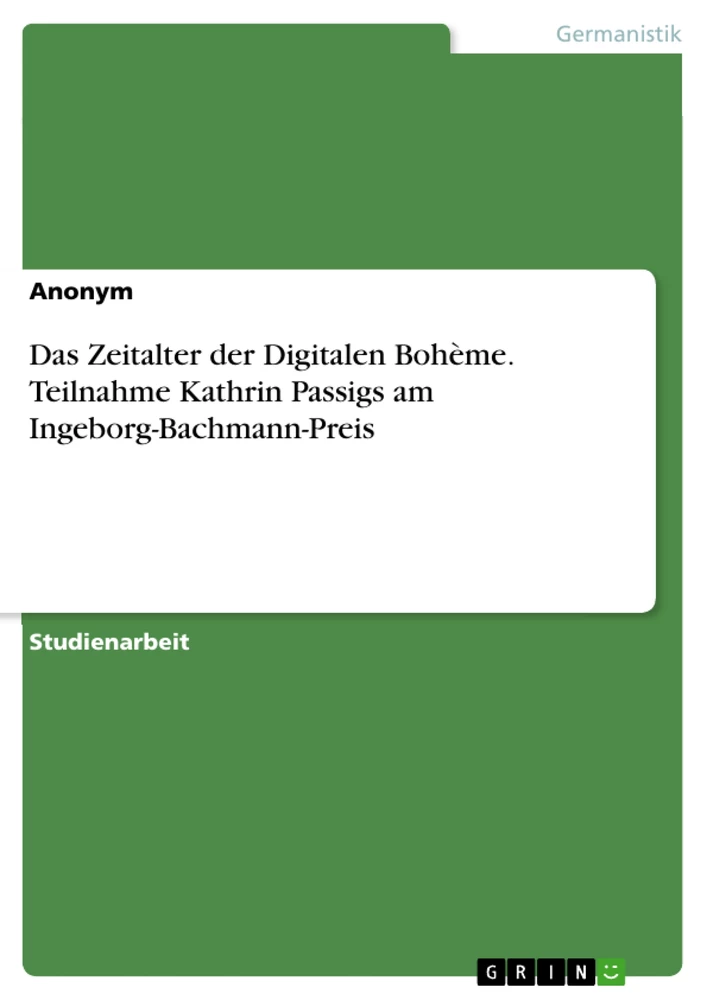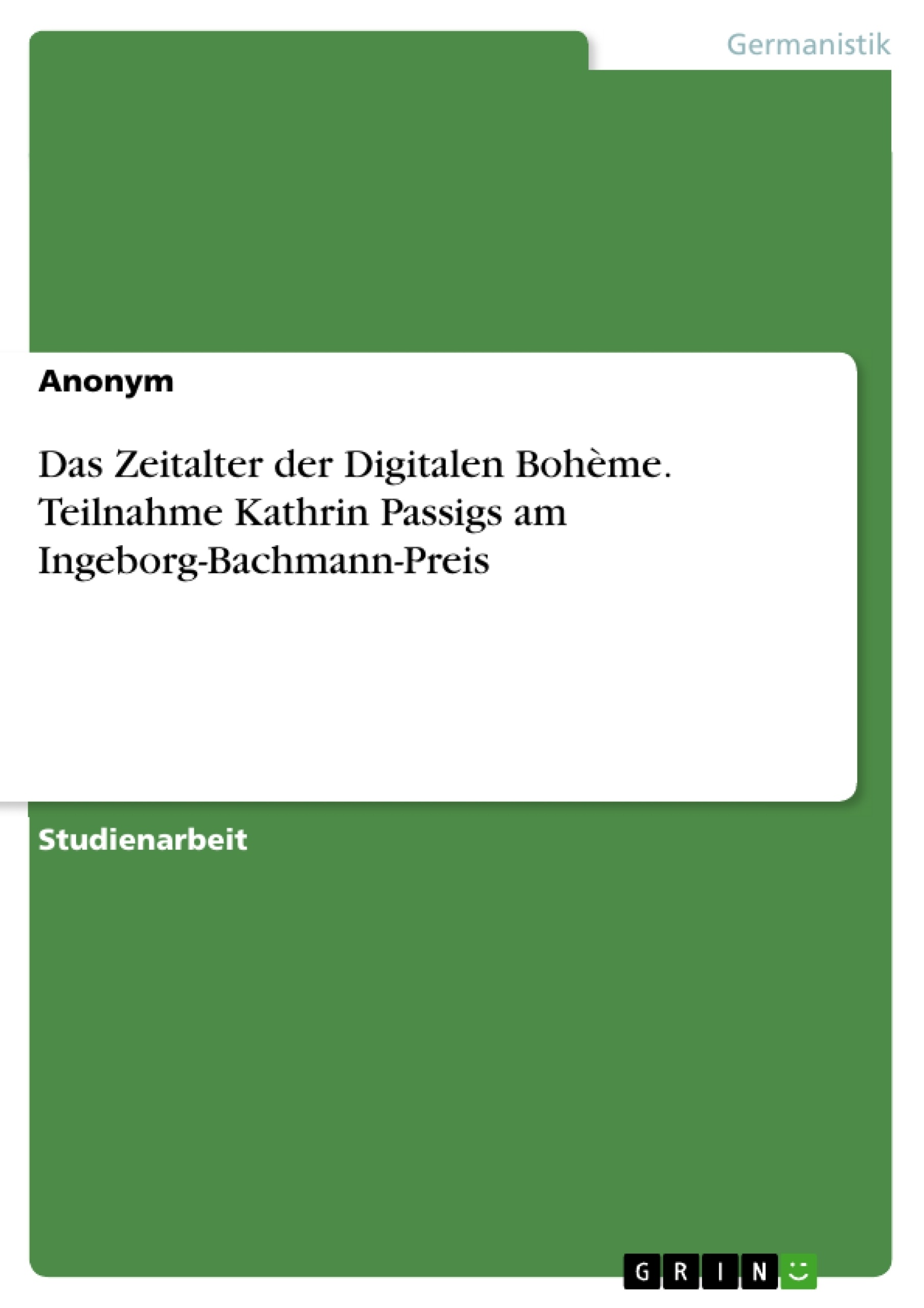Diese Arbeit beschäftigt sich mit Kathrin Passigs 'Skandal' beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2006 und welche Folge dieser für den Literaturbetrieb hatte. Insbesondere soll die Frage beantwortet werden, inwieweit es ihr und ihren Kollegen gelang, den Literaturbetrieb zu unterwandern und welche Auswirkungen diese Unterwanderung mit sich brachte.
Zunächst wird hierfür der Begriff des Literaturpreises definiert. Daraufhin wird es einen groben Überblick zu seinem geschichtlichen Hintergrund geben. Danach folgt eine Veranschaulichung der verschiedenen Funktionen, die ein Literaturpreis je nach Anspruchsgruppe zu erfüllen hat. Kapitel drei befasst sich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Im Mittelpunkt wird dabei sein Werdegang stehen; sein heutiges Bild und kritische Stimmen werden ebenfalls beleuchtet.
Das letzte Kapitel bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit. Es wird sich rund um Kathrin Passigs Teilnahme am Bachmann-Preis drehen. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf ihrem Internetauftritt sowie der ihrer Kollegen. Die Digitale Bohème macht sich wie es scheint einen Literaturpreis zu eigen. Wie das von statten geht, wer sich hinter der Digitalen Bohème verbirgt und welche Chancen und Risiken das für den Literaturbetrieb und speziell für den Bachmann-Preis bedeuten, soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden.
Seit nun mehr als über 2500 Jahre dauert die Geschichte der Literaturpreise an. Angefangen in der Antike über Renaissance und Barock, bis hin zur Moderne haben sie die Wahrnehmung von Literatur nachhaltig geprägt und prägen sie noch heute. Dort wird Literatur produziert, kritisch analysiert, aber vor allen Dingen wird ihr Aufmerksamkeit geschenkt. Wer einen Literaturpreis gewinnt, gewinnt nicht nur Geld, sondern auch die Aufmerksamkeit des Feuilletons, die von autorensuchenden Verlagen und die der Gesellschaft.
Besondere Aufmerksamkeit zu generieren, das gelang Kathrin Passig 2006 beim Ingeborg- Bachmann-Preis. Zusammen mit Kollegen kreierte sie einen ‚Skandal‘, sodass die Medien noch zehn Jahre später über sie berichten. Das hatten bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige geschafft, zuvor Rainald Goetz mithilfe einer Rasierklinge. Passigs Waffen waren jedoch anderer Natur. Mit Spaß, Ironie, einem handwerklich einwandfreien Text und ihren Kollegen, die scheinbar dasselbe Ziel hatten wie sie: den Literaturbetrieb unterwandern und bloßstellen, begegnete sie der literarischen Öffentlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturpreise
- Definition
- Geschichtlicher Hintergrund
- Funktionen
- Der Ingeborg-Bachmann-Preis
- Geschichtlicher Hintergrund
- Allgemeines
- Kritik
- Die Unterwanderung des Ingeborg-Bachmann-Preises
- Kathrin Passigs Teilnahme in Klagenfurt
- Das Webblog Riesenmaschine
- Die Zentrale Intelligenz Agentur
- Die Digitale Bohème
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Teilnahme von Kathrin Passig am Ingeborg-Bachmann-Preis 2006 und analysiert, inwieweit ihr und ihren Kollegen eine Unterwanderung des Literaturbetriebs gelungen ist. Die Arbeit untersucht die Funktion von Literaturpreisen im Allgemeinen und beleuchtet die Geschichte und den aktuellen Stand des Ingeborg-Bachmann-Preises.
- Die Bedeutung von Literaturpreisen im Literaturbetrieb
- Die Geschichte und Funktionsweise des Ingeborg-Bachmann-Preises
- Die Strategien und Ziele der Digitalen Bohème bei der Teilnahme am Bachmann-Preis
- Die Auswirkungen der Digitalen Bohème auf den Literaturbetrieb
- Die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Kontext von Literaturpreisen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Motivation und Zielsetzung. Sie skizziert die Rolle von Literaturpreisen in der heutigen Zeit und beleuchtet den Fall von Kathrin Passig beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2006.
- Kapitel 2 definiert den Begriff des Literaturpreises, beleuchtet seine historische Entwicklung und analysiert seine verschiedenen Funktionen für unterschiedliche Stakeholder.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Es schildert seine Geschichte, seinen heutigen Stellenwert und kritische Stimmen.
- Kapitel 4 fokussiert auf die Teilnahme von Kathrin Passig am Ingeborg-Bachmann-Preis. Es analysiert den Einfluss ihres Internetauftritts und den der Digitalen Bohème auf die Veranstaltung und den Literaturbetrieb im Allgemeinen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Literaturpreise, Ingeborg-Bachmann-Preis, Kathrin Passig, Digitale Bohème, Literaturbetrieb, Unterwanderung, Internet, Medien, Kritik, Chancen und Risiken der Digitalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Skandal“ um Kathrin Passig beim Bachmann-Preis 2006?
Kathrin Passig gewann den Preis mit einem Text, der im Kollektiv im Internet (Zentrale Intelligenz Agentur) entstanden war, was die traditionellen Vorstellungen von autorschaftlicher Genialität herausforderte.
Wer verbirgt sich hinter dem Begriff „Digitale Bohème“?
Der Begriff beschreibt eine Gruppe von Kreativen und Intellektuellen, die das Internet als primäre Plattform für ihre Arbeit, Vernetzung und Selbstvermarktung nutzen und oft prekär, aber unabhängig leben.
Welche Funktionen haben Literaturpreise heute?
Sie dienen der Kanonbildung, bieten finanzielle Unterstützung für Autoren und generieren Aufmerksamkeit im Feuilleton sowie auf dem Buchmarkt.
Was ist das Webblog „Riesenmaschine“?
Es ist ein Gemeinschaftsblog, das von Kathrin Passig und Kollegen gegründet wurde und als eines der einflussreichsten Projekte der frühen deutschsprachigen Blogosphäre gilt.
Wie veränderte die Digitalisierung den Ingeborg-Bachmann-Preis?
Die Teilnahme von Internet-Akteuren führte zu einer stärkeren Vernetzung mit der Online-Welt, einer Demokratisierung der Kritik und einer Hinterfragung des etablierten Literaturbetriebs.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Das Zeitalter der Digitalen Bohème. Teilnahme Kathrin Passigs am Ingeborg-Bachmann-Preis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936514