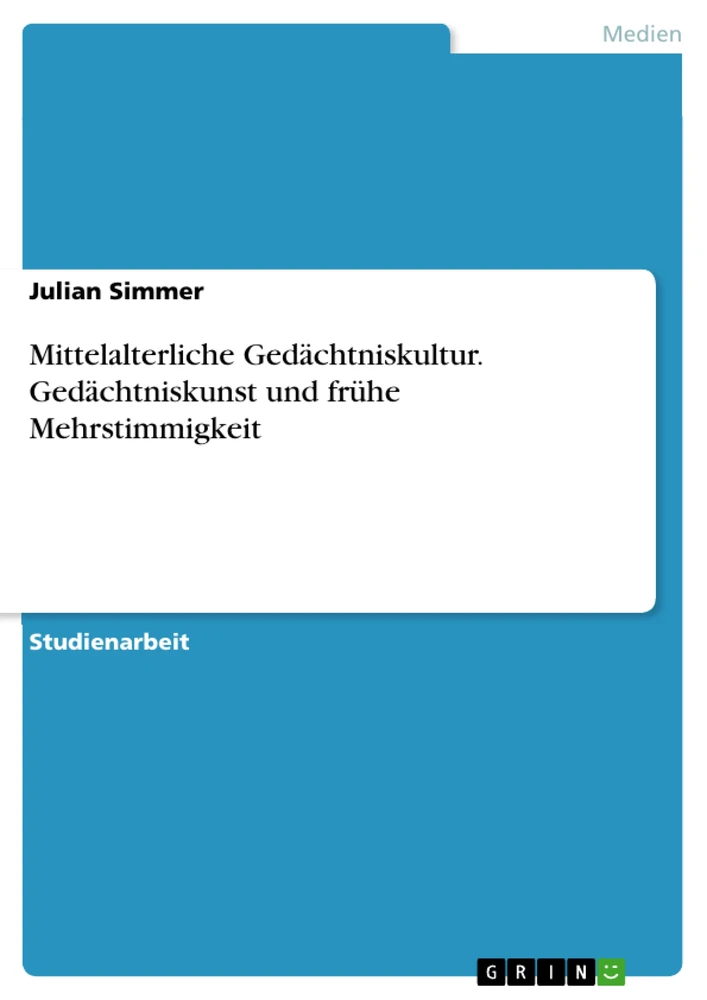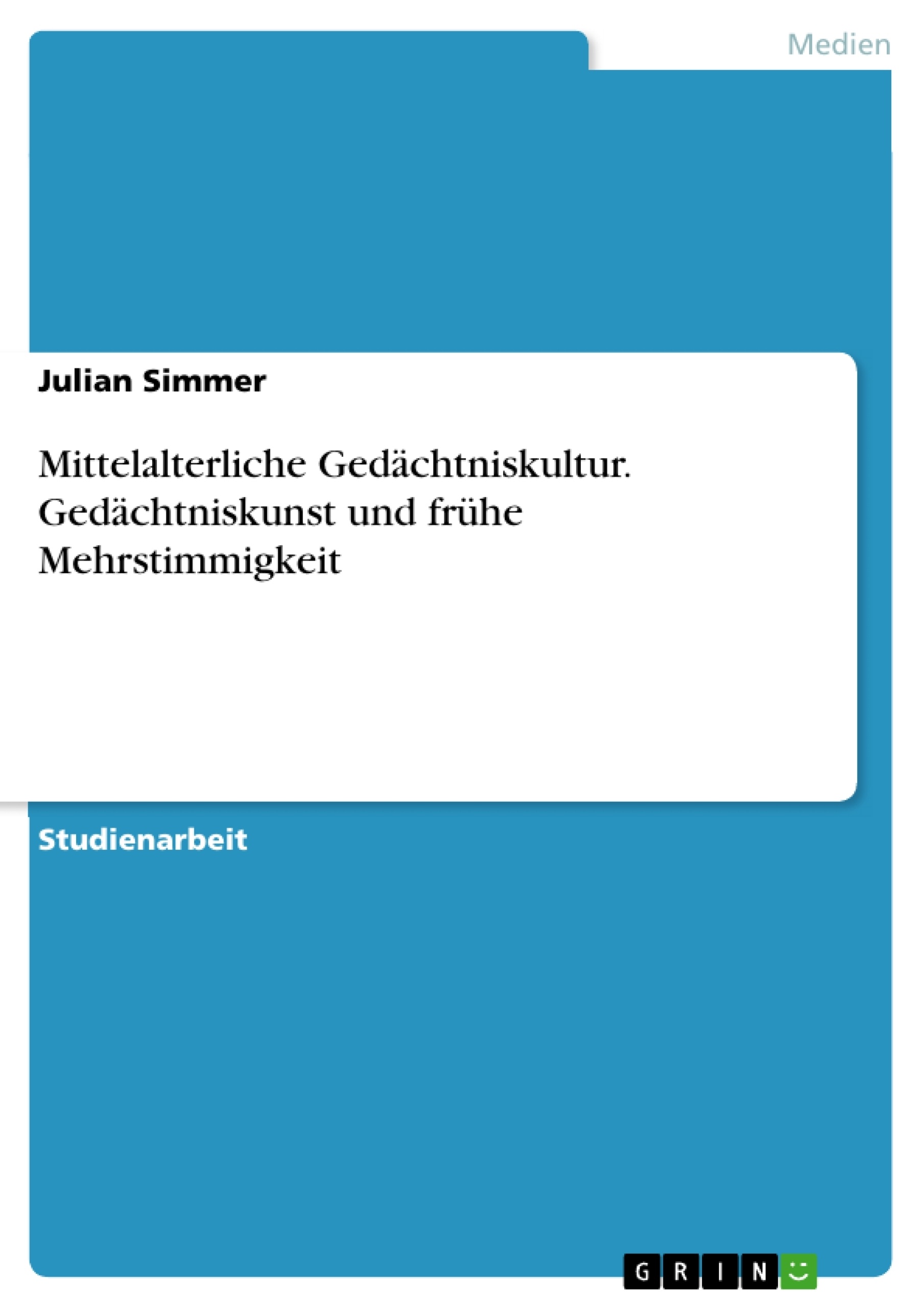In der folgenden Hausarbeit soll es um mittelalterliche Gedächtniskunst und -kultur gehen. Dazu werden verschiedene Quellen herangezogen, um eine Zusammenstellung an Fakten zu ermöglichen, die dem Leser dieser Arbeit einen Eindruck darüber verschaffen sollen, welche Rolle die Mündlichkeit im Gegensatz zur damals langsam aufkommenden Schriftlichkeit im Umfeld des choralen Gesang hatte. Das, was heute geschieht, woran geglaubt wird und an welche Regeln man sich zu halten hat, wird umfassend aufgezeichnet: Bild, Text und Film sind allgegenwärtig und stehen annähernd jedem und jeder zur Verfügung.
Im Mittelalter hingegen, als sich erst die Verschriftlichung verbreitete, war es für die Kulturen eine große Herausforderung, (religiöse) Geschichten sowie ethische und rechtliche Inhalte – individuell und kollektiv – zu bewahren und zu vermitteln. Diesem Zweck diente die so genannte „ars memorativa“, die Gedächtniskunst, die im 14. und 15. Jahrhundert zu einer der bemerkenswertesten Erscheinungen der spätmittelalterlichen Zivilisation wurde. Obwohl innerhalb der mnemonischen Tradition der Ursprung derselben schon lange feststand, versuchte die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts diesen bei Pythagoras oder in den ägyptischen Hieroglyphen zu suchen. Für die antike Geisteswelt hingegen galt seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. der Dichter Simonides (557-467 v. Chr.) weitgehend als der Erfinder der Mnemotechnik. Dieser jedoch erwähnt in keiner seiner Schriften jene Erfindung, die ihm zugeschrieben wird. Wie es zu dieser Erfindung kam erzählen Cicero und Quintilian, die jedoch interessanterweise der Urheberschaft des Simonides kritisch gegenüberstehen, in nur wenigen Details voneinander abweichend.
Eine große Hilfestellung waren mir bei dieser Arbeit die Texte von Anna-Maria Busse Berger. Sie hinterfragt alteingesessene Argumente und Theorien und stellt ihnen neu gewonnene Erkenntnisse gegenüber. So entsteht ein reflektiertes, wenn auch mit noch mehr Fragen als vorher gespicktes Bild, eines Alltags im Leben der klösterlichen Chorknaben zwischen Wort und Schrift.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gedächtniskunst und frühe Mehrstimmigkeit
- Die Rolle der Reimform in der Mnemotechnik
- Die Memorierung und ihre Bedeutung im Umgang mit Musik
- Die Memorierung und ihre Bedeutung im Umgang mit Musik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der mittelalterlichen Gedächtniskunst und -kultur und analysiert die Rolle der Mündlichkeit im Kontext des Chorals und der sich entwickelnden Schriftlichkeit. Ziel ist es, die Bedeutung der „ars memorativa“ für die Bewahrung und Vermittlung von Geschichten, ethischen und rechtlichen Inhalten im Mittelalter aufzuzeigen.
- Die Rolle der Gedächtniskunst in der mittelalterlichen Kultur
- Der Einfluss der Mündlichkeit auf die Komposition und Überlieferung von Musik
- Die Bedeutung der Reimform und des Modalrhythmus für die Memorierung
- Die Verbindung zwischen Gedächtniskunst und den technischen Neuerungen der Musiknotation
- Die Bedeutung der Memorierung für die Ausbildung von Musikern im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Gedächtniskunst, der „ars memorativa“, im Mittelalter und zeigt die Herausforderungen auf, die die Bewahrung von Wissen in einer Zeit vor weitverbreiteter Schriftlichkeit darstellte. Das zweite Kapitel untersucht die Rolle der Mündlichkeit in der Komposition und Überlieferung von Musik, insbesondere der frühen mehrstimmigen Musik. Dabei wird die Hypothese aufgestellt, dass die Mündlichkeit eine bedeutende Rolle in der Entstehung und Verbreitung dieser Musikform gespielt hat. Das dritte Kapitel widmet sich der Bedeutung der Reimform in der Gedächtniskunst und analysiert deren Einfluss auf die Entwicklung des Modalrhythmus. Die Verbindung zwischen der mnemonischen Tradition der didaktischen Poesie und den rhythmischen Schemata der Notre-Dame-Polyphonie wird untersucht. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Memorierung und ihrer Bedeutung für die Ausbildung von Musikern im Mittelalter. Anhand von Beispielen aus der Grammatik und der Arithmetik wird die Praxis der Memorierung im Kontext der musikalischen Ausbildung erläutert.
Schlüsselwörter
Gedächtniskultur, ars memorativa, Mnemotechnik, mittelalterliche Musik, Choralsingen, Mehrstimmigkeit, Modalrhythmus, Reimform, Memorierung, Musiknotation, Kontrapunkt, Musiktheorie, Ausbildung, Musikgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „ars memorativa“?
Die „ars memorativa“ ist die mittelalterliche Gedächtniskunst. Sie diente dazu, religiöse, rechtliche und ethische Inhalte in einer Zeit zu bewahren, in der Schriftlichkeit noch nicht weit verbreitet war.
Wer gilt als Erfinder der Mnemotechnik?
In der antiken Tradition wurde der Dichter Simonides (557-467 v. Chr.) oft als Erfinder genannt, obwohl wissenschaftliche Belege dafür fehlen. Cicero und Quintilian überlieferten diese Legende.
Welche Rolle spielte das Gedächtnis beim mittelalterlichen Choralgesang?
Musiker und Chorknaben mussten enorme Mengen an Melodien und Texten auswendig lernen. Die Mündlichkeit dominierte lange Zeit über die aufkommende Musiknotation.
Wie half die Reimform beim Auswendiglernen von Musik?
Die Reimform und rhythmische Schemata (wie der Modalrhythmus) dienten als mnemotechnische Stützen, um komplexe mehrstimmige Kompositionen im Gedächtnis zu behalten.
Welchen Einfluss hatte die Mündlichkeit auf die frühe Mehrstimmigkeit?
Die Arbeit diskutiert die Hypothese, dass die frühe mehrstimmige Musik stark durch mündliche Traditionen und Improvisation geprägt war, bevor sie systematisch verschriftlicht wurde.
Warum ist die Forschung von Anna-Maria Busse Berger wichtig für dieses Thema?
Ihre Texte hinterfragen alte Theorien und zeigen auf, wie eng Gedächtniskunst und die technischen Neuerungen der Musiknotation im Mittelalter miteinander verknüpft waren.
- Quote paper
- Mag. Art. Julian Simmer (Author), 2012, Mittelalterliche Gedächtniskultur. Gedächtniskunst und frühe Mehrstimmigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936691