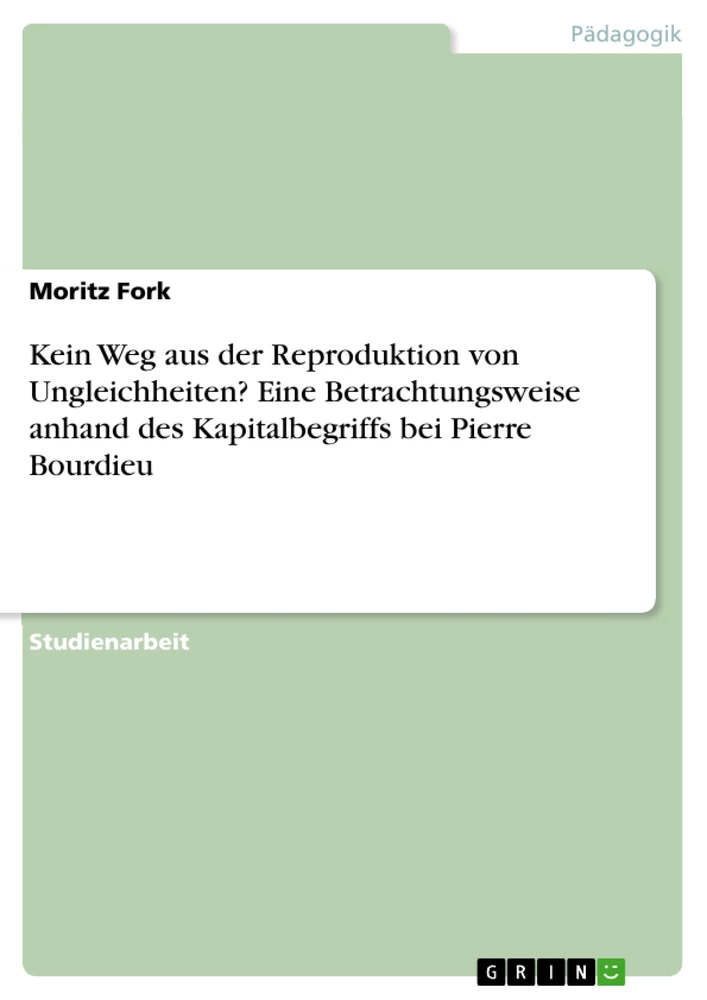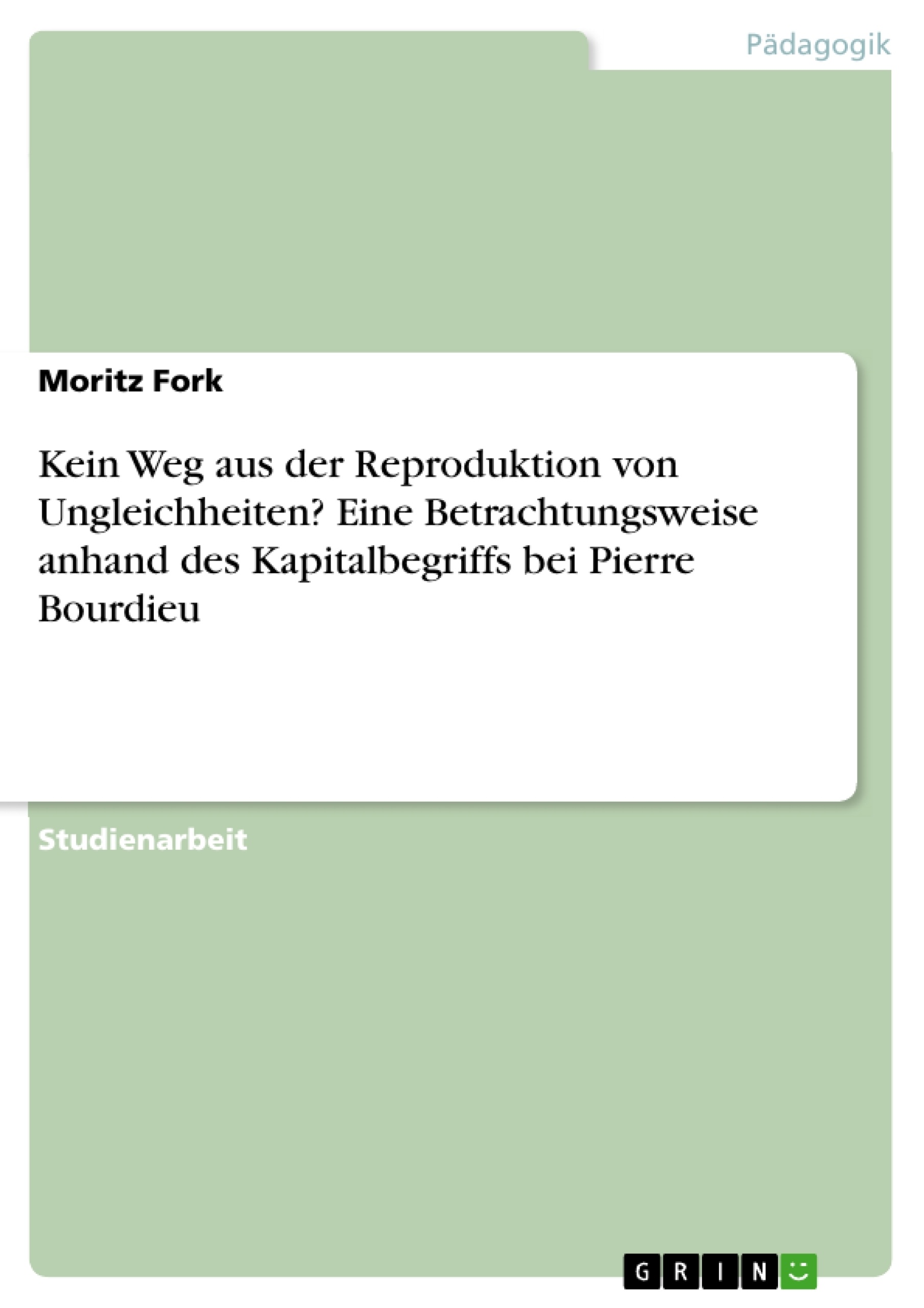Über Jahrzehnte hinweg kommen Studien zu dem Ergebnis, dass der soziale Hintergrund von Schüler*innen maßgeblich am Bildungserfolg beteiligt ist und dennoch lassen sich in diesem Bereich nur wenig Verbesserungen erzielen. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat mit seiner Kapitaltheorie und den Zusammenhängen von Kapital, Habitus und sozialem Raum signifikant dazu beigetragen die Mechanismen, die zu dem unterschiedlichen Bildungserfolg führen, zu durchleuchten. Für Bourdieu ist es vor allem das kulturelle Kapital, das zur Reproduktion von Ungleichheiten führt, also der Weitergabe der Ungleichheiten in der Familie über Generationen hinweg. Er zeigt zudem, dass neben dem kulturellen Kapital auch die Institution Schule selbst daran beteiligt ist, Ungleichheiten weiter aufrecht zu erhalten, indem die Schule genau das tut, wofür sie existiert, nämlich Menschen auszubilden und zu selektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pierre Bourdieu - Leben und Werk
- Die Kapitalsorten, der soziale Raum und der Habitus
- Das ökonomische Kapital
- Das kulturelle Kapital
- Das soziale Kapital
- Das symbolische Kapital
- Der soziale Raum und der Habitus
- Die Reproduktion von Ungleichheiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert anhand der soziologischen Theorien von Pierre Bourdieu die Mechanismen, die die Reproduktion von Ungleichheiten im Bildungssystem bewirken. Das Hauptziel ist es, zu verstehen, warum diese Ungleichheiten trotz großer Anstrengungen bestehen bleiben und wie sie durch die Struktur des Bildungssystems selbst verstärkt werden.
- Der Einfluss des sozialen Hintergrunds auf den Bildungserfolg
- Pierre Bourdieus Kapitaltheorie und ihre Anwendung auf das Bildungssystem
- Die Rolle des kulturellen Kapitals in der Reproduktion von Ungleichheiten
- Der Einfluss des Habitus auf Bildungsverläufe
- Die strukturelle Reproduktion von Ungleichheiten durch das Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Relevanz des Themas der Reproduktion von Ungleichheiten im Bildungssystem im Kontext des 8. Nationalen Bildungsberichts beleuchtet. Kapitel 2 gibt einen Einblick in das Leben und Werk des Soziologen Pierre Bourdieu, dessen Theorie das Fundament für die Analyse der Ungleichheitsmechanismen bildet. Kapitel 3 beleuchtet die verschiedenen Kapitalsorten, den sozialen Raum und den Habitus, die Bourdieu als zentrale Elemente seiner Theorie identifiziert. Dieses Kapitel erklärt, wie sich diese Konzepte auf den Bildungserfolg auswirken.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Kapitaltheorie, kulturelles Kapital, sozialer Raum, Habitus, Bildungserfolg, Reproduktion von Ungleichheiten, Bildungssystem, soziologisches Modell, Klassenbewusstsein, soziale Verhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das kulturelle Kapital laut Pierre Bourdieu für den Bildungserfolg?
Laut Bourdieu ist das kulturelle Kapital maßgeblich für die Reproduktion von Ungleichheiten verantwortlich. Es beschreibt die Weitergabe von Wissen, Bildung und kulturellen Werten innerhalb der Familie über Generationen hinweg, was den Bildungserfolg beeinflusst.
Was versteht Bourdieu unter dem Begriff „Habitus“?
Der Habitus ist ein zentrales Element in Bourdieus Theorie und beschreibt die grundlegende Orientierung und das Auftreten eines Menschen, das durch seine soziale Herkunft und seinen Platz im sozialen Raum geprägt wird und somit Bildungsverläufe beeinflusst.
Inwiefern trägt die Institution Schule zur Ungleichheit bei?
Die Schule trägt zur Aufrechterhaltung von Ungleichheiten bei, indem sie Menschen ausbildet und selektiert. Dabei werden oft genau die Kompetenzen belohnt, die Kinder aus privilegierten Schichten bereits durch ihr familiäres Umfeld mitbringen.
Welche Kapitalsorten unterscheidet Bourdieu in seiner Theorie?
Bourdieu unterscheidet primär zwischen ökonomischem Kapital (Geld, Besitz), kulturellem Kapital (Wissen, Bildungstitel), sozialem Kapital (Netzwerke, Beziehungen) und symbolischem Kapital (Prestige, Ehre).
Warum bleiben Bildungsungleichheiten trotz Reformbemühungen bestehen?
Die Arbeit analysiert, dass die strukturelle Reproduktion durch das Zusammenspiel von Kapital, Habitus und den Selektionsmechanismen des Bildungssystems so tief verankert ist, dass einfache Reformen oft nur wenig bewirken.
- Quote paper
- Moritz Fork (Author), 2020, Kein Weg aus der Reproduktion von Ungleichheiten? Eine Betrachtungsweise anhand des Kapitalbegriffs bei Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936726