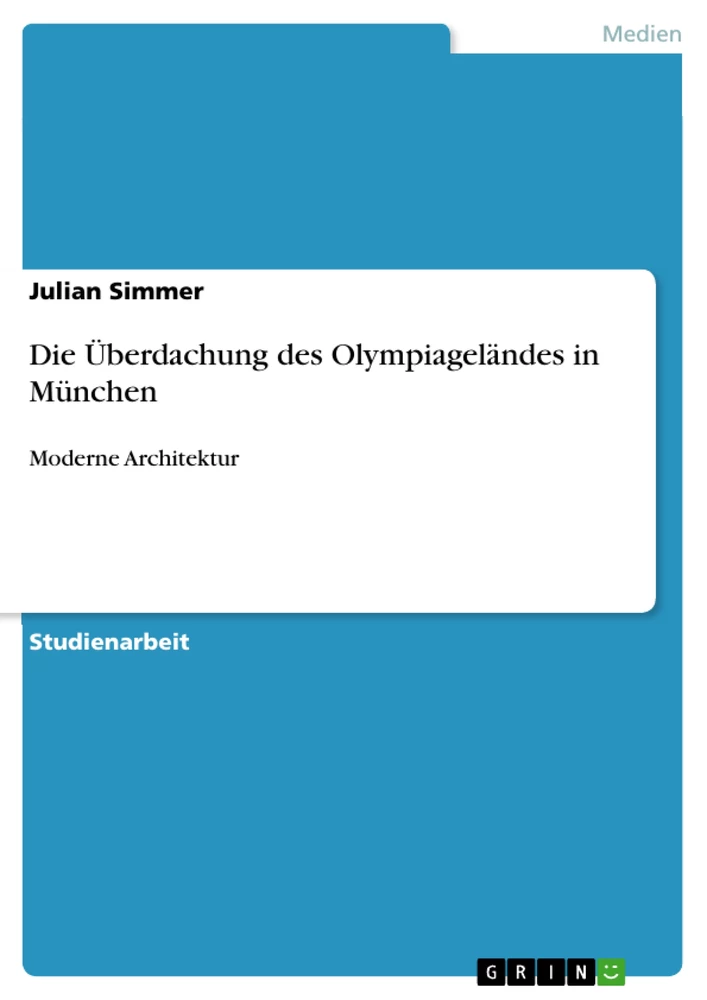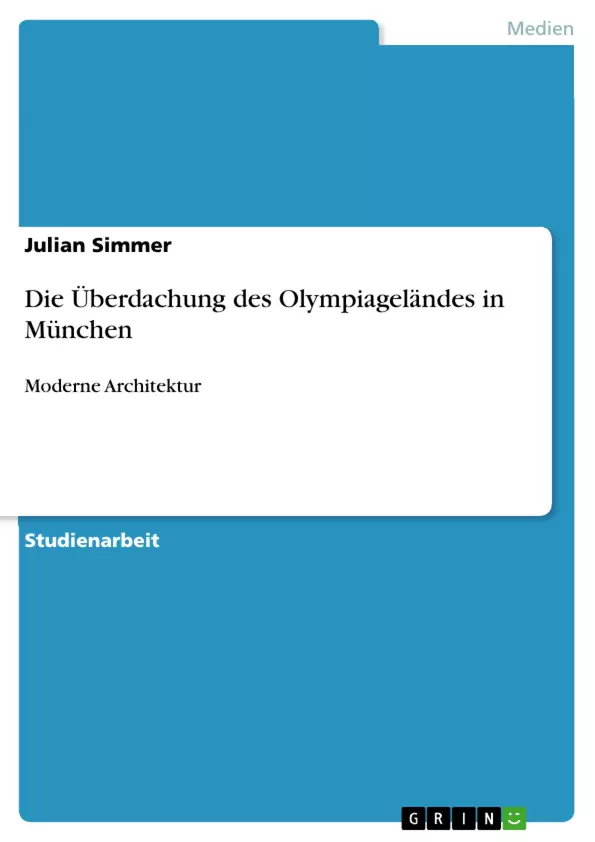In dieser Hausarbeit geht um die Überdachung des Olympia-Geländes in München.
Einst als temporäres Sport- und Mehrzweck Gebäude für die 20. Olympischen Sommerspiele 1972 erbaut, befindet sich das Olympia-Gelände heute noch auf dem Oberwiesenfeld in München. Die Bauzeit betrug vier Jahre (1968-1972). Schon sechsunddreißig Jahre davor fanden die ersten olympischen Spiele in Deutschland in Berlin statt, allerdings noch unter der Hakenkreuzflagge. Das Olympische Komitee lies die Olympischen Spiele unter dem Motto „Spiele im Grünen, Spiele der Kunst und des Sports“ stattfinden und so wurde das Oberwiesenfeld ausgewählt, das im 18 Jh. als Artillerieübungsplatz, Exerzierplatz und Kasernengelände genutzt wurde und seit 1909 zeitweise auch als Flugplatz gedient hat. Vor 1945 sollte dort ein Güterbahnhof mit Großmarkthalle und Schlachthof entstehen, was der zweite Weltkrieg jedoch verhinderte. Danach wurde das Gelände für das Abladen von Schutt aus dem Krieg genutzt und lag sonst brach. Das Konzept der Olympischen Spiele sollte sich an den Idealen der Demokratie orientieren. Es sollten Optimismus für die Zukunft und die damals damit gekoppelte positive Einstellung zur Technik und Erinnerungen an die Vergangenheit integriert werden. Somit sollte sich München von den Olympischen spielen 1936 in Berlin abheben.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtlicher Hintergrund
- Architekturtheoretische Grundlagen
- Beschreibung
- Seilnetz
- Fundamente
- Montageerläuterung
- Die Dachhaut
- Quellen
- Bilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Überdachung des Olympia-Geländes in München, ein bedeutendes architektonisches Werk, das für die 20. Olympischen Sommerspiele 1972 errichtet wurde. Die Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Projekts, den architektonischen Grundlagen und der technischen Ausführung der Überdachung.
- Geschichtlicher Hintergrund und die Entstehung des Olympia-Geländes in München
- Architekturtheoretische Grundlagen, insbesondere das Konzept der Situationsarchitektur
- Die technische Ausführung der Überdachung, inklusive der Seilnetzkonstruktion und der verwendeten Materialien
- Die Rolle der beteiligten Architekten und Ingenieure, wie Frei Otto und Jörg Schlaich
- Die Herausforderungen und die innovative Umsetzung des Projekts
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtlicher Hintergrund
Dieses Kapitel zeichnet die Geschichte des Olympia-Geländes in München nach, beginnend mit den ersten Olympischen Spielen in Deutschland im Jahre 1936. Es erläutert die Motivation für die Wahl des Standorts und die ideologische Bedeutung des Projekts im Kontext der Nachkriegszeit. Zudem beleuchtet es den Architekturwettbewerb und die Rolle des Architektenbüros Behnisch & Partner.
Architekturtheoretische Grundlagen
Dieses Kapitel analysiert die architektonischen Grundlagen des Olympia-Geländes, insbesondere das Konzept der Situationsarchitektur. Es erklärt die Integration von Architektur und Landschaft und die Verbindung von Sport und Natur.
Beschreibung
Seilnetz
Dieses Kapitel beschreibt die technische Ausführung der Überdachung, insbesondere die Seilnetzkonstruktion. Es erläutert die Funktionsweise des vorgespannten Seilnetzes, die verwendeten Materialien und die geometrischen Besonderheiten.
Montageerläuterung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Montage der Überdachung. Es erklärt die einzelnen Schritte der Konstruktion und die Herausforderungen, die bei der Umsetzung entstanden sind.
Schlüsselwörter
Olympia-Gelände, München, Überdachung, Seilnetzkonstruktion, Situationsarchitektur, Frei Otto, Jörg Schlaich, Behnisch & Partner, Olympische Spiele 1972, Leichtbau.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das Olympiadach in München erbaut?
Die Bauzeit der Überdachung des Olympia-Geländes betrug vier Jahre, von 1968 bis 1972.
Wer waren die Architekten und Ingenieure des Projekts?
Das Projekt wurde vom Architektenbüro Behnisch & Partner entworfen, wobei Frei Otto und Jörg Schlaich maßgeblich an der innovativen Seilnetzkonstruktion beteiligt waren.
Was ist das Besondere an der Konstruktion?
Es handelt sich um ein vorgespanntes Seilnetz, eine damals revolutionäre Leichtbauweise, die Architektur und Landschaft fließend miteinander verbindet.
Welche ideologische Bedeutung hatte das Gelände?
Das Konzept sollte sich von den Spielen 1936 in Berlin abheben und die Ideale der Demokratie, Optimismus und eine positive Einstellung zur Technik widerspiegeln („Spiele im Grünen“).
Wie wurde das Gelände vor 1972 genutzt?
Das Oberwiesenfeld diente früher als Exerzierplatz, zeitweise als Flugplatz und nach 1945 als Schuttberg für Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg.
- Arbeit zitieren
- Mag. Art. Julian Simmer (Autor:in), 2013, Die Überdachung des Olympiageländes in München, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936765