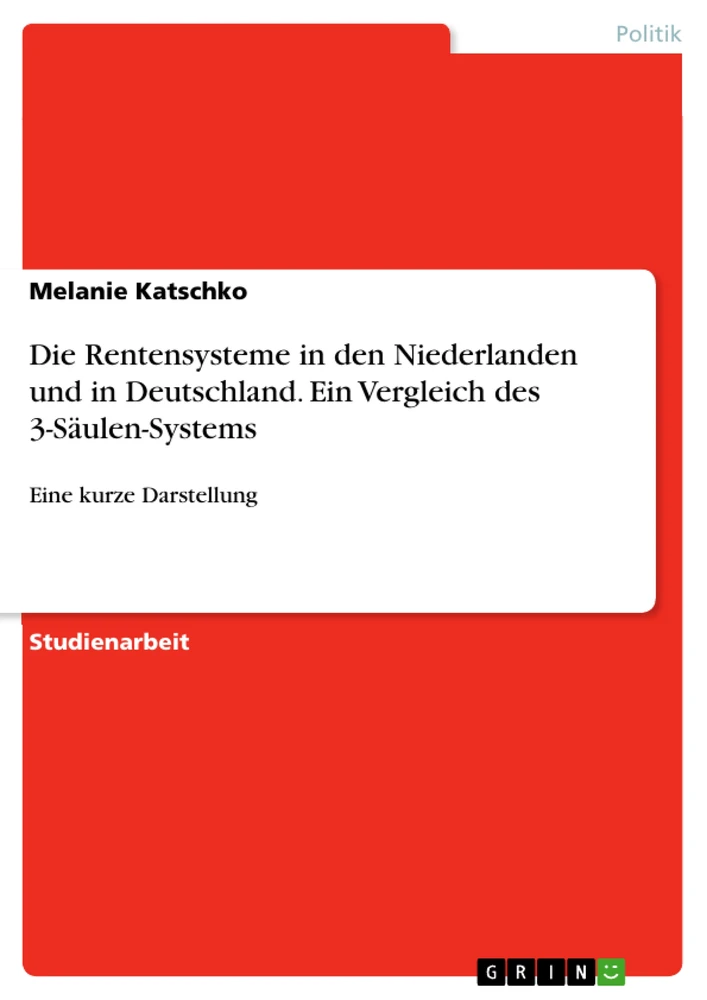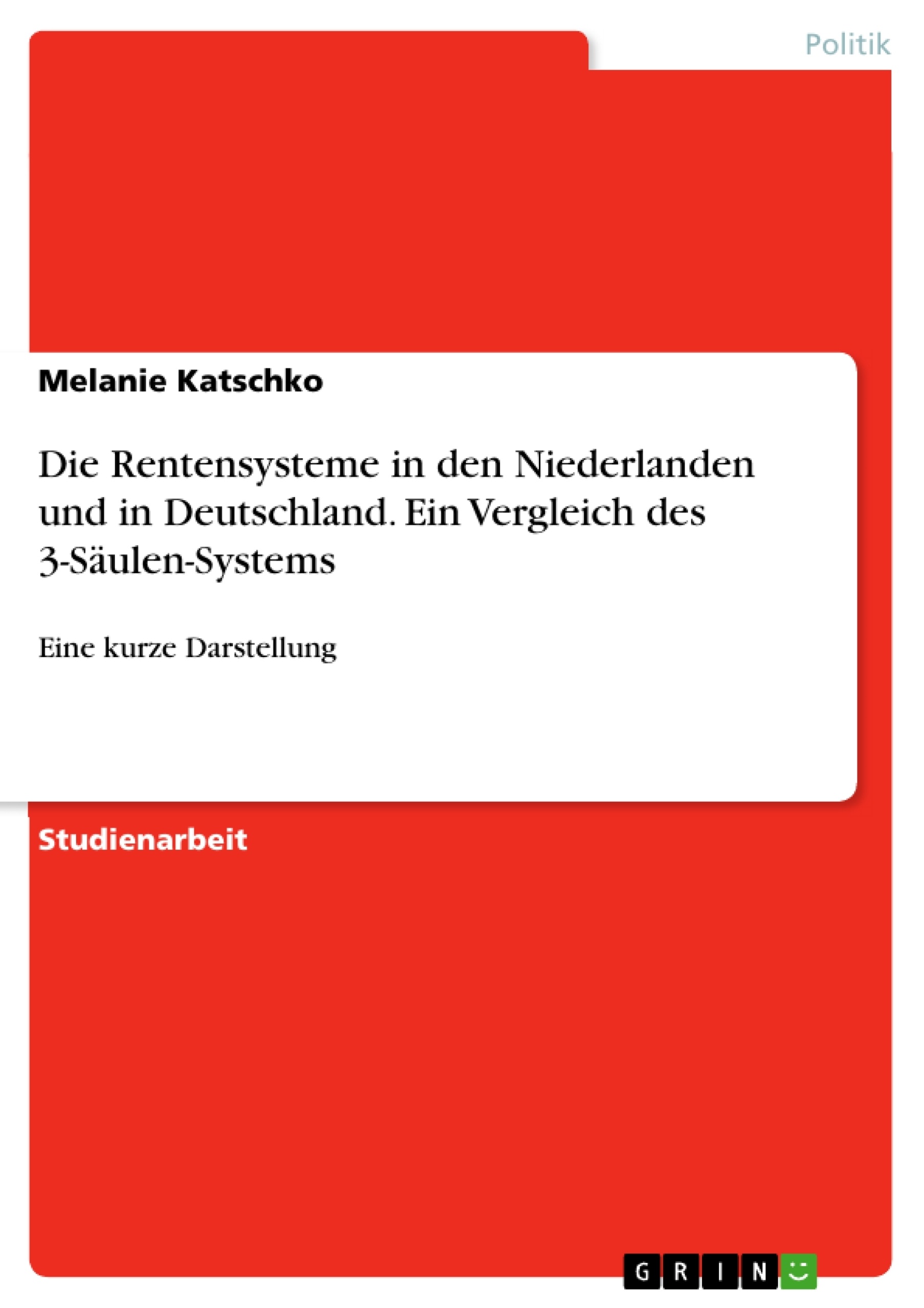Die Arbeit stellt die Frage, welche signifikanten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Rentensystem bestehen? Im Rahmen eines theoretischen Ansatzes erfolgt in der Arbeit zunächst ein Definitionsansatz vom Wohlfahrtsstaat. Anschließend werden drei Typen des Wohlfahrtsstaates (Liberaler Wohlfahrtsstaat, Konservativer Wohlfahrtsstaat und Sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat) nach Esping-Andersen unterschieden. Die konzeptionelle Herangehensweise gründet auf der vergleichenden Methode nach Lijphart. Damit werden die drei Säulen des deutschen und des niederländischen Rentensystems jeweils untersucht. Im Anschluss werden die Unterschiede analysiert und abschließend zusammengefasst. Das Anliegen der Arbeit besteht darin, gegebenenfalls auf Reformen und Verbesserungen im deutschen Rentensystem aufmerksam zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Definitionsansatz von „Wohlfahrtsstaat“
- 2.2 Einordnung der Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen
- 3. Vergleichende Methode nach Lijphart
- 4. Deutsches Rentensystem: 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge
- 4.1 Erste Säule
- 4.2 Zweite Säule
- 4.3 Dritte Säule
- 5. Niederländisches Rentensystem: Das Cappuccino-Modell als 3-Säulen-System
- 5.1 Erste Säule
- 5.2 Zweite Säule
- 5.3 Dritte Säule
- 6. Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Rentensystem
- 6.1 Erste Säule
- 6.2 Zweite Säule
- 6.3 Dritte Säule
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die signifikanten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Rentensystem. Sie analysiert die Systeme im Kontext der internationalen Wohlfahrtsstaatsforschung, nutzt den theoretischen Rahmen von Esping-Andersen zur Einordnung der Systeme und die vergleichende Methode nach Lijphart für die Analyse der drei Säulen beider Systeme. Das Ziel ist es, die Unterschiede aufzuzeigen und gegebenenfalls auf mögliche Reformen im deutschen System hinzuweisen.
- Vergleich der deutschen und niederländischen Rentensysteme
- Anwendung des theoretischen Rahmens von Esping-Andersen
- Verwendung der vergleichenden Methode nach Lijphart
- Analyse der drei Säulen beider Rentensysteme
- Aufzeigen von Unterschieden und Implikationen für das deutsche System
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den Spitzenplatz des niederländischen Rentensystems im Melbourne Mercer Global Index im Jahr 2019 hervorhebt und den Vergleich mit dem deutschen System im Mittelfeld ansetzt. Sie formuliert die Forschungsfrage nach den signifikanten Unterschieden und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung, dem Modell von Esping-Andersen und der Methode nach Lijphart basiert. Das Ziel ist die Analyse der drei Säulen beider Systeme und die Ableitung von möglichen Reformimpulsen für das deutsche System.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es beginnt mit einer Diskussion des vielschichtigen Begriffs "Wohlfahrtsstaat" und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen. Es folgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsstaaten (liberal, konservativ, sozialdemokratisch), wobei die Kriterien Dekommodifizierung, Residualismus, Privatisierung, Korporatismus/Etatismus, Umverteilungskapazität und Vollbeschäftigungsgarantie erläutert und anhand von Beispielsländern veranschaulicht werden.
3. Vergleichende Methode nach Lijphart: Kapitel 3 beschreibt die methodische Grundlage der Arbeit – die vergleichende Methode nach Lijphart. Es erläutert die verschiedenen konzeptionellen Herangehensweisen in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung (Polity-, Politics- und Policy-Dimensionen) und argumentiert für den Einsatz der vergleichenden Methode im engeren Sinne mit Fokus auf die Analyse der drei Säulen des Rentensystems in Deutschland und den Niederlanden. Die Auswahl der Variablen (Beitragsberechtigte, Rententypen, Finanzierungsarten und staatlicher Einfluss) wird begründet, und die Stärken und Schwächen dieser Methode werden angesprochen, insbesondere die Herausforderungen der Datenvergleichbarkeit.
4. Deutsches Rentensystem: 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das dreisäulige deutsche Rentensystem. Es analysiert die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) als erste Säule, beleuchtet die verschiedenen Träger der GRV und deren Bedeutung für die Altersvorsorge der Bevölkerung. Die weiteren Säulen (zweite und dritte Säule) werden ebenfalls skizziert, um den Gesamtüberblick des Systems zu gewährleisten. Hierbei geht es um die Struktur, Aufbau und die Rolle jeder Säule im Kontext des Gesamtmodells.
5. Niederländisches Rentensystem: Das Cappuccino-Modell als 3-Säulen-System: Ähnlich wie Kapitel 4, konzentriert sich dieses Kapitel auf das niederländische Rentensystem, ebenfalls als dreisäuliges Modell beschrieben. Das sogenannte „Cappuccino-Modell“ wird als Metapher für die Zusammensetzung des Systems verwendet. Die Analyse umfasst die detaillierte Beschreibung der jeweiligen Säulen, ihre Finanzierung und ihre Rolle innerhalb des gesamten Systems, sowie den Vergleich mit dem deutschen Pendant.
6. Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Rentensystem: Dieses Kapitel zieht einen direkten Vergleich zwischen den deutschen und niederländischen Systemen. Es vergleicht die drei Säulen beider Systeme in Bezug auf ihre Ausgestaltung, Finanzierung und deren Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Dabei werden die spezifischen Unterschiede im Detail analysiert, welche zum besseren Verständnis des Funktionierens beider Modelle beitragen.
Schlüsselwörter
Rentensystem, Deutschland, Niederlande, Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Lijphart, Vergleichende Methode, Drei-Säulen-Modell, Altersvorsorge, soziale Sicherung, Dekommodifizierung, Residualismus, Privatisierung.
FAQ: Vergleich des deutschen und niederländischen Rentensystems
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht das deutsche und das niederländische Rentensystem. Sie analysiert die Unterschiede der Systeme im Kontext der internationalen Wohlfahrtsstaatsforschung und nutzt dabei den theoretischen Rahmen von Esping-Andersen sowie die vergleichende Methode nach Lijphart.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die vergleichende Methode nach Lijphart, um die drei Säulen der Rentensysteme in Deutschland und den Niederlanden zu analysieren. Der theoretische Rahmen basiert auf Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsstaaten. Die Analyse konzentriert sich auf die Politik-Dimension (Policy) und vergleicht Variablen wie Beitragsberechtigte, Rententypen, Finanzierungsarten und staatlichen Einfluss.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den theoretischen Rahmen von Gøsta Esping-Andersen, der verschiedene Wohlfahrtsstaatsmodelle (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) unterscheidet, basierend auf Kriterien wie Dekommodifizierung, Residualismus und Privatisierung. Die vergleichende Methode von Arend Lijphart dient als methodischer Ansatz.
Wie ist das deutsche Rentensystem aufgebaut?
Das deutsche Rentensystem ist ein Drei-Säulen-Modell. Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung (GRV). Die zweite und dritte Säule umfassen die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge.
Wie ist das niederländische Rentensystem aufgebaut?
Das niederländische Rentensystem wird auch als Drei-Säulen-Modell beschrieben und wird oft als „Cappuccino-Modell“ bezeichnet. Ähnlich wie das deutsche System umfasst es eine gesetzliche Rentenversicherung (erste Säule), betriebliche Altersvorsorge (zweite Säule) und private Altersvorsorge (dritte Säule). Die genaue Ausgestaltung der Säulen unterscheidet sich jedoch vom deutschen System.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Rentensystemen?
Die Arbeit identifiziert detaillierte Unterschiede in der Ausgestaltung, Finanzierung und den Auswirkungen der drei Säulen beider Systeme auf die Altersvorsorge. Diese Unterschiede werden im Detail analysiert, um das Funktionieren beider Modelle besser zu verstehen. Die konkreten Unterschiede werden im Kapitel 6 erläutert.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die signifikanten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Rentensystem aufzuzeigen und mögliche Implikationen für Reformen im deutschen System zu diskutieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen, Vergleichende Methode nach Lijphart, Deutsches Rentensystem, Niederländisches Rentensystem, Unterschiede zwischen den Systemen und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rentensystem, Deutschland, Niederlande, Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Lijphart, Vergleichende Methode, Drei-Säulen-Modell, Altersvorsorge, soziale Sicherung, Dekommodifizierung, Residualismus, Privatisierung.
Wo wird das niederländische Rentensystem im internationalen Vergleich eingeordnet?
Die Einleitung erwähnt den Spitzenplatz des niederländischen Rentensystems im Melbourne Mercer Global Index im Jahr 2019 im Gegensatz zum deutschen System, welches sich im Mittelfeld befand. Dieser Vergleich dient als Ausgangspunkt für die detaillierte Analyse der Unterschiede.
- Citar trabajo
- Melanie Katschko (Autor), 2020, Die Rentensysteme in den Niederlanden und in Deutschland. Ein Vergleich des 3-Säulen-Systems, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937093